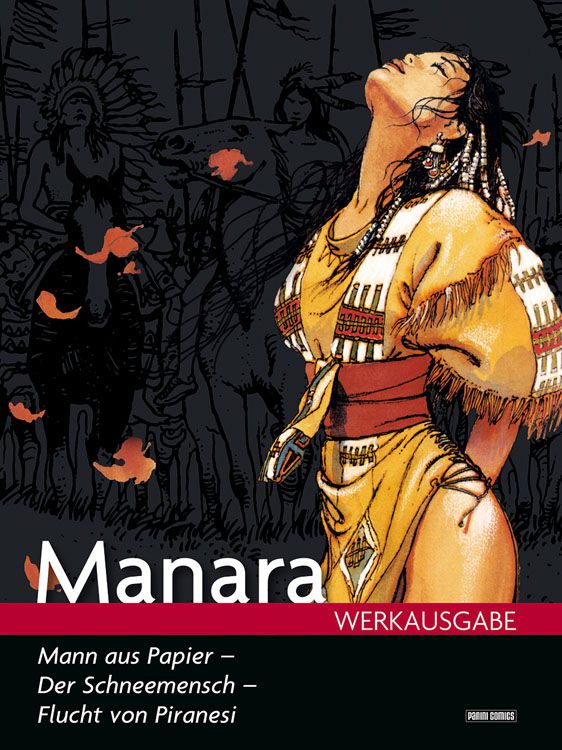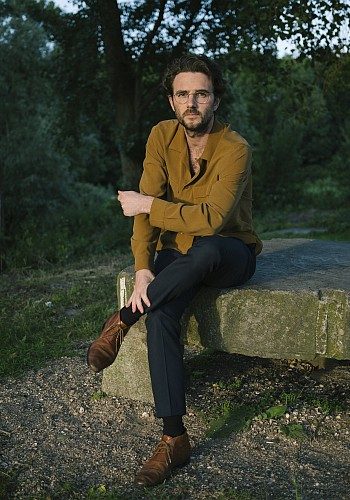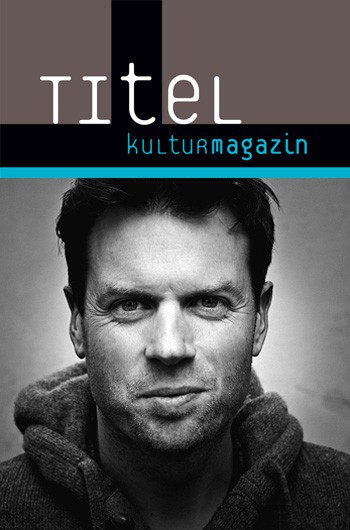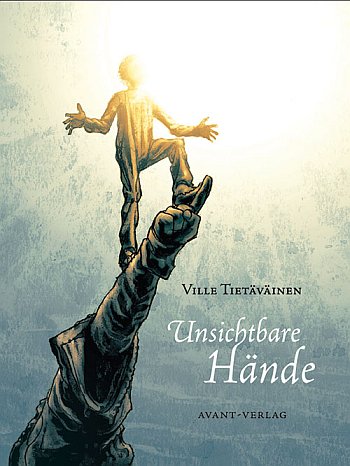Menschen | Zum Tod der Schriftstellerin Ruth Rehmann
»Vorlieb nehmen ist eine Denkbewegung, die man lernen kann, sagt Ludwig Wittgenstein. Aber soweit bin ich noch nicht.« So ließ Ruth Rehmann ihren 1999 erschienenen Roman ›Fremd in Cambridge‹ ausklingen. Mit einem Credo, das für ihren eigenen Lebensweg durchaus charakteristisch war. Von PETER MOHR
Die Autorin engagierte sich viele Jahre in der Friedensbewegung und war überdies eine leidenschaftliche Streiterin gegen die Umweltzerstörung und die Globalisierung.
Ruth Rehmann, die am 1. Juni 1922 als Tochter eines Pastors in Siegburg geboren wurde, besuchte nach dem Abitur zunächst eine Dolmetscherschule, später studierte sie Archäologie und Germanistik in Bonn und Marburg und in Berlin überdies Musik – mit dem Hauptfach Geige.
Ehe sich die umfassend gebildete Autorin ganz ihrem schriftstellerischen Werk widmete, arbeitete sie als Lehrerin, Pressereferentin, Reisejournalistin und Dolmetscherin für ausländische Botschaften in Deutschland. Zwar wurde Ruth Rehmann schon Anfang der 60er Jahre mit einigen Preisen ausgezeichnet und war Mitglied der Gruppe 47, doch der große Durchbruch gelang ihr erst 1979 mit dem Roman ›Der Mann auf der Kanzel: Fragen an den Vater.‹ Ein Buch der doppelten Anklage – das bohrende Fragen nach der Schuld der Vätergeneration und der Rolle der Kirche im Nationalsozialismus aufwarf.
»Mein Schreiben war immer darauf gerichtet, Kompliziertes einfach zu machen«, schrieb Ruth Rehmann in ihrem 1993 erschienenen Band ›Unterwegs in fremden Träumen‹, in dem sie sich mit dem deutsch-deutschen Schriftstellertreffen von 1947 auseinandersetzte. Auslöser dieser literarischen Retrospektive war für Ruth Rehmann die gesamtdeutsche PEN-Tagung in Kiel nach dem Mauerfall. Wie ein roter Faden ziehen sich Enttäuschungen und zerstörte Illusionen durch das Buch. Sie äußerten sich 1947 wie 1991 darin, dass die Schriftsteller an ihrem eigenen hohen Anspruch, die gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflussen zu wollen, kläglich scheiterten.
Ihr gelungenstes Werk legte Ruth Rehmann, die 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, erst im Alter von 77 Jahren vor. ›Fremd in Cambridge‹ (wie fast alle Werke im Carl Hanser Verlag erschienen) ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die humanistische Bildung; ein Roman, in dem der Wohlklang eines Gedichts gar ein kleines »medizinisches Wunder« vollbringt. Alles andere als ein melancholisches Alterswerk. Am 29. Januar ist Ruth Rehmann in ihrer Wahlheimat Trostberg im Chiemgau im Alter von 93 Jahren gestorben.