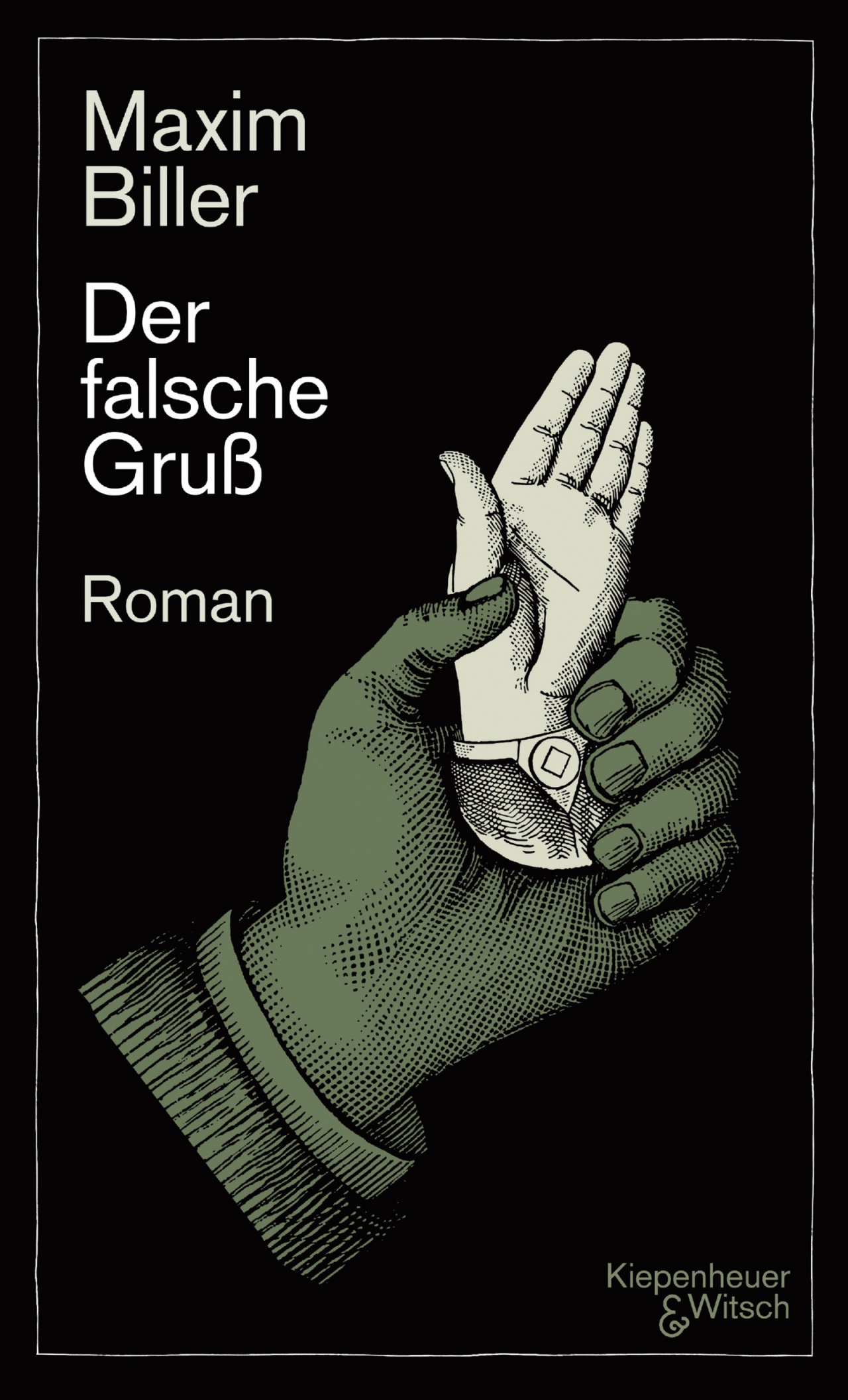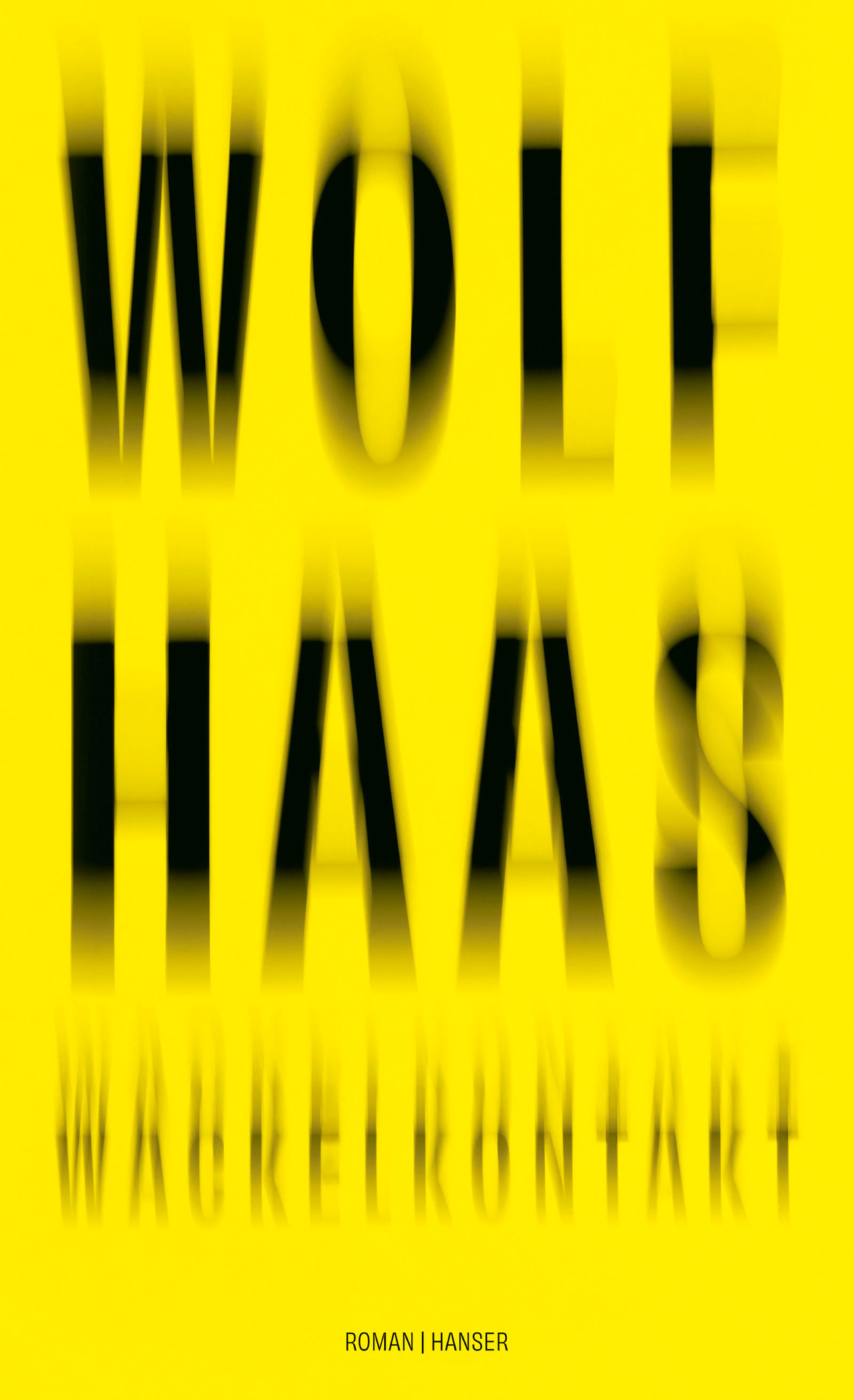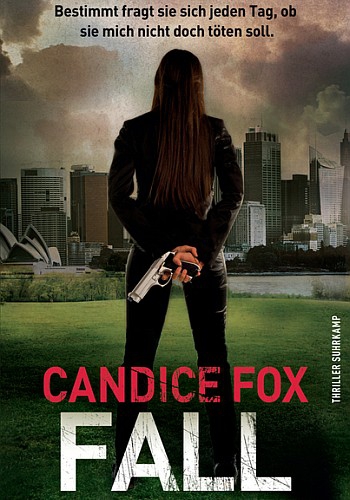Im Verlauf der großartigen Edition seines Œuvres, das im Luchterhand Verlag gleichzeitig sein Frühwerk und sein fortlaufendes Spätwerk auf Deutsch präsentiert – immer in der bewundernswerten Übersetzung Maralde Meyer-Minnemanns –, ist ›Einblick in die Hölle‹ jetzt erst erschienen. Von WOLFRAM SCHÜTTE
 Ich erinnere mich, in einem sehr frühen TV-Film mit und über António Lobo Antunes, den der deutsche Kulturjournalist Jürgen Wilcke gedreht hatte, den Schriftsteller auf einer Steinbank sitzend gesehen zu haben, neben ihm seine Patienten. Es muss ein halbrunder Innenraum im Hospital Miguel Bombarda in Lissabon gewesen sein, wo der Autor noch in den neunziger Jahren als Psychiater arbeitete, als zum ersten Mal – es waren nur vier seiner Romane auf Deutsch erschienen – davon die Rede war, Lobo Antunes sei ein legitimer Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Als er da im Kreise seiner apathischen Patienten saß, war er nicht von ihnen zu unterscheiden: ein stiller Melancholiker, traurig blickend in traulicher Umgebung.
Ich erinnere mich, in einem sehr frühen TV-Film mit und über António Lobo Antunes, den der deutsche Kulturjournalist Jürgen Wilcke gedreht hatte, den Schriftsteller auf einer Steinbank sitzend gesehen zu haben, neben ihm seine Patienten. Es muss ein halbrunder Innenraum im Hospital Miguel Bombarda in Lissabon gewesen sein, wo der Autor noch in den neunziger Jahren als Psychiater arbeitete, als zum ersten Mal – es waren nur vier seiner Romane auf Deutsch erschienen – davon die Rede war, Lobo Antunes sei ein legitimer Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Als er da im Kreise seiner apathischen Patienten saß, war er nicht von ihnen zu unterscheiden: ein stiller Melancholiker, traurig blickend in traulicher Umgebung.
Es ist durchaus denkbar, dass Lobo Antunes selbst den Vorschlag zu dieser Sequenz machte. Als deutscher Leser seiner Romane konnte man damals jedoch noch nicht wissen, wie genau dieser Ort und seine Anwesenden zu ihm passten und wie sehr die Szene dem literarischen Ambiente seines dritten Romans ›Einblick in die Hölle‹ (1983) entsprach, der sieben Jahre nach der Rück- und Heimkehr des Chirurgen von den Kriegsfeldern Angolas und seinem Eintritt als Psychiater in die Klinik Miguel Bombarda erschienen war. Denn im Verlauf jener großartigen Edition seines Œuvres, das im Luchterhand Verlag gleichzeitig sein Frühwerk und sein fortlaufendes Spätwerk auf Deutsch präsentiert – immer in der bewundernswerten Übersetzung Maralde Meyer-Minnemanns –, ist ›Einblick in die Hölle‹ jetzt erst erschienen.
Im Vergleich zu dem drei Jahre später erschienenen Epos eines Kriegsveteranentreffens, das der vor einem Jahr publizierte ›Fado Alexandrino‹(1983) mehrstimmig erzählt, ist Einblick in die Hölle zum einen schmaler in jeder Hinsicht (kürzer und nur zwischen der Innen- und Ich- und der Außen- und Er-Perspektive wechselnd), zum anderen aber das bislang einzige seiner uns bekannten Bücher, in dem er unmittelbar, fast ohne fiktionalisierten Paravent, als António Lobo Antunes selbst Erzähler und Hauptperson ist.
Er wird, als er seinen neuen Arbeitsplatz, die psychiatrische Klinik, betritt, vom Pförtner als der Sohn des früheren Chefarztes erkannt; und auch seine gescheiterte Ehe wird erwähnt, seine zwei daraus hervorgegangenen Töchter werden direkt angesprochen, und dass er Schriftsteller ist, der zuvor den noch nicht übertragenen Roman ›Das Gedächtnis eines Elephanten‹ geschrieben hat, wird dem damaligen Leser derart unter die Nase gerieben, dass man den Eindruck gewinnen muss, das autobiografische Unterfutter liege hier einmal buchstäblich bloß und provozierend offen vor aller Augen (während es sonst in seinem Œuvre zwar vermutbar, aber doch unterm jeweiligen fiktionalen Zuschnitt seiner Phantasmen, Halluzinationen und Metaphern verborgen bleibt.)
Das dritte Buch des Portugiesen setzt, ungeschützter als alle zuvor und danach, also alles auf die autobiografische Karte, und man könnte mutmaßen, dass der achtunddreißigjährige Autor, der sich da bloßstellt, in einer ähnlichen existenziellen Krise war wie Peter Handke, als er über seine Mutter und deren Selbstmord in seiner äußerst dichten Erzählung ›Wunschloses Unglück‹ schrieb.
Man kann sich schon vorstellen, auch heute noch, dass ›Einblick in die Hölle‹ bei seinem Erscheinen Skandal machte: zum einen durch die nach außen gekehrte Intimität des Autors, zum anderen aber durch seinen schonungslosen, ja höhnischen Angriff auf die Psychiatrie, die Psychiater in der Klinik Miguel Bombarda, wo er ja, vom »Staat angestellt«, seine 20000 Escudos monatlich verdiente, die er damit »rechtfertigte, daß ich Menschen in der Anstalt gefangen nehme, mir zerstreut ihre Sorgen und Klagen anhöre, zu eiligen Sprechstunden zu spät in die Ambulanz komme …, so schnell rein und wieder raus aus der Anstalt wie ein Uhrenkuckuck.
»Die Typen«, fährt er mit seiner Selbstbeschreibung als Staatsangestellter fort, »bringen sich um, weil sie sich umbringen, weil das Delirium, weil die Epilepsie, weil die Psychose, erklären mir, Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, und ich denke, Und was werde ich mit meinem Leben machen, was werde ich mit meinem Leben machen in der flachen, riesigen, unendlichen Nacht des Alentejo, der mir im Summen der Insekten und im September der Bäume ständig das Geheimnis einer nicht entschlüsselbaren Botschaft anzusagen scheint«.
Diese Gedanken gehen ihm durch den Kopf, während er sich auf einer Reise befindet. Wie oft in Lobo Antunes´ Romanen ist sie der Rahmen, in den er seine Erinnerungen spannt. Hier fährt er durch den Tag, durch die Nacht von den Touristenstränden der Algarve in das verwaiste Elternhaus außerhalb von Lissabon. Er hat Urlaub von der Hölle – womit sein psychiatrischer Arbeitsplatz gemeint ist: die Lissabonner Klinik. »1973 war ich aus dem Krieg zurückgekehrt«, heißt es am Ende des ersten Kapitels, »und wußte, was das war, Verletzte, das Schreien und Jammern auf dem Pfad durch den Busch, die Explosionen, die Schüsse, die Minen, die von Explosionen in den Hinterhalten zerfetzten Leiber, ich wußte, was das war, Gefangene und ermordete Kinder, ich wußte, was das war, das vergossene Blut und Sehnsucht und Heimweh, aber vom Einblick in die Hölle war ich verschont geblieben«. Denn die wirkliche Hölle: das war die Psychiatrie, »die edelste der medizinischen Fachrichtungen«, wie ihm von seinem Vorgesetzten versichert wird, wohingegen er sich »als gut ernährter und gekleideter Wärter« eines nazistischen Vernichtungslagers vorkommt, der sich »in SS-Uniform die Begrüßungsrede des Lagerkommandanten anhört«.
Denn der Arzt, der im Krieg die äußere Zerstörung der menschlichen Körper und die Demütigung der Afrikaner miterlebte, deren Frauen die Soldaten unter ihren Augen beschliefen, wird nun »in der Heimat« (die ihm keine mehr ist, sondern nur eine Kulissenwelt aus Pappmaché) mit der inneren Zerstörung und Demütigung der psychiatrisierten Patienten konfrontiert, denen die irren Ärzte »die Kindheit ändern wollen«, die sie mit Spritzen und Tabletten »ruhig stellen« und sie der formalisierten Begrifflichkeit der Psychoanalyse unterwerfen und zu Karteileichen und Untoten machen. »Wir sind ignorante, perverse Henker«, empört sich der Neulingsarzt António Lobo Antunes.
Es gibt wohl kaum eine vehementere erzählerische Philippika in der gesamten europäischen Literatur – als eben dieser ›Einblick in die Hölle‹ des damals achtunddreißigjährigen portugiesischen Arztes: ein furioser – übrigens auch grotesk-komischer – Sturmlauf gegen die klassische und nicht klassische Psychiatrie und die selbstgefällige, selbstherrliche Zwangsherrschaft dieser »witzlosen Irren«.
Lobo Antunes‘ Charakterisierung der Psychiater als »witzlosen Irren«, seine polemische Revolte gegen deren »gesellschaftliche« Pazifizierungsfunktion der »Abweichler« von der »Normalität«, ist mehr als nur »Scham oder Bangigkeit oder schlechtes Gewissen« eines Menschen, der das Grauen im Krieg und in der Klinik durchschritten hat – wie der Pariser Armenarzt das grässliche Krepieren der »kleinen« Menschen, der als Louis Ferdinand Céline die ›Reise ans Ende der Nacht‹ rund fünfzig Jahre zuvor angetreten hatte.
Lobo Antunes, der sich im Verlauf seines eruptiven autobiografischen Romans in die Rolle des seines Selbst enteigneten Opfers von seinesgleichen Kollegen hineinversetzt, der seine sympathetische Imagination bis ins Kannibalische des Verzehrens treibt, verteidigt in und mit seinem ›Einblick in die Hölle‹ zugleich die »poetischen« Freiheiten seiner solitären literarischen Phantasie, seiner paradoxen, um nicht zu sagen: »irrwitzigen« Metaphorik, die für die schon erwähnten »unentschlüsselbaren Botschaften« der unlösbaren Qualen und Euphorien der Welt eine adäquate Sprache in lyrisch-evokativen, musikalisch strukturierten »Wortkonzentraten« nicht nur zu »erfinden«, sondern sie auch erzählerisch ein für allemal zu »setzen« versucht: als wuchernde Flora einer surrealen Bildlichkeit, die das Epische mit lyrischer Ikonografie sprenkelt.
Zurecht – kann man nach der heutigen Lektüre dieses fulminanten Frühwerks sagen – sitzt der Schriftsteller António Lobo Antunes in dem eingangs erinnerten TV-Film in der Klinik Miguel Bombarda unter den ›Seinen, zusammen‹ mit den ihm Anvertrauten: »Ich habe das Krankenhaus nie verlassen, dachte er, ich werde das Krankenhaus nie verlassen.« Zumindest für den Metaphoriker Lobo Antunes trifft das zu, wenn er auch den Fokus seiner Wahrnehmung im Laufe der folgenden Jahre wandern ließ, quer durch die portugiesische Gesellschaft und Geschichte.
Titelangaben
António Lobo Antunes: Einblick in die Hölle
Aus dem Portugiesischen von Maralde Meyer-Minnemann
München: Luchterhand 2003
287 Seiten, 20 Euro