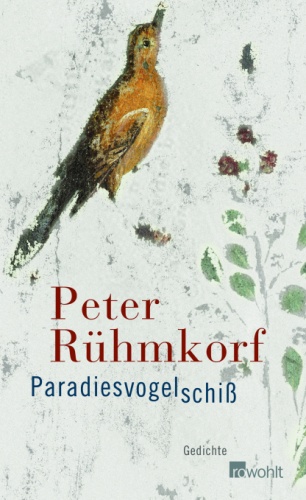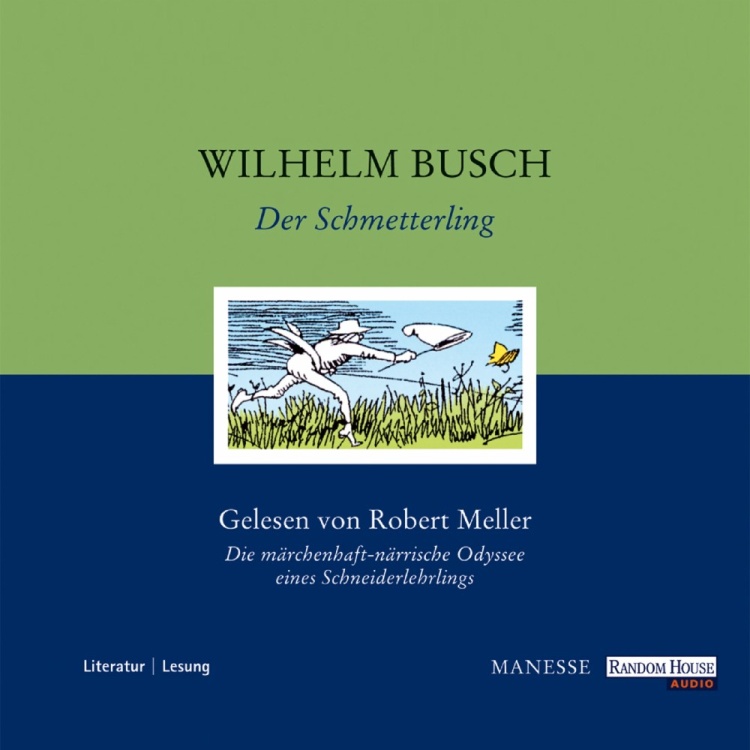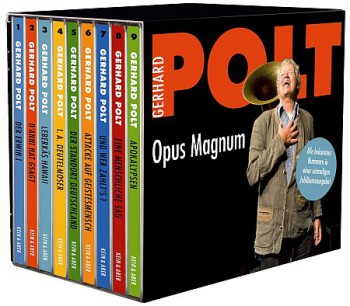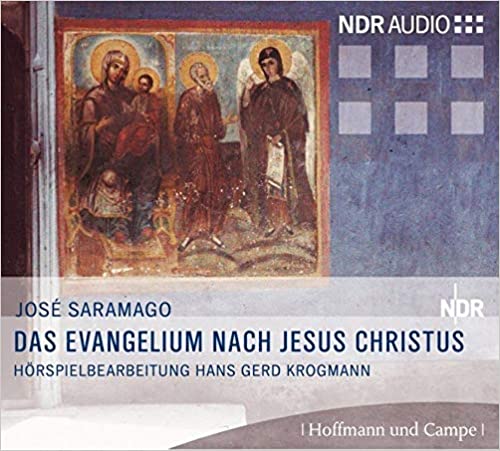Der österreichische Michael Köhlmeier hat aus Joseph Conrads berühmtester Erzählung ein extrem verdichtetes Hörspiel mit Licht- und Schattenseiten gemacht. Von SEBASTIAN KARNATZ
 Im vergangenen Jahr hätte die literarische Welt eine der faszinierendsten Figuren der Weltliteratur anlässlich ihres 150. Geburtstags feiern können. Doch Joseph Conrads rätselhaftes und schwieriges Oeuvre – mitunter auch das fragwürdige Produkt vergangener kolonialistischer Zeiten – scheint gegenüber den Mechanismen der marktschreierischen Kulturindustrie resistent zu sein.
Im vergangenen Jahr hätte die literarische Welt eine der faszinierendsten Figuren der Weltliteratur anlässlich ihres 150. Geburtstags feiern können. Doch Joseph Conrads rätselhaftes und schwieriges Oeuvre – mitunter auch das fragwürdige Produkt vergangener kolonialistischer Zeiten – scheint gegenüber den Mechanismen der marktschreierischen Kulturindustrie resistent zu sein.
Dies kann man zwar einerseits sicherlich begrüßen, da Conrad eine kommerzielle Ausschlachtung der Marke Alexander von Humboldt erspart geblieben ist, der Name Joseph Conrad jedoch mutet weiterhin wie eine der größeren weltliterarischen Leerstellen in deutschen Leseschränken an. Aus diesem Grund mag es sicherlich verdienstvoll sein, dass der Hörverlag vor Kurzem eine schon 1990 vom ORF produzierte Hörspielbearbeitung der Meistererzählung ›Herz der Finsternis‹ neu aufgelegt hat.
Vom irritierenden Status Conrads legt gerade jene Erzählung ein beredtes Zeugnis ab: Im kulturellen Bewusstsein ist sie wohl stärker als Vorlage für Coppolas gewaltiges Vietnam-Epos ›Apocalypse Now‹ verankert, denn als singuläres literarisches Werk. Trotz allem hat sich ›Herz der Finsternis‹ aus dem Jahr 1902 einen einmaligen Rang als symbolistisch aufgeladene, fiebrige Kolonialballade erkämpft – einen Rang, der dieser seltsamen Prosa zwischen Zivilisationskritik und Faszination an archaischer Gewalt auch ohne Zweifel zusteht.
Das Skelett der Finsternis
Man darf also durchaus gespannt sein, was der für die Hörspielbearbeitung verantwortliche Michael Köhlmeier aus der monolithisch-undurchdringlichen Textgrundlage gemacht hat. Köhlmeier, der sich in jüngerer Zeit vor allem durch seinen Hang zur literarischen Gigantomanie – Peter Mohr nannte seinen nahezu 800 Seiten starken Roman ›Abendland‹ sicherlich nicht zu Unrecht ein »urwüchsiges literarisches Monstrum« – hervorgetan hat, zeigt sich hier ganz im Gegenteil als radikaler Verknapper.
Er skelettiert Conrads Erzählung, verdichtet sie zu einer einzigen rätselhaften Ansammlung von Wahnträumen. Conrads Abgeschlossenheit suggerierende Erzählperspektive aus dem Rückblick behält er zwar bei, er verlegt sie jedoch in die klaustrophobische Enge eines Verhörs: Kapitän Marlow berichtet aus der Hölle. Und es ist ein gezeichneter Verhörter, der uns entgegentritt – mal flüsternd, mal schreiend, mal eindringlich beschwörend.
Bernd Rumpf und der nur wenige Jahre nach der Erstveröffentlichung des Hörspiels verstorbene Hans Gerd Kübel verleihen der etwas spröden Inszenierung Glanz. Sie lassen Conrads Erzählung zu einem nervenzehrenden Kammerspiel um die Grenzen unserer Zivilisation werden. Bedrückend, eng und brutal.
Leider jedoch war die Regie der Hörspielbearbeitung nicht immer auf der Höhe ihres Könnens. Die mystisch-archaisch anmutende Zwischenmusik verliert zu schnell ihren Reiz und die unnötig verhallten Stimmen der Protagonisten trüben den Hörgenuss teils empfindlich.
So lässt einen Köhlmeiers Conrad-Verknappung umrätselt zurück. Den Reiz dieses großen Klassikers vermeint man zwar immer noch zu spüren, wirklich restlos gelungen ist seine Übersetzung in die Welt des Hörspiels jedoch nicht.
Für den raschen Einstieg in den Kosmos Joseph Conrads allerdings mag diese Hörspielbearbeitung durchaus zu empfehlen sein. Jedenfalls so lange, bis sie durch eine bessere ersetzt wird …
Titelangaben
Joseph Conrad: Herz der Finsternis
Aus dem Englischen von Fritz Lorch
Hörspielbearbeitung: Michael Köhlmeier
Mit Bernd Rumpf und Hans Gerd Kübel
München: Der Hörverlag 2007
1 CD, Laufzeit: ca. 60 Minuten, 14,95 Euro