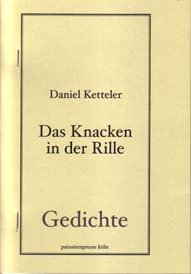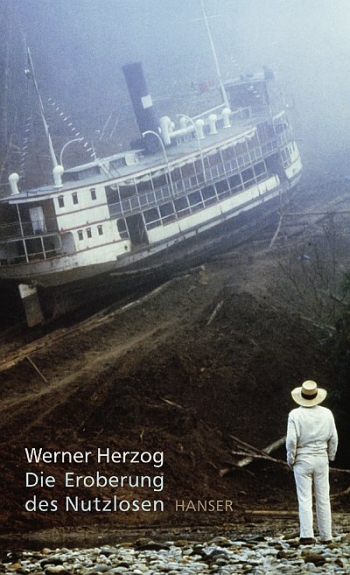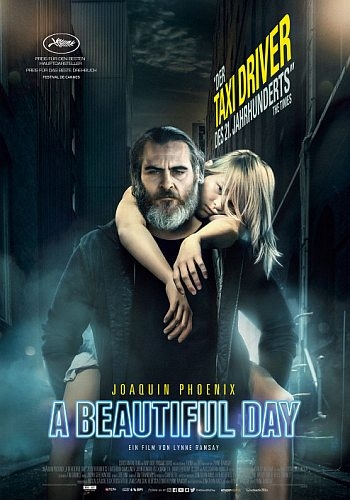Film | Im TV: Marcel Reich Ranicki: Mein Leben
Er lässt die entscheidenden Jahre einer außergewöhnlichen Lebens- und Liebesgeschichte anschaulich und lebendig werden und damit verstehen und nachempfinden, unter welchen Umständen eine Karriere ihren Anfang genommen hat, die in ihrer Ausprägung tatsächlich einmalig ist. Von PETRA KAMMANN
Bei der Premiere in Köln: großer Bahnhof. Vom Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff über den Geschäftsführer der Filmstiftung NRW, Michael Schmid-Ospach, bis zur WDR-Programmdirektorin Verena Kulenkampff. Und auch Heinrich Breloer, Schöpfer des großen Kinoerfolgs »Buddenbrooks«, erwies seine Referenz. Alle wollten sie bei dieser Premiere des Films dabei sein, der den schlichten Titel trägt: »Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben« – und dabei natürlich dem Autor selbst die Ehre geben.
Kann man solch’ eine Reflexion über das eigene Leben in einen Film umwandeln, lassen sich die Worte, die doch zugleich beschreiben und analysieren und kommentieren, und – dies vor allem – dem auf sein eigenes Leben zurückblickenden Autor wesensverwandt sind, in Bilder fassen, gar zu einer Bilderfolge werden? Der WDR ging das Wagnis ein, mit tatkräftiger Unterstützung auch der Filmstiftung NRW und des Kultursenders ARTE, um daraus ein Ereignis für die ARD zu machen. Für den Fernsehfilmchef des WDR, Gebhard Henke, der bei der FAZ für Reich-Ranicki schrieb, ist das Experiment der medialen Anverwandlung mehr als gelungen – ein Urteil, dem die Premierengäste im Kölner Cinenova Arthouse-Center mit viel Beifall zustimmten.
Die Erfolgsfaktoren?
Da ist zunächst der Autor Michael Gutmann, der die 500 Seiten der Autobiographie in ein kongeniales Drehbuch verwandelt hat. Das ist der Regisseur Dror Zahavi, der, »mit brennendem Herzen, besonnener Klugheit und phantastischen Schauspielern einen großartigen Film« geschaffen hat, so Henke. Und, da sind die Produzentin Katharina Trebitsch und Benjamin Benedict, die in enger Zusammenarbeit mit der verantwortlichen WDR-Redakteurin Barbara Buhl das stete Gespür für das subtile Zusammenspiel hatten, das ein Film erfordert – ein in sich kompliziertes Teamwork, das die besten Energien vieler Beteiligter zusammenbringen muss, wo der Buchautor am Schreibtisch ganz mit sich alleine ist.
Was, ja was wäre gewesen, wenn Marcel Reich-Ranicki diesen Film – ganz wie bei der Zurückweisung des Deutschen Fernsehpreises im vergangenen Herbst –»nicht angenommen« hätte, wie Michael Schmid-Ospach launig auf diese unvergessene und viel zitierte Aktion anspielte? Auch der Kulturstaatssekretär kam übrigens darauf zurück, gleichsam mit doppeltemAusrufezeichen die MRR-Verurteilung des Fernsehens(»alles Blödsinn«) unterstützend: »Ich teile Ihre Auffassung vollinhaltlich«. Was den Geschäftsführer der Filmstiftung natürlich nicht daran hinderte, ein Fernsehen zu loben, das eben auch Filme wie diesen ermöglicht und hervorbringt, dass damit auch Teil einer Kultur ist, die Nachdenklichkeit kennt und fördert und nicht, wie es viele vorschnell festschreiben, fortlaufend der seichten Unterhaltung huldigt.
Dem medialen Affen Zucker
Das Fernsehen ist tatsächlich zu großen Leistungen imstande, auch solchen, wie sie den Beifall von Marcel Reich-Ranicki finden würden, wenn er denn mehr übrig hätte für jene Welt außerhalb der Bücher. Wobei, nebenbei erinnert, er ja als schneidig-polternder Kritiker-Dompteur im unvergessenen »Literarischen Quartett« des ZDF durchaus dem medialen Affen Zucker gegeben hat, und er sich dem Fernsehen auch sonst nicht verweigert hat: Das zeigten beispielsweise auch seine Aufgeschlossenheit und seine Zusammenarbeit, als Lutz Hachmeister und Gerd Scobel vor drei Jahren das MRR-Leben in einem differenzierten Dokumentarfilm über ihn, »Ich Reich-Ranicki“, nachzeichneten.
Hier, im Zahavi-Film, ist das Dokumentarische weitgehend nur im Stoff angelegt – in fiktionaler Anverwandlung der Lebenserinnerungen Reich-Ranickis. Vielleicht das Erstaunlichste an dieser Verfilmung der Biographie: die Art, wie Matthias Schweighöfer sich diese Lebensgeschichte – die ja vor allem eine Geschichte des Überlebens ist, ein persönlicher Triumph (aber kein triumphaler) über die Nazi-Barbarei – in seiner Darstellung zu eigen macht, wie glaubwürdig er Reich-Ranicki verkörpert, ihm ein junges Gesicht und eine eindringliche Stimme gibt.
Sehr dicht
In der Beschränkung auf die Jugendjahre liegt natürlich ein dramaturgischer Kunstgriff. Denn auf diese Weise verdichtet sich die Geschichte, die aus einer Rahmenhandlung entwickelt wird: Vier Jahre nach Kriegsende wird Marcel Reich-Ranicki, damals polnischer Vizekonsul, von London aus nach Warschau geschickt, wo ihm die herrschenden Kommunisten ideologische Entfremdung vorwerfen, ihn im Gefängnis verhören lassen und ihm die Parteimitgliedschaft entziehen. Daraus lassen sich, auch mit dem klassischen Mittel der Erzählstimme aus dem Off, die Linien der Kinder- und Jugendjahre ziehen – mit der Leidenszeit im Warschauer Ghetto, den Überlebensängsten im Versteck, der Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau Teofila (Tosia), dem Übergang in die Nachkriegszeit.
Sehr dicht sind viele dieser Szenen, welche sinnlich über Bilder und Worte verstehen lassen, was diesen jungen Mann umtrieb, mit welcher Leidenschaft er die Literatur zu seiner Welt machte, so intensiv, wie es vielleicht kein anderer Kritiker je getan hat. Unterdrückung in den jungen Jahren seines realen Lebens, das ihn, den 1920 geborenen polnischen Juden, der in Berlin zur Schule ging, dort eigentlich Theaterkritiker werden wollte, dann jedoch nach Polen deportiert wurde, ab 1940 dann die schrecklichen Verhältnisse des Warschauer Ghettos erleben musste, prägte.
Freiheit dann im souveränen Ausmessen des Reiches der Literatur: ein ungeheurer Bogen. Ein Bogen, der selbst unermesslich scheint. Aber Gutmann als Autor und Zahavi als Regisseur schaffen es, all diese Momente der stets existentiellen Unbdedingtheit situativ zu verdeutlichen und in die richtigen Bilder umzusetzen. Wobei nicht nur Matthias Schweighöfer als Marcel Reich-Ranicki und Katharina Schüttler als Ehefrau Tosia diese Lebensphasen überzeugend darstellen, sondern auch die weiteren Darsteller die menschlichen Konstellationen sehr glaubhaft machen – von Vater (Joachim Król) und Mutter (Maja Maranow) bis zum verhörenden Kommissar (Kriytsof Kawalerowicz).
So lässt der Film die entscheidenden Jahre einer außergewöhnlichen Lebens- und Liebesgeschichte anschaulich und lebendig werden. Und damit lässt er verstehen und nachempfinden, unter welchen Umständen eine Karriere ihren Anfang genommen hat, die tatsächlich einmalig ist in ihrer Ausprägung: aus dem Ghetto entkommend zum medial hochpräsenten Literatur-»Papst« zu werden, wie es als Bezeichnung üblich wurde: brillant in der Rhetorik, leidenschaftlich, streitbar, einflussreich in den Institutionen – so als vorwärtstreibender Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – und ebenso einflussreich durch seine zahlreichen Auftritte als Einsprecher, ein Vermittler, ein Groß-Kritiker, eine Instanz des öffentlichen Lebens.
Und er, der große MRR, was sagte er nach der Premiere in Köln (intern soll er nach der ersten Vorführungdas Ergebnis als »fabelhaft« beurteilt haben) ganz schlicht: »Ich kann nichts sagen. Ich kann nur danken, danken allen, die hier mitgewirkt haben. Ich danke euch allen.« Ein großer Abend.
| PETRA KAMMANN
Titelangaben
Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben
Sendetermine ARTE:
Freitag, 10.4., 21 Uhr
Sonntag, 12.4., 16 Uhr
Sendetermin ARD:
Mittwoch, 15.4., 20:15 Uhr