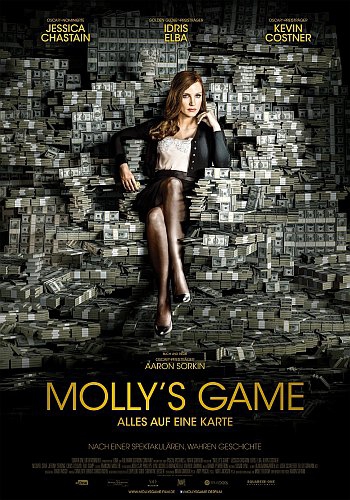Film | DVD: Animation in der Nazizeit
So dumm kann ein Satz gar nicht sein, dass er nicht immer wieder zitiert würde. Das gilt umso mehr, wenn er einem deutschen Dichter zugeschrieben wird, im folgenden Fall Johann Gottfried Seume: »Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.« Böse Menschen singen nicht weniger gern als gute. In Diktaturen haben Lieder Konjunktur. Von THOMAS ROTHSCHILD
 Es stimmt noch nicht einmal, dass diese Lieder schlecht sein müssen. So hätten wir’s ja gerne: dass totalitäre Regimes damit bestraft werden, dass sie keine echte Kunst hervorbringen können. Aber so einfach ist das leider nicht. Es gibt keine göttliche Gerechtigkeit. Kunst existierte lange bevor es Demokratien gab, und auch in der jüngeren Geschichte lassen sich Künstler und Werke nennen, die unter den Bedingungen einer Diktatur und manchmal in Übereinstimmung mit ihnen den Vergleich mit Künstlern und Werken aushalten, die unter demokratischen Bedingungen gearbeitet haben und entstanden sind.
Es stimmt noch nicht einmal, dass diese Lieder schlecht sein müssen. So hätten wir’s ja gerne: dass totalitäre Regimes damit bestraft werden, dass sie keine echte Kunst hervorbringen können. Aber so einfach ist das leider nicht. Es gibt keine göttliche Gerechtigkeit. Kunst existierte lange bevor es Demokratien gab, und auch in der jüngeren Geschichte lassen sich Künstler und Werke nennen, die unter den Bedingungen einer Diktatur und manchmal in Übereinstimmung mit ihnen den Vergleich mit Künstlern und Werken aushalten, die unter demokratischen Bedingungen gearbeitet haben und entstanden sind.
Wohl aber kann man behaupten, dass Diktaturen bestrebt sind, die Kunst der Propaganda unterzuordnen. Nur wenn man Propaganda per se als unkünstlerisch definiert, kann man ausschließen, dass echte Kunst entsteht, wo sie sich kunstfremden Zwecken unterordnet. Gilt das dann auch für Propaganda, die für die Kirche und ihre Institutionen wirbt? Wären Bachs Kantaten dann keine Kunst? Und Sergej Eisensteins Alexander Newski, ohne Zweifel ein Propagandafilm – wäre er kein Kunstwerk?
Auch der Trickfilm wurde in der Nazizeit in den Dienst der herrschenden Ideologie gestellt. Schon Kinder sollten mit antisemitischen Klischees gefüttert werden. Das mag einem widerlich sein. Ästhetisch aber unterscheiden sich solche Produkte nicht grundsätzlich vom Trickfilm der Vor- und Nachkriegszeit. Wenn sich die Tiere zusammentun, um den bösen Fuchs zu bekämpfen, dann mag man das als Kriegspropaganda verstehen. Aber auch die in anderen Ländern, zu anderen Zeiten entstandenen Zeichentrickfilme, insbesondere jene von Walt Disney, beruhen häufig auf dem Schema, dass die »Guten« gegen die »Bösen« mit allen, meist komischen Mitteln »Krieg führen« und sie schließlich besiegen. Man macht es sich zu leicht, wenn man das Allgemeine als spezifisch deklariert, weil es ins Bild passt. Der Nationalsozialismus, seine menschenverachtenden Implikationen werden nicht dadurch exkulpiert, dass man untersucht, welche Modelle er kopiert und übernommen hat. Das gilt übrigens für Architektur, Literatur, Musik ebenso wie für den Film. Wie anders wollte man es erklären, dass ehemals antinazistische Künstler mühelos zu den Nazis wechseln konnten, ohne ihre Ästhetik zu verändern? Die Kunst, heißt es, sei eine Hure. Das ist jedenfalls plausibler als der Satz von den bösen Menschen, die keine Lieder hätten.
Auch die Nationalsozialisten mussten aber, jenseits der Propaganda und vom Propagandaminister Goebbels einkalkuliert, Unterhaltung bereitstellen, um die Soldaten an der Front und die Bevölkerung im Hinterland angesichts zunehmender Entbehrungen bei Laune zu halten. So machte Hans Held 1944, ein Jahr nach dem populären Münchhausen-Film mit Hans Albers, einen kurzen Zeichentrickfilm zum gleichen Stoff, der durchaus seinen Charme bewahrt hat. Nichts deutet darauf hin, dass er nicht ein paar Jahre später, in der Bundesrepublik oder in der DDR, entstanden ist. Übrigens hat Hans Held, nach Schwierigkeiten im Jahr 1945, seine Karriere in der Bundesrepublik fortgesetzt.
Zu den Widersprüchen, die sich der Rücksichtnahme auf das Unterhaltungsbedürfnis der Menschen verdankten, gehört, dass der Jazz zu einer Zeit, als er offiziell verboten war, dosiert, so unter anderem im Trickfilm, geduldet wurde. Sogar der Experimentalfilm der Weimarer Republik, nach dem Verständnis der Nazis »Entartete Kunst«, konnte überleben. Die Dokumentation über Animation in der Nazizeit innerhalb der DVD-Reihe »Geschichte des deutschen Animationsfilms« zeigt ein eindrucksvolles Beispiel von Herbert Seggelke: Strich-Punkt-Ballett.
Mit der biederen Putzigkeit des Puppenfilms Die sieben Raben hat das nichts gemeinsam. Doch auch hier gilt: so sehr das autoritäre, rückwärtsgewandte Weltbild der Volksmärchen, wie sie durch die Romantik überliefert wurden, der nationalsozialistischen Denkweise entsprach – weder die Bundesrepublik, noch die DDR haben darauf verzichtet, diese Tradition fortzusetzen, und auch in anderen Ländern findet man vergleichbare Tendenzen. Es gab nicht nur personelle Kontinuitäten – die Biographie von Friedrich Luft, dessen 100. Geburtstag dieser Tage überall gefeiert wurde, ist dafür ein Beispiel –, auch die ästhetischen und pädagogischen Vorstellungen der kirchlichen Filmdienste oder der Kulturpolitiker waren nach 1945 jenen der Nazipropagandisten ähnlicher, als man gemeinhin annimmt
Kein Zeichentrickfilm, sondern ein Spielfilm mit Trickaufnahmen ist Weltraumschiff I startet. Fritz Lang hat deutliche Spuren hinterlassen, allerdings in fast dilettantischer Verformung. Zugleich ist dieser schon 1937, also vor Beginn des Weltkriegs gedrehte Film ein gutes Beispiel für Propaganda, die sich in den Mantel der Unterhaltung hüllt. Denn was da als Science Fiction daherkommt, berührt sich unmittelbar mit den damaligen Anstrengungen in der Raketenentwicklung. Inzwischen ist die Utopie des Films längst Geschichte.
Titelangaben
Animation in der Nazizeit
Reihe: Geschichte des deutschen Animationsfilms
Regie: Ulrich Wegenast
absolut MEDIEN
154 Minuten, 9,90 Euro