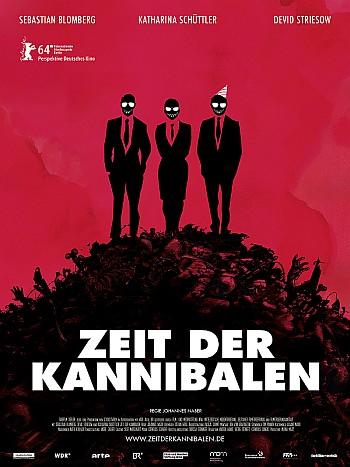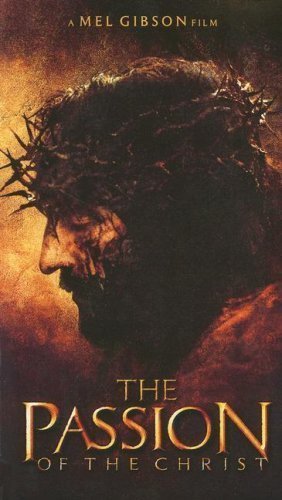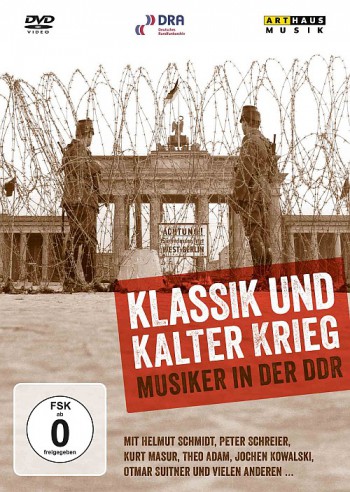Film | DVD: Sounds and Silence. Unterwegs mit Manfred Eicher
Eine persönliche Vorbemerkung sei gestattet: Es muss so um die zwanzig Jahre her sein. Da hatte ich die Idee, einen Film über Manfred Eicher, den singulären Musikproduzenten zu machen, ihn bei seiner Arbeit zu beobachten. Ich war zuvor schon ein paar Mal bei ihm im Aufnahmestudio gewesen, kannte ihn recht gut, gehörte – keineswegs originell – zu den Bewunderern seiner Fähigkeiten. Ich hatte allerdings Bedenken, dass eine Kamera bei Plattenaufnahmen stören, die unglaubliche geduldige Konzentration der Musiker und Eichers selbst beeinträchtigen könnte. Aber Manfred Eicher gab mir grundsätzlich seine Zustimmung zu dem Plan. Von THOMAS ROTHSCHILD
 Wer mit Fernsehredakteuren zu tun hatte, weiß, wie schwer es ist, sie von einem Projekt zu überzeugen, das einem selbst so einleuchtend erscheint. Für einen Anfänger, der noch keinen Film gedreht hat, ist es fast unmöglich. Jetzt gibt es den Film, den ich machen wollte. Leider ist er nicht von mir. Und die Ehrlichkeit gebietet mir das Eingeständnis, dass er mir wohl so gut nicht gelungen wäre. Denn Peter Guyer und Norbert Wiedmer, die Filmemacher, sind außergewöhnliche Kameramänner. Darauf kommt es an.
Wer mit Fernsehredakteuren zu tun hatte, weiß, wie schwer es ist, sie von einem Projekt zu überzeugen, das einem selbst so einleuchtend erscheint. Für einen Anfänger, der noch keinen Film gedreht hat, ist es fast unmöglich. Jetzt gibt es den Film, den ich machen wollte. Leider ist er nicht von mir. Und die Ehrlichkeit gebietet mir das Eingeständnis, dass er mir wohl so gut nicht gelungen wäre. Denn Peter Guyer und Norbert Wiedmer, die Filmemacher, sind außergewöhnliche Kameramänner. Darauf kommt es an.
Sounds and Silence ist, jenseits seines Informationswerts, ein hinreißender Film geworden, mit Bildern, die dem Gegenstand angemessen sind: ein Musikfilm der besten Sorte, ein Film über die Magie der Musik, von der Gianluigi Trovesi spricht und die man auch spürt, wenn Dino Saluzzi der großartigen Cellistin Anja Lechner, Schwester der Schauspielerin Geno Lechner, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht, die Wurzeln zeigt, von denen er herstammt, eine Tangokapelle in einem Vorort der argentinischen Stadt Salta. Aber eben auch ein Porträt Manfred Eichers. Er ist ein Arbeitstier. Er kommt mit vier Stunden Schlaf aus, fliegt nach New York, geht ins Studio, als hätte er von Jetlag nie etwas gewusst, und nimmt mit der erforderlichen Konzentration in drei Tagen eine CD auf.
Zu seinen unersetzlichen Eigenschaften zählen ein untrügliches Gehör, ein ausgeprägtes Gespür für Räume und ihre Akustik und nicht zuletzt ein ungewöhnlicher, wenngleich subjektiver musikalischer Geschmack. Im Film sieht man, wie er sich mit wenigen Worten mit den Musikern und den Technikern verständigen kann, wie groß deren Vertrauen zu ihrem Produzenten ist. Sie scheinen niemals das Gefühl zu haben, dass ihnen etwas aufgeschwätzt wird, was sie nicht wollen, obwohl Eicher sehr genau weiß, was er für richtig hält. Selten wird so deutlich, dass die gemeinsame Arbeit in den Künsten nur dann funktioniert, wenn die Bereitschaft, aufeinander einzugehen, und die Entschiedenheit, mit der man seinen Überzeugungen treu bleibt, sich die Waage halten.
Manfred Eicher ist ein Perfektionist. Er glaubt im Zeitalter des allgegenwärtigen Dilettantismus, einer irrtümlich für demokratisch gehaltenen Beteiligung – wenn nicht Machtergreifung – von Amateuren, noch an hohe Professionalität, die er sich selbst und seinen Musikern, auch den Tontechnikern abverlangt.
Der Film zeigt, abwechselnd, wie in einem Rondo, Arvo Pärt, Nik Bärtsch, Eleni Karaindrou, Anouar Brahem, Dino Saluzzi, Gianluigi Trovesi, Marilyn Mazur, Jan Garbarek, Kim Kashkashian, alles hervorragende Künstler aus der ECM-Familie. Der Film rehabilitiert den in Verruf geratenen Begriff der Schönheit: Schönheit der Musik, Schönheit der Gesichter, Schönheit der Landschaften, Schönheit der Farben, Schönheit der Bewegungen.
Eins allerdings kann der Film nicht vermitteln: das Zeitgefühl, das sich bei der Produktion einer Schallplatte einstellt, bei der Aufnahme, der Abmischung, der Postproduction. Und ein frustrierendes Element teilt Sounds an Silence mit den meisten Musikfilmen: Die Musik bricht ab, wenn man sie gerne weiter hören würde. Das kann man nachholen, mit einer CD, die zu dem Film erschienen ist.