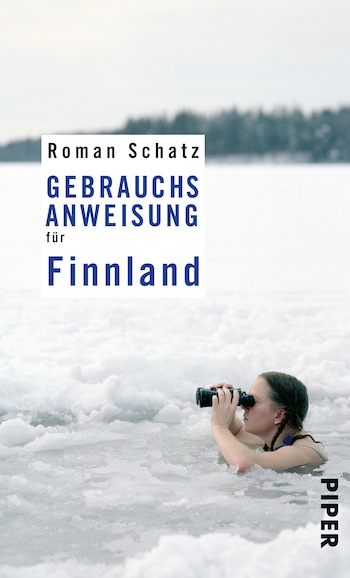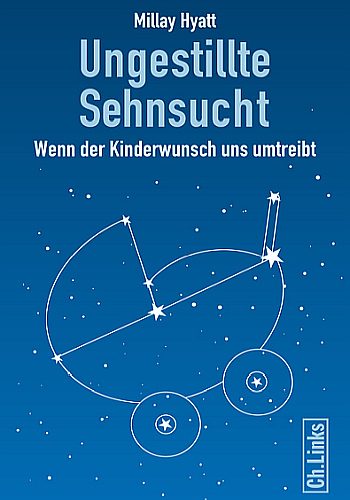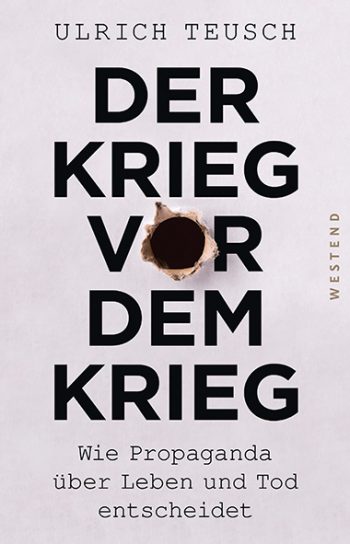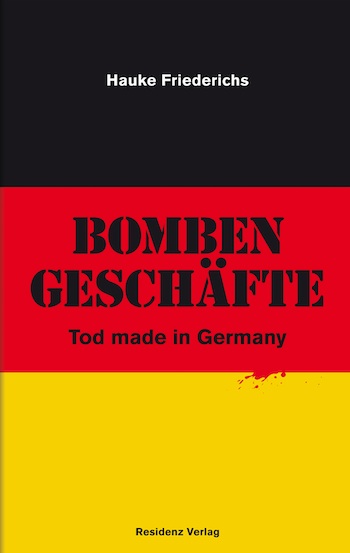Sachbuch | Candeias / Rilling / Rötter / Thimmel: Globale Ökonomie des Autos
Der Sammelband Globale Ökonomie des Autos. Mobilität, Arbeit, Konversion bietet einen Blick auf die weltweite Automobilwirtschaft aus überwiegend linker Perspektive – und offenbart die Pluralität der Argumentationslinien. Die Beiträge schwanken zwischen nüchterner Bestandsaufnahme und agitatorischer Rhetorik. JÖRG FUCHS lernte nicht nur die Strukturen der Automobilwirtschaft kennen, sondern vor allem auch die Befindlichkeiten ihrer Betrachter und Kritiker.
 In Anlehnung an die internationale Konferenz »Auto.Mobil.Krise.«, die 2010 in Stuttgart von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Partei DIE LINKE sowie ATTAC und TIE/Netzwerk Auto durchgeführt wurde, erschien nun ein Sammelband mit Aufsätzen Kommentaren, Grußworten und Streitgesprächen, der die Positionen der teilnehmenden Akteure aufzeigt.
In Anlehnung an die internationale Konferenz »Auto.Mobil.Krise.«, die 2010 in Stuttgart von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Partei DIE LINKE sowie ATTAC und TIE/Netzwerk Auto durchgeführt wurde, erschien nun ein Sammelband mit Aufsätzen Kommentaren, Grußworten und Streitgesprächen, der die Positionen der teilnehmenden Akteure aufzeigt.
Schwergewichtig seziert der Wirtschaftsjournalist Stephan Kaufmann einleitend auf über 100 Seiten die ökonomischen Aspekte der globalen Automobilwirtschaft. Dabei untersucht er deskriptiv den automobilen Wirtschaftsstandort Deutschland und beschreibt die großen wirtschaftlichen Krisenphasen der Kraftfahrzeugindustrie. Anschließend benennt er die Zukunftsmärkte, die sich geographisch (Indien, Brasilien, China) und technologisch (E-Mobilität, Alternativantriebe) verorten lassen. Sein Fazit bleibt dabei ernüchternd: Überkapazitäten, Konkurrenzsituation (und daraus resultierender Preisdruck) sowie politische Einflussnahme sorgen seiner Einschätzung nach für zukünftige weitere Krisen der Automobilindustrie und für massive Schädigung der Umwelt.
Etwas ernüchtert bleibt an dieser Stelle auch der Leser zurück: Wer die zahlreichen Tabellen und Hunderte von Zahlenangaben und Prozentwerten verdaut hat, ist davon überzeugt, dass der Autor gründlich recherchiert hat und sich in der Thematik exzellent auskennt. Aber gerade die trockene und teils abstrakte Darstellung der Materie mag verhindern, dass sich allzu viele Leser durch die endlos anmutenden Zahlenkolonnen bis zum Fazit durchkämpfen. Und das ist schade – eben weil sich Kaufmanns Darstellungen, weltanschaulich recht ausgewogen präsentieren. An dieser Stelle wäre weniger mehr gewesen: Viele der statistischen Angaben hätten zugunsten einer strafferen und lebendigeren Darstellung in den Anmerkungsapparat verschoben werden können.
Autokrieg, Blutzoll, terroristische Gewalt
Wie anders präsentiert sich der Abschnitt Ökologie und Macht des Autos: Hier wird aus vollem Herzen polemisiert und agitiert – bis den Lesern die revolutionären Parolen vor den Augen flirren. Heiner Monheim, Professor für Geographie und Raumentwicklung, bilanziert in einer kurzen Tour de Force die Schadensbilanz von 125 Jahren der Automobilherrschaft. Seine Geschichtsbetrachtung ist zwar ob ihrer Schärfe unterhaltsam, endet aber leider allzu schnell (ausführlicher zur kulturhistorischen Entwicklung des Automobils schreibt Johann-Günther König).
Wo Monheim endet, zieht der Publizist Winfried Wolf die Schraube noch weiter an: Bei ihm tobt der »Autokrieg«, der »Blutzoll« einfordert. Auf dem Altar des Verkehrs werden Menschen geopfert; der Kapitalismus entfaltet für Wolf eine ungezügelte Kraft, ja eine »terroristische Gewalt«. Auflehnung dagegen findet kaum statt, die ausgebeutete Mittelschicht wird per Traum vom Auto, Einfamilienhaus und Flachbildschirm ruhiggestellt. Das Opium, das sich das Volk selbst verordnet, lenkt davon ab, dass Politik, Wirtschaft und Medien sich verbünden, um gemeinschaftlich fragwürdige Projekte, wie Stuttgart 21, zu verwirklichen. Ob Auto, Flugzeug oder besagtes Bauprojekt – Feindbilder finden sich quer durch die mobile Gesellschaft. Dennoch schlägt Wolf gegen Ende seiner Betrachtungen vermeintlich versöhnlichere Töne an, wenn er der vielen Menschen in Betrieben und Büros zumindest eine »Ahnung« um die Klima- und Umweltproblematik attestiert und, seiner Einschätzung zufolge, eine grundsätzliche Transformation von diesen auch nicht von vorneherein abgelehnt werde.
Die dermaßen Gescholtenen melden sich in Gestalt von Valter Sanchez, dem brasilianischen Gewerkschaftsmitglied und Daimler-Aufsichtsrat, zu Wort. In einem kurzen Grußwort lobt er die krisenfeste und boomende Automobilindustrie in Brasilien. Die Gewerkschaft habe dort als wichtiger Akteur im Kampf um gerechte Lohnabschlüsse dafür gesorgt, dass das Lohnniveau in den letzten sechs Jahren inflationsbereinigt um 27 Prozent gestiegen sei. Damit desavouiert Sanchez den gewerkschaftskritischen Furor anderer Autoren unterschwellig.
Der Traum von der Mosaiklinken
An Stellen wie diesen wird deutlich, wie gespalten die linke Bewegung im Bezug auf die Automobilindustrie ist: Die Art und Weise, wie Wolf die Gewerkschaften für Ihre Kollaboration mit der Industrie kritisiert, verdeutlicht, dass man vom Traum einer »Mosaiklinken« also einer pluralistischen aber dennoch einheitlich zielgerichteten linken Bewegung, bestehend aus Akteuren, wie Gewerkschaften, Fachwissenschaften und NGOs, weit entfernt ist. Die Problematik der Zersplitterung und der fehlenden internationalen Zusammenarbeit linker Bündnisse im Bereich der Automobilherstellung liegt laut der Politologin Antje Böcker in der stark segmentierten Struktur dieses Industriesektors: Bislang überwiegend national ausgerichtete Beschäftigungsperspektiven führen zu einem internationalen Unterbietungswettbewerb bei Löhnen, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen. Transnationale Gewerkschafts- und Aktionskooperationen gibt es zwar, wie in Europa in Ansätzen erkennbar, diese reichen aber selten über Clusterbildungen hinaus. Die Separierung der Automobilindustrie in zahlreiche Branchensegmente erschwert die Etablierung tragfähiger und langfristiger Bündnisse aufseiten von Beschäftigten und Gewerkschaften.
So vielfältig, wie die Ökonomie rund um das Automobil auftritt, so unterschiedlich stellen sich die Perspektiven in diesem Buch dar: Linke Idealvorstellungen wechseln sich mit nüchternen Bestandsaufnahmen ab. Wunschbilder treffen auf die kalten Notwendigkeiten bestehender Herausforderungen. Konkrete Lösungsvorschläge allerdings sind rar: Der IG-Metall-Vorsitzende Hans-Jürgen Urban stellt mehrere Thesen auf, die eine Richtung aufweisen können: Die Zukunft der Automobilindustrie liege ihm zufolge in einem nachhaltigen, integrierten Mobilitätsmodell mit einer gleichzeitigen ökologisch-sozialen Transformation dieses Industriebereichs. Einer linken Illusion vom Wegfall von Profiterzielung und Wertschöpfungssteigerung erteilt er dabei eine klare Absage. Urban ist bewusst, dass solche universellen Ziele zwar wünschenswert sind, konkrete Umsetzungen dieser jedoch sind Mangelware: »All das zu formulieren bedeutet nicht, das Problem gelöst zu haben«.
Lösungen?
Das Buch zeigt in der Zwiespältigkeit der Perspektiven auf einen geschlossenen Themenkomplex die Schwierigkeiten, eine Lösungsstrategie zu finden, die die zahlreichen, oft divergierenden Interessen, vereinen könnte. Ansätze reichen von Ideen pragmatischer Vernetzung, über die Etablierung alternativer Mobilitätskonzepte bis hin zu eher illusorischen Vorschlägen, wie z.B. die Unterstellung von Automobilkonzernen unter die Konversionsvorgaben regionaler »Räte« aus Beschäftigten, Gewerkschaften und Umweltverbänden, mit dem Ziel, die Firmen durch Konversion zu ökologisch orientierten Dienstleistern umzugestalten.
Die Autoren werfen viele Fragen auf: Welche Formen der Beweglichkeit können und wollen wir uns leisten? Welche Einschränkungen sind wir bereit, dafür in Kauf zu nehmen? Müssen sich unsere Mobilitätsformen und Raumbeziehungen wandeln – und wenn ja, welche Wege können dabei beschritten werden? Es bleibt uns Lesern überlassen, aus dem Konvolut an Meinungen, Fakten, Träumen und Visionen ein Zukunftsbild zu entwerfen, das über die rein ökonomische Ebene des Autos hinausgeht. Lösungen sind nicht in Sicht, schon gar keine einfachen. Die Diskussionen, die in diesem Buch geführt werden, geben einen Vorgeschmack auf die Auseinandersetzungen, die dem heutigen Mobilitätsverhalten bald bevorstehen.
Titelangaben
Mario Candeias, Rainer Rilling, Bernd Rötter, Stefan Thimmel (Hg.): Globale Ökonomie des Autos. Mobilität, Arbeit, Konversion
Hamburg: VSA 2011
278 Seiten, 19,80 Euro