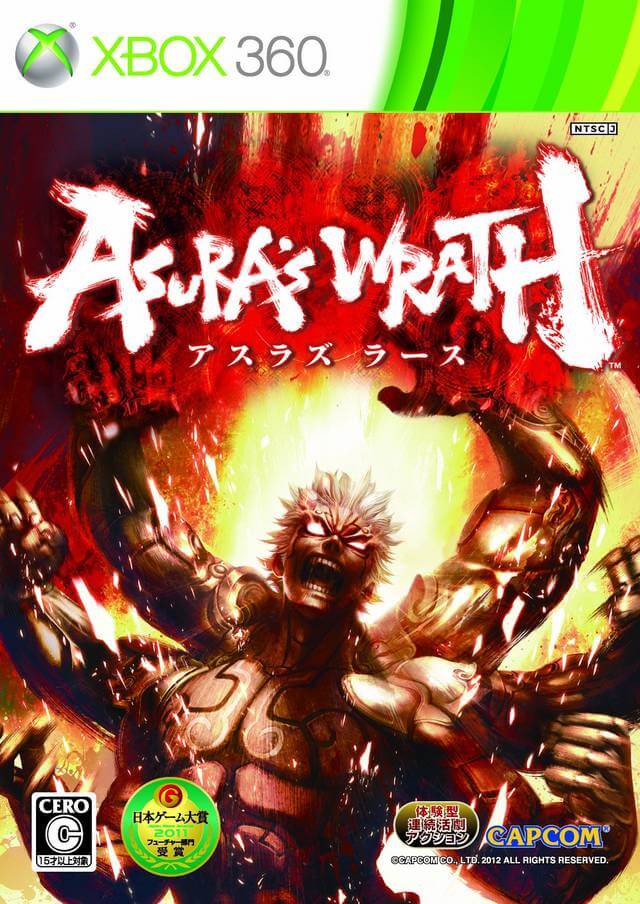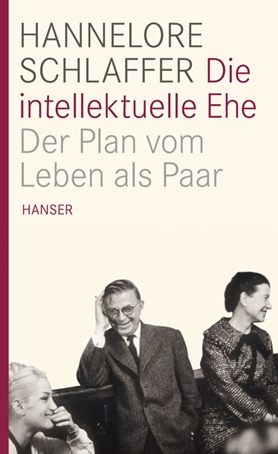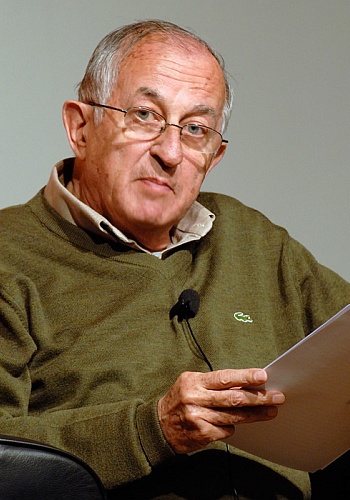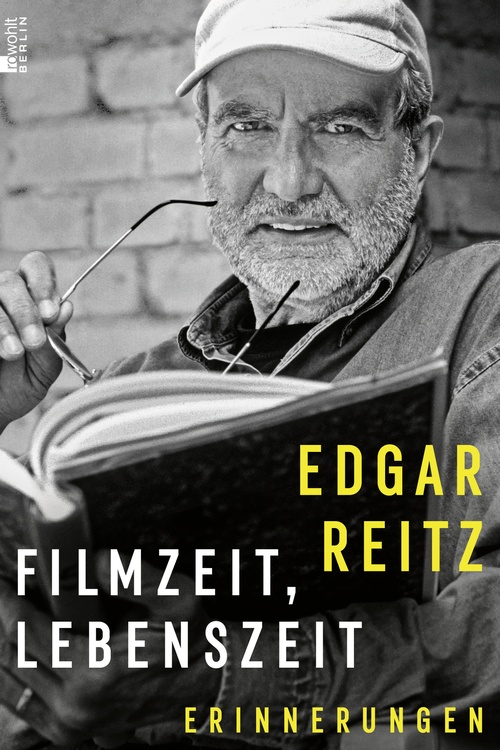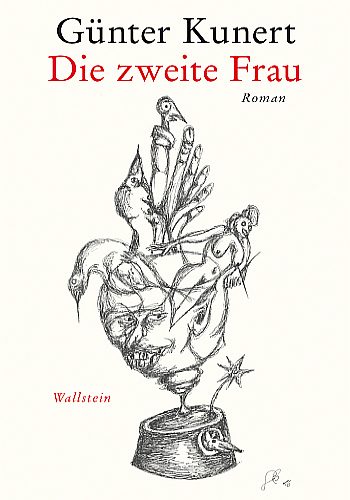Menschen | Dieter Bub: Begegnungen mit Joachim Gauck
Begegnungen mit Joachim Gauck – ein Taschenbuch-Schnellschuss von Dieter Bub. Von HANS-KLAUS JUNGHEINRICH
 Der Visionär hat seine Visionen. Der Pragmatiker tummelt sich verständig im Erreichbaren. Das seltsame Bild eines mit dem Pfingstpathos des berufenen Zungenredners als wundersames Gottesgeschenk Lobpreisenden gibt der Freiheitsapostel Joachim Gauck ab, neuestens deutscher Bundespräsident.
Der Visionär hat seine Visionen. Der Pragmatiker tummelt sich verständig im Erreichbaren. Das seltsame Bild eines mit dem Pfingstpathos des berufenen Zungenredners als wundersames Gottesgeschenk Lobpreisenden gibt der Freiheitsapostel Joachim Gauck ab, neuestens deutscher Bundespräsident.
Der unsäglichen Korrumpiertheit seines Amtsvorgängers Christian Wulff hat Gauck es zu verdanken, dass er nun ganz glatt in die ihm vor zwei Jahren entgangene Präsidentschaft hineinrutschte. Breiteste Zustimmung bei der wählenden Versammlung. Doch jeder weiß, dass auch diesmal wieder parteipolitisches Kalkül maßgebend war. Und nach Wulffs viel zu langsamem Abgang hatte offenbar alles »presto, presto« zu gehen. Die CDU hatte bessere, sogar linkere Kandidaten erwogen, darunter Klaus Töpfer; sicher der Allerbeste. Aber auch Petra Roth, die scheidende Frankfurter Oberbürgermeisterin, eine echte Integrationsfigur, wäre akzeptabel gewesen (reden wir nicht von Huber oder Käßmann; Deutschland ist schließlich noch kein Appendix der Evangelischen Kirche). Als die SPD damals Gauck als Bundespräsidenten vorschlug, war das angesichts der Mehrheitsverhältnisse gewissermaßen unverbindlich, wie nur zum Spaß gesagt. Nun, da die FDP aus Profilierungsgründen Gauck aus dem Hut zauberte, konnten SPD und Grüne ihren ehemaligen Wunschmann schlecht im Stich lassen. »Aber ich würde gerne wissen, was die Grünen an ihm grün finden und die Sozialdemokraten an ihm sozialdemokratisch« (Friedrich Schorlemmer). Es vermag den politisch Engagierten an dieser Präsidentschaft schon verdrießlich zu stimmen: »So ist Joachim Gauck in Wahrheit ein Mann von Röslers und Brüderles Gnaden, der Mann einer 2-bis 3-Prozent-Partei – ein liberaler Konservativer« (Dieter Bub).
Ein unkritisches Verhältnis zu Joachim Gauck kann man dem Autor dieser Begegnungen wirklich nicht nachsagen. Geradezu akribisch wägt er die von ihm als solche beobachteten Schwächen Gaucks von dessen Stärken ab, verweist ausdrücklich auf einen »schillernden« Charakter, und manchmal gewinnt man das Gefühl, dass er positive Züge nicht ganz ohne Zähneknirschen hervorhebt. Auch Gaucks Medienerfahrenheit, Routine, Zuverlässigkeit, Disziplin und sein Sinn für »Timing«, erhalten damit (vielleicht ungewollt) einen leichten Hautgout. Nein, der ehemalige Rostocker Pastor wird keineswegs als netter Kerl serviert und erst recht nicht als überlebensgroßer Held. Bub macht die Fixierung Joachim Gaucks auf einen starken Vater namhaft, woraus sich für ihn die autoritäre Haltung des Sohnes ableitet, der außer Hause den liebevollen und empathischen Gemeindeseelsorger abgab, als Familienpatriarch aber ziemlich herumholzte und sich mit seinen »republikflüchtigen« Kindern auf lange Zeit überwarf. Dass Gaucks Psychogramm dennoch ein wenig vage und lückenhaft bleibt (darin nicht viel anders als Gaucks Autobiographie Winter im Sommer – Frühling im Herbst) liegt einmal an – man muss es wohl so benennen – schriftstellerischen Mängeln des als TV-Journalist vor allem in Sachen DDR-Aufarbeitung verdienstvollen Autors, zum anderen in dem Umstand, dass anscheinend ein verlegerischer Schnellschuss geboten war – die Lektüre wird denn auch beeinträchtigt durch ein schwer hinnehmbares Übermaß an editorischer Schlamperei.
Wertvoll für den an Einsichten über die »demokratische« Übergangszeit der DDR Interessierten sind indes dankenswert klare und ausführliche Informationen über die Oppositions- und Bürgerrechtsbewegungen in Ostdeutschland, mit denen Gauck so oder so in Verbindung stand. Als Leiter der nach ihm benannten Behörde zur Aufarbeitung der Stasi-Aktenberge nahm er im gesamtdeutschen Rahmen eine politische Schlüsselstellung ein. Ob die Moderatheit, mit der er unkontrollierter »Abrechnung« mit den Geheimdienstgräueln wehrte und (wie vor allem die PDS in staunenswert plötzlicher »legalistischer« Neuorientierung) auf eine streng rechtlich reglementierte Auswertung des Aktenmaterials drang, optimaler Weisheit entsprang oder mehr Reflex eines späten DDR-Patriotismus war, ist schwer auszumachen. Opfer der Diktatur wie etwa der (in Stasi-Gefängnissen womöglich tödlicher Verstrahlung ausgesetzte) Schriftsteller Jürgen Fuchs fühlten sich von der Taktik Gaucks jedenfalls frustriert. Immer wieder auftauchende Verdächtigungen und Verleumdungen, Gauck (der sich als Pragmatiker erst im Spätherbst 1989 dezidiert oppositionell hervorwagte), sei im Grunde Opportunist gewesen und habe sich nach der Wende das Ehrenzeichen des »Bürgerrechtlers« unverdient anheften lassen (und sich selbst angeheftet), wimmelt Bub mit nobler Geste ab.
Auch Bub prognostiziert, dass Gauck wohl kein »großer« deutscher Bundespräsident werden wird. Die politische Thematik, die ihn bewegt, ist, unhöflich gesagt, die eines Einzellers. Sein schmales Büchlein Freiheit liest sich wie ein solider Schulaufsatz der Oberstufe. Hat Gauck wirklich sonst nichts auf der Pfanne? Wie ein Mantra rufen ihm inzwischen alle Auguren zu, er solle nun endlich auch einmal die soziale Karte ziehen. Vielleicht tut er’s ja demnächst. Aber auch dann wird er es sicher nicht allen recht machen. Und es wird heißen: Schuster, bleib’ bei deinen Leisten. Oder, unbildlich gesagt: Gauck, bleib’ doch lieber bei deiner Behörde.
| HANS-KLAUS JUNGHEINRICH
Titelangaben
Dieter Bub: Begegnungen mit Joachim Gauck. Der Mensch. Sein Leben. Seine Überzeugungen
Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2012
160 Seiten, 9,95 Euro