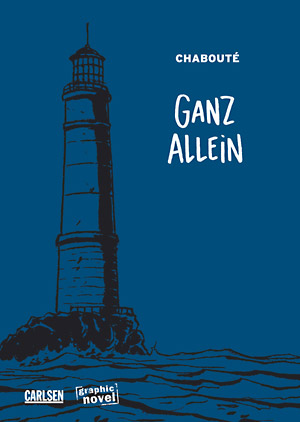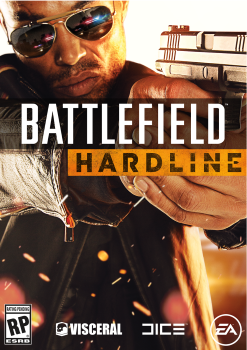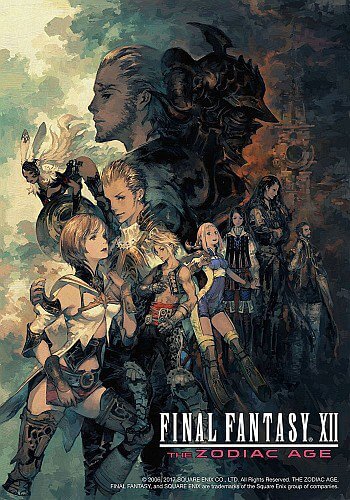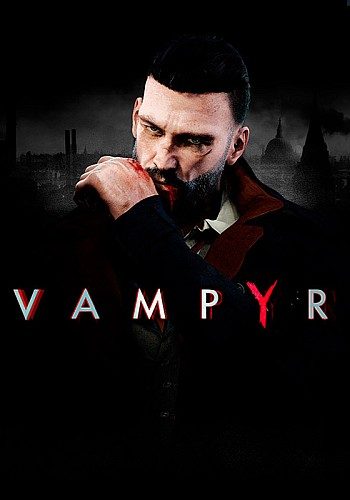Digitales | Games: Dear Esther
Wann ist ein Spiel ein Spiel? In seinem ersten Text für das Ressort DIGITALE SPIELE beschäftigt sich DANIEL APPEL mit ›Dear Esther‹ – einem Titel, der sich augenscheinlich einer Kategorisierung verweigert. Was es tatsächlich mit dem Abenteuer auf sich hat, ist im Folgenden zu lesen.
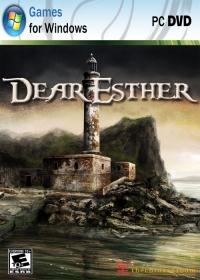 Es ist schwer zu erklären, was genau den Reiz von Inseln ausmacht. Vielleicht ihre absolute Unabhängigkeit von sonstigen Landmassen. Vielleicht auch ihre einsame geografische Verortung inmitten des Ozeans. Oder ihr mikrokosmischer Charakter, der sie wie eigene kleine Welten erscheinen lässt. Auf alle Fälle bieten sie sich ganz offensichtlich als Symbole der Sehnsucht an. Und so erschöpft sich diese Symbolik bei Weitem nicht in den Romanen französischer Gegenwartsautoren, sondern fand in jüngerer Vergangenheit auch immer wieder Eingang in TV-Serien (Lost) und Spielfilme (Shutter Island).
Es ist schwer zu erklären, was genau den Reiz von Inseln ausmacht. Vielleicht ihre absolute Unabhängigkeit von sonstigen Landmassen. Vielleicht auch ihre einsame geografische Verortung inmitten des Ozeans. Oder ihr mikrokosmischer Charakter, der sie wie eigene kleine Welten erscheinen lässt. Auf alle Fälle bieten sie sich ganz offensichtlich als Symbole der Sehnsucht an. Und so erschöpft sich diese Symbolik bei Weitem nicht in den Romanen französischer Gegenwartsautoren, sondern fand in jüngerer Vergangenheit auch immer wieder Eingang in TV-Serien (Lost) und Spielfilme (Shutter Island).
Nun versucht das Indie-Entwicklungsstudio The Chinese Room diese symbolträchtigen Orte in ihrer überarbeiteten Version der stimmungsvollen ›Half-Life 2‹-Mod ›Dear Esther‹ für das Computerspiel nutzbar zu machen. Dass es mich dabei auf ein Eiland der rauen Inselgruppe der Hebriden vor Schottland verschlägt, ist dann auch der einzige Hinweis, den ›Dear Esther‹ vergleichsweise offensichtlich gleich zu Beginn preisgibt. Der Rest der Geschichte(n) entspinnt sich zwischen den gesprochenen Gedanken- und Brieffragmenten eines Unbekannten, meinen Beobachtungen und meiner Fantasie – die zu Höchstform auflaufen darf, um all die narrativen Leerstellen zu füllen, die ›Dear Esther‹ zuhauf bereithält.
Spiel? Grafikdemo? Digital Novel?
›Dear Esther‹ stellt mich bei der Bezeichnung dessen, was es eigentlich ist, in etwa vor dieselben Schwierigkeiten wie seinerzeit ›The Path‹. Es als Computerspiel zu bezeichnen ist dabei ein eher gewagtes Unterfangen, da nahezu alle konventionellen spielerischen Elemente schlichtweg fehlen. Nachdem ich mich unverhofft und ohne einleitende Erklärung an der felsigen Küste einer kleinen Insel wiederfinde, höre ich, wie mir eine unbekannte Stimme den Anfang eines Briefes vorliest, der mit den Worten »Dear Esther…« beginnt. Und in dem eben dieser Jemand davon berichtet, dass seit diesem Jahr aus unerklärlichen Gründen keine Möwen mehr auf der Insel landen. Die verdammten Möwen würden sie sogar regelrecht meiden. Aus den Aufzeichnungen eines Mannes namens Donnelly habe er erfahren, dass selbst die Schäfer diesen Ort vor dreihundert Jahren verlassen haben, weil ihre Herden krank wurden. Nach diesem kurzen Monolog bleibe ich ratlos zurück: Wer ist es, der da spricht? Wer ist dieser Donnelly? Ist dieser Brief an mich gerichtet, bin ich möglicherweise der Autor dieses Briefs und gehe ihn in Gedanken durch oder habe ich nur aus irgendeinem unerklärlichen Grund Anteil an seiner Verlesung? Warum bin ich hier? Wie bin ich hierhergekommen? Wer bin ich überhaupt? Wann bin ich? Und was soll ich tun?
Zu all diesen anfänglichen Fragen nimmt ›Dear Esther‹ zunächst überhaupt keine Stellung. Im Gegenteil: Stoisch wirft es mir im weiteren Verlauf der etwa neunzigminütigen Reise über die Insel immer mehr Fragen vor die Füße, ohne sich um deren Beantwortung zu kümmern. Eine seltsam irritierende Atmosphäre wird daher neben einer Taschenlampe schnell zu meinem einzigen Reisebegleiter. Hinzu kommt, dass die Handlungsmöglichkeiten im gesamten Reiseverlauf über die schroffe Insel äußerst beschränkt sind: Dass ich mich mit der Maus in den imposanten 3D-Kulissen der Insel umschauen und mich mittels der WASD-Tasten bewegen kann, ist mitunter die einzige Konstante, die ›Dear Esther‹ mit anderen First-Person-Spielen, ja möglicherweise mit anderen Computerspielen überhaupt, verbindet.
Es gibt keine Gegner, keine NPCs, keine Aufgaben, keine Rätsel, keine Waffen, kein Inventar und kein HUD, weder irgendwie geartete Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung, noch die Fähigkeit zu springen, schneller zu rennen, sich auf Knopfdruck zu ducken oder sonst irgendetwas zu tun. Einzig die linke Maustaste zoomt den Bildausschnitt ein wenig näher heran, um mir den Blick auf kleine oder weit entfernte Details etwas zu erleichtern. Ansonsten gibt es nur mich, das immerwährende Geräusch der sanften Brandung, die gesprochenen Brief- bzw. Gedankensplitter und eine Insel auf der ich einem (recht linearen) Weg folgen und die Dinge um mich herum betrachten kann.
Wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus
Betrachten, Zuhören und zu Beginn quälend langsam wirkendes Umhergehen sind dann auch meine Hauptbeschäftigungen in ›Dear Esther‹. Nach meinem ungeklärten Geworfensein in diese schroffe schottische Inselwelt schaue ich mich zunächst vorsichtig um: Vor mir zeichnet sich ein gespenstisch wirkender, heruntergekommener Leuchtturm samt dazugehörigem halb-verfallenem Wärterhäuschen ab. Die dunklen, durch das diffuse Sonnenlicht surreal wirkenden Wolken ziehen schnell und geräuschlos am Himmel entlang. Meine Sicht auf die Dinge ist seltsam verzerrt – als hätte ich Kopfschmerzen. Lediglich der Wind, das leise Rauschen der Brandung und einige sanfte Pianoklänge begleiten meine ersten Schritte in Richtung Leuchtturm. Gemächlich gehe ich vorbei an zerbrochenen Fensterscheiben, inspiziere den windschiefen kleinen Holzschuppen voller Farbeimer und nähere mich dann der dunklen Türöffnung des Steinhäuschens.
Beim Betreten aktiviere ich automatisch meine Taschenlampe und blicke mich zögerlich in dem düsteren und kärglich wirkenden Gebäude um. Der Wind heult durch die kaputten Fenster und der Putz samt Wandfarbe hat seine besten Tage längst hinter sich. In dem Chaos der halb zerstörten Einrichtung und zwischen all dem herumfliegenden Unrat entdecke ich bei näherem Hinsehen eine ganze Reihe interessanter Dinge: Notenblätter sind überall auf dem verdreckten Boden verstreut, das verblichene Polaroid eines kleinen Mädchens vor einem Auto liegt auf dem Heizkörper und ein Buch über die Geschichte der Hebriden ruht neben einem schmutzigen Kartenspiel auf dem morschen, wackeligen Holztisch in der Mitte des Zimmers – immerhin ein erstes Indiz dafür, wo ich mich befinde. Im angrenzenden Leuchtturm stelle ich enttäuscht fest, dass die Treppen nach oben teilweise eingestürzt sind. Kurz bevor ich mich wieder auf den Weg nach draußen machen will, sticht mir eine mit fluoreszierender Farbe an die Wand geschmierte, chemische Strukturformel ins Auge. Ethanol?
Warum sollte jemand so etwas an die Wand eines solchen Ortes kritzeln? Vielleicht der frühere Eigentümer des kaum mehr leserlichen Elektriker-Zertifikats, das auf einem kleinen Berg von Abfall thront? Elektriker, Heizungen, fluoreszierende Farbe – zumindest kann ich mich also nicht in allzu ferner Vergangenheit befinden. Aber hatte die unbekannte Stimme nicht verlauten lassen, dass diese Insel vor dreihundert Jahren verlassen wurde? Neben den leisen Klängen der Musik, die meinen Weg nach draußen begleiten, irritiert etwas mein Ohr. War da nicht gerade noch etwas? Nur kurz. Ganz leise und undeutlich, wie aus einer anderen Welt. Endlos weit entfernte, flüsternde, verzerrte Stimmen und Geräusche? Möglicherweise auch bloße Einbildung. Es war ja schließlich auch nur ein winziger Augenblick. Der plötzliche Schrei einer Möwe reißt mich jäh aus meinen Gedanken, während ich automatisch im Türrahmen des Hauses in die Hocke gehe und der Vogel über meinen Kopf segelt. Ich könnte schwören, dass eben noch keine Möwe in dem Haus gewesen war. Hatte die unbekannte Stimme nicht auch davon gesprochen, dass die Möwen diese Insel seit einiger Zeit meiden?
Erst jetzt fällt mir auf, dass die Insel auch sonst absolut leblos ist und ich bislang weder Vögel, noch Fische oder gar richtige Tiere gesehen habe. Abgesehen von der sanft wogenden Brandung bewegt sich hier weit und breit nichts. Obwohl: Ganz in der Ferne, auf einer weit entfernten Klippe pulsiert ein schwaches rotes Licht. Das rote Signallicht eines Funkturms, dessen Silhouette sich schwach in den Dunstschwaden abzeichnet. Ist das derselbe Funkturm, der mir in meinen hämmernden Visionen vor Augen steht, sobald ich ins Meer tauche? Neben dem Bretterschuppen beginnt ein von Gestrüpp überwucherter Klippenpfad. Soll ich versuchen, diesen mysteriösen Funkturm zu erreichen? Da es keine erkennbaren Alternativen gibt, stapfe ich los. Einer Geschichte entgegen, die eigentlich viele Geschichten ist – und von denen jede irgendwie auch meine eigene ist …
Was wird hier gespielt?
Worin liegt der Reiz eines Spiels, das eigentlich gar keines ist und in dem eigentlich auch kaum etwas Nennenswertes passiert? Im Gameplay, wenn man das bloße Abschreiten mehr oder minder linearer Pfade mit diesem Begriff adeln möchte, wohl kaum. Und auch die aufwendig gestalteten Kulissen, die mit ihrer stimmungsvollen Beleuchtung und den teils zauberhaften Landschaftsansichten durchaus zur dichten Atmosphäre beitragen, erheben ›Dear Esther‹ noch nicht über jede x-beliebige Grafikdemo. Selbst wenn ich als geneigter Hobbyfotograf die Screenshot-Taste stärker malträtiert habe als den Auslöser meiner Kamera an guten Tagen, so ist auch das nicht die eigentliche Hauptmotivation, um die Hebriden-Insel zu erkunden. Es ist vielmehr die dichte Atmosphäre, die sich aus meiner absoluten Unwissenheit, der surrealen Landschaft und der rätselhaften Erzählweise speist, die mich nach den ersten fünfzehn Minuten absolut gefangen nimmt.
Meldet sich die unbekannte Stimme anfangs noch selten, während ich immer mehr seltsame Leuchtfarben-Zeichnungen und Symbole auf der Insel entdecke, wird die Erzählung im Spielverlauf zunehmend gehaltvoller. Dass diese eigentlich aus den Fragmenten verschiedener Geschichten auf unterschiedlichen Zeit- und Symbolebenen besteht, wird mir schnell klar. Ob, und wenn ja welche Bezüge es zwischen dem Hirten Jakobsen, dem Gestrandeten Donnelly, dem Apostel Paulus, dem Erzähler, Esther und mir gibt, klärt sich im Verlauf des Spiels hingegen nur langsam und bei Weitem nicht restlos.
Dabei ist es vor allem die fehlende Kohärenz der Geschichte, die gleichermaßen für Spannung und Verwirrung sorgt: Da diese (abgesehen von einigen wenigen fixen Erzählpunkten) in jedem Durchlauf aus einer Vielzahl von Erzähl-Fragmenten neu zusammengesetzt wird, gewährt sie immer neue Sichtweisen auf die Dinge. Dabei vergisst sie aber auch die narrativen Freiräume nicht, die selbst beim zweiten und dritten Durchlauf noch so angenehm groß sind, dass die eigene Fantasie beständig dazu angeregt wird, all das Gehörte, Gesehene und Gefühlte zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Einem Gesamtbild, in dem immer auch ein Stück weit das liegt, was ich hineingebe.
In dieser Hinsicht erinnert ›Dear Esther‹ dann auch stärker an The Path. Wo dieses allerdings ganz offenkundig mit dem Spiel-sein bricht, mich dazu verleitet, Erkundungsmöglichkeiten jenseits des Pfades bzw. der klaren Spielanweisung wahrzunehmen und mir immens große interpretatorische Freiräume in Bezug auf das Erlebte bietet, tut ›Dear Esther‹ nichts dergleichen. Es gibt mir erst gar nicht das Gefühl, ein Spiel zu sein – nur um dann plakativ damit zu brechen. ›Dear Esther‹ ist von vornherein narratives Experiment und ›Dear Esther‹ ist es auch ziemlich gleichgültig, was ich begreife und was nicht. Weit entfernt von der hübsch anzusehenden Wohlfühl-Spannung eines Myst und der düsteren Schauerlichkeit eines Penumbra, spielt ›Dear Esther‹ atmosphärisch doch ein Stück weit auf deren Klaviatur. Ein digitaler Hybrid aus Briefroman und Bilderbuch für Erwachsene, der nicht nur mir Ansichten auf viele Facetten eines verschlungenen Pfades eröffnet, den wir alle beschreiten – und den wir nicht nur im Spiel niemals einfach verlassen können.
Titelangaben
›Dear Esther‹ (PC)
Entwickler: The Chinese Room