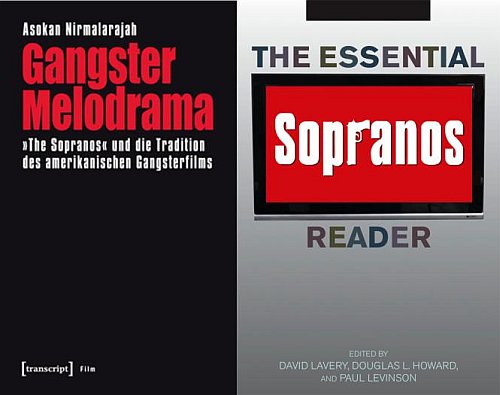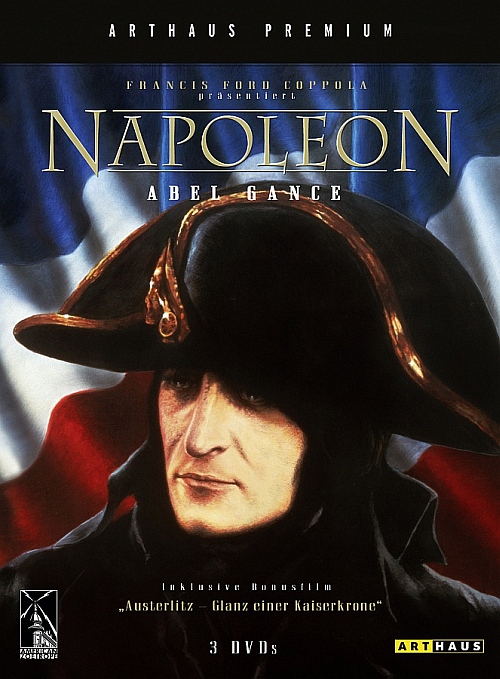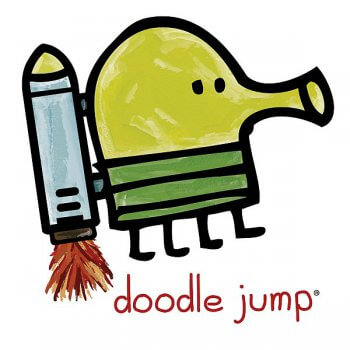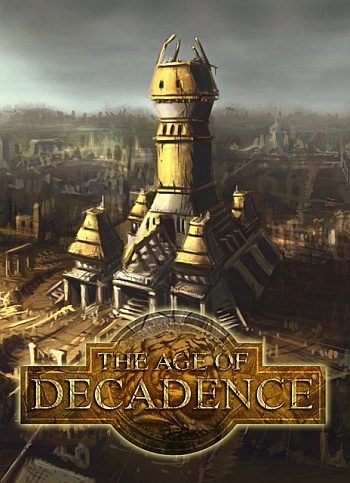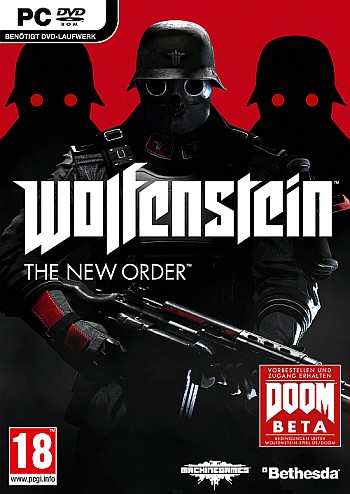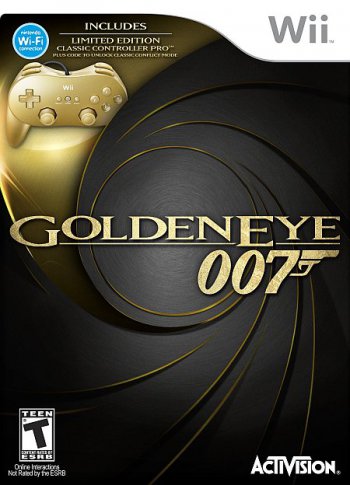Digitales | Games: Datura
Die Geschichte des Drogenkonsums und die Geschichte der Menschheit sind eng miteinander verwoben. Seit der Steinzeit berauschen sich Menschen an all den mehr oder minder bewusstseinserweiternden psychoaktiven Substanzen, die sie so in die Finger bekommen. Unzählige dieser Substanzen sind dementsprechend auch in der westlichen Kultur und ihren Zeugnissen tief verwurzelt, Gegenstand ihres Nachdenkens oder gar ihre kreative Initialzündung gewesen. Woher DANIEL APPEL das weiß? Egal! Lesen Sie lieber weiter.
 So entwickelte etwa Walter Benjamin die Grundzüge seines wirkmächtigen Aura-Begriffs erstmalig in den Erfahrungsprotokollen zum Haschischgebrauch, Carlos Castaneda entdeckte mit Hilfe von Peyote ganz neue (literarische) Welten für die Generation der 68er samt Gefolge, Alton Kelley schuf auf LSD unvergessene Klassiker der psychedelischen Kunst und Hunter S. Thompson legte unter dem Einfluss mannigfaltiger Drogen den Grundstein für den Gonzo-Journalismus. Der gemeine Stechapfel (›Datura‹ stramonium) hingegen kann bis heute trotz seiner starken halluzinogenen Wirkung bestenfalls auf eine bescheidene Karriere im Rahmen kultureller Rezeption zurückblicken – die sich eigentlich schon in seiner Entdeckung durch den Aristoteles-Schüler Theophrastos von Eresos erschöpft. »Ein unhaltbarer Zustand«, dachten sich die polnischen Demo-Coder von Plastic und widmeten der verkannten Pflanze mit ihrem aktuellen Titel ›Datura‹ kurzerhand ein digitales Kleinkunst-Denkmal bzw. das, was sie dafür halten.
So entwickelte etwa Walter Benjamin die Grundzüge seines wirkmächtigen Aura-Begriffs erstmalig in den Erfahrungsprotokollen zum Haschischgebrauch, Carlos Castaneda entdeckte mit Hilfe von Peyote ganz neue (literarische) Welten für die Generation der 68er samt Gefolge, Alton Kelley schuf auf LSD unvergessene Klassiker der psychedelischen Kunst und Hunter S. Thompson legte unter dem Einfluss mannigfaltiger Drogen den Grundstein für den Gonzo-Journalismus. Der gemeine Stechapfel (›Datura‹ stramonium) hingegen kann bis heute trotz seiner starken halluzinogenen Wirkung bestenfalls auf eine bescheidene Karriere im Rahmen kultureller Rezeption zurückblicken – die sich eigentlich schon in seiner Entdeckung durch den Aristoteles-Schüler Theophrastos von Eresos erschöpft. »Ein unhaltbarer Zustand«, dachten sich die polnischen Demo-Coder von Plastic und widmeten der verkannten Pflanze mit ihrem aktuellen Titel ›Datura‹ kurzerhand ein digitales Kleinkunst-Denkmal bzw. das, was sie dafür halten.
Schweigen im Walde
Da unaufgeregte digitale First-Person-Spaziergänge derzeit Konjunktur haben, verschließt sich auch ›Datura‹ diesem Trend nicht gänzlich. Die rudimentären Gameplay-Mechaniken, die sich irgendwo zwischen den Quicktime-Events eines ›Heavy Rain‹ und dem langsamen Abschreiten linearer Wege eines ›Dear Esther ›bewegen, verleihen der digitalen Collage der polnischen Entwickler eher den Touch einer interaktiven Tech-Demo denn eines vollwertigen Spiels.
Zu Beginn meiner Reise ist von der Interaktivität allerdings nicht viel zu spüren: Ich finde mich rücklings auf der Liege eines schwach erleuchteten Krankenwagens wieder und kann mich kaum rühren. Ein gelbes Streiflicht taucht den Innenraum des Krankenwagens für einen kurzen Augenblick in ein unwirkliches Licht. Mit Mühe kann ich meinen Kopf etwas drehen und nehme außer allerlei medizinischem Gerät einen hantierenden Sanitäter neben meiner Liege wahr. Der gleichmäßige Piepton des EKG durchdringt die unheimliche Stille. Mit großem Kraftaufwand schiebe ich die Decke von meinem Oberkörper herunter. Die Anstrengung lässt mein Herz rasen.
Eben noch ruhig und gleichmäßig beschleunigt der Signalton des EKG jetzt rapide. Der Sanitäter blickt hektisch auf und greift nach etwas. Das EKG schlägt mittlerweile so schnell aus, dass kaum noch Pausen zwischen den einzelnen Signalen bleiben. Mein Kopf sackt auf die Seite, ich höre ein durchgängiges Piepen, während der Sanitäter den Defibrillator auf meinen Brustkorb setzt. Es ruckt, mein Kopf zuckt nach oben, schlägt hart zurück – dann wird es still. Still und schwarz. Kurz darauf wird alles weiß. Ich knie auf einer schneebedeckten Eisfläche. Vorsichtig wische ich mit einer Hand den Schnee zur Seite und sehe einen goldenen Pokal unter der Eisfläche treiben. Beherzt greife ich mir den herumliegenden Eispickel und hole aus, als eine Bewegung unter dem Eis mein Interesse weckt. Ich wische etwas mehr Schnee zur Seite und sehe ein junges Mädchen unter dem Eis, das panisch gegen die geschlossene Eisdecke hämmert.
Hektisch treibe ich den Pickel ins Eis und hacke ein Loch frei. Das Mädchen streckt mir die Hand entgegen, ich greife zu – und werde ins eisige Wasser gezogen. Von dem Mädchen ist weit und breit nichts zu sehen. »So dankt einem das Leben die Hilfsbereitschaft«, denke ich noch, während ich immer weiter hinabsinke und das Sonnenlicht schwächer wird. Dann wird es still. Still und schwarz.
Als ich nach diesem rasanten Auftakt wieder zu mir komme, stürze ich auf den laubbedeckten Boden eines nebelverhangenen Waldes. Neben zahlreichen Bäumen und etwas herbstlichem Gestrüpp säumt nur eine Pflanze mit ihrer weißen Blütenpracht den Wegesrand. Der gemeine Stechapfel. An einer nahestehenden Birke entdecke ich Notizblock und Stift, mit denen ich sogleich beginne, meine Umgebung zu kartografieren: Ein seltsames kleines Waldstück, hinter dessen schmiedeeisernem Tor sich Schmetterlinge, Schweine, Schießbuden, Wassertürme, Irrgärten und eine Menge Stechäpfel zu einem surrealen Ensemble zusammengefunden haben. Und so stapfe ich los, den knapp zweistündigen Erinnerungen (m)eines Lebens entgegen … und einem Handlungsverlauf, den ›Datura‹ ohne ein einziges Wort zu erzählen versucht.
Die moralische Zweifarbenlehre des Stechapfels
Das Grundmotiv der Geschichte, die ›Datura‹ erzählen will, ist zwar weder besonders neu, noch so originell wie der rätselhaft-abrupte Einstieg, böte mit seiner Thematik aber durchaus narratives Potenzial. ›Datura‹ variiert die Frage nach Erinnerungen, ihrer Zugänglichkeit, Schuld und der Möglichkeit sich für das „Gute“ oder das »Schlechte« zu entscheiden. Bewaffnet mit meiner Karte, die ich an bestimmten Punkten im Spiel selbstständig weiter zeichne, durchquere ich das eingangs erwähnte überschaubare Waldstück. Immer auf der Suche nach Versatzstücken aus meiner Erinnerung, die mir Zugang zur selbigen gewähren.
Der surreale Stechapfel-bewehrte Wald mit seinen alltagsweltlichen Einsprengseln wirkt dabei zunächst stimmungsvoll und macht neugierig. Wofür steht wohl das schlafende Schwein, das ich durch den gezielten Wurf einer Kartoffel aufwecken kann? Wie komme ich durch die rätselhafte, frei stehende Holztür, die hier mitten im Wald steht? Und wohin führt sie mich? Was für eine mechanisch-entartete Variante eines Apfelbaumes steht dort im Garten der vernagelten Holzhütte? Bis zu dieser Stelle macht ›Datura‹ vieles richtig, gibt sich im Art-Design kaum Blöße und erinnert in dieser Hinsicht sogar in einigen Facetten an die stilsichere und seinerzeit aufsehenerregende Tech-Demo ›Linger‹ in Shadows, mit der Plastic 2008 auf der PS3 debütierten.
Der Eindruck, dass die polnischen Demo-Coder neben ihrer technischen Expertise allerdings kaum etwas vom Geschichtenerzählen oder von Game-Design verstehen, folgt leider auf dem Fuße und wirkt insbesondere vor dem Hintergrund der stimmungsvollen Kulisse ärgerlich. Zunächst zerstören einige grundlegend fragwürdige spielmechanische Entscheidungen die Atmosphäre von ›Datura‹ nachhaltig: Warum beispielsweise wird meine Bewegungsgeschwindigkeit so arg limitiert, wenn es doch während der quälend langsamen Fortbewegung nichts zu sehen und nichts zu entdecken gibt? Warum wird mir eine streckenweise unsäglich dysfunktionale Move- bzw. Sixaxis-Steuerung aufoktroyiert, die im Widerspruch zu jeglichem natürlichen Bewegungsgefühl des Menschen steht?
Allein diese permanenten Ärgernisse verhindern zu großen Teilen die frustfreie Auseinandersetzung mit dem grundsätzlich spannenden Sujet von ›Datura‹, das durch eine Reihe fragwürdiger Design-Entscheidungen noch weiter demontiert wird. Diese reichen von der degradierenden Darstellung der rechten Hand meines Protagonisten als isoliertes, ja geradezu abgehackt wirkendes Interface-Objekt ohne Verbindung zum (gelegentlich sichtbaren) Körper bis hin zum Verzicht auf Sprache und den sich daraus ergebenden Konsequenzen.
Ließe sich die Geschichte von ›Datura‹ von fachlichen Virtuosen sicherlich stimmungsvoll mit zahlreichen Feinheiten und Zwischentönen ganz ohne Worte erzählen, setzt Plastic hier auf plumpe stereotype Dichotomien und erschlagend eindeutige bildsprachliche Metaphern, die das Spiel auf der erzählerischen Ebene künstlich limitieren. Ein Beispiel: Die kurzen Erinnerungssequenzen werden jeweils nur sehr knapp durch den auslösenden Gegenstand und ihre bildliche Darstellung kontextualisiert. Beste Voraussetzungen also, um mir die moralische Deutungshoheit über das Gesehene und die Handlungsentscheidung zu überlassen.
Nachdem ›Datura‹ mir also zu verstehen gibt, dass ich möglicherweise einst jemanden erschossen habe und mir eine Erinnerungssequenz zu meiner Flucht während eines Gefangenentransports serviert, schwanke ich. War ich wirklich schuldig? War es richtig in der gegebenen Situation zu fliehen? Bevor ich mich allerdings gedanklich näher damit befassen kann, schreitet ›Datura‹ ein. Eine fette schwarze oder weiße Markierung erscheint auf der Karte und eine farbenprächtige Schmetterlingsprozession oder aber ein düsterer Käferschwarm nehmen das Erinnerungsartefakt in Beschlag. Zwischentöne? Fehlanzeige! Jede Situation lässt sich dementsprechend auch nur auf exakt zwei Arten lösen – eine gute und eine schlechte. Das dabei gelegentlich sogar moralisch eher indifferente (um nicht zu sagen: beinahe belanglose) Erinnerungen oder potenziell schwer entscheidbare Situationen aus kindlicher Perspektive herangezogen werden, ehrt die Entwickler – das diese allerdings gleichermaßen mit der Schwarz-Weiß-Keule niedergeknüppelt werden, weniger. Da fällt es dann auch kaum weiter ins Gewicht, dass all meine Handlungen nahezu keine spielerischen oder narrativen Konsequenzen haben, sieht man von einer einzelnen, in ihrer Wirkung zu vernachlässigenden Szene am Spielende einmal ab. Auch der gesamte Spielverlauf auf dem Weg zum belanglosen Ende gestaltet sich schematisch und unspektakulär: Langsam schlurft man von Erinnerungsartefakt zu Erinnerungsartefakt, interagiert mit einem Gegenstand, tut oder lässt etwas in der Erinnerungssequenz, kassiert dafür die moralische Aburteilung und schüttelt den Kopf angesichts des hier verschenkten Potenzials.
Wäre ›Datura‹ nur etwas weniger herrisch, in seiner Bildsprache weniger totalitär und würde mir die gedankliche, sowie die moralische Auseinandersetzung in Bezug auf die stimmungsvollen Erinnerungen überlassen, es wäre ein durchaus anregender digitaler Kurzfilm zum Mitspielen. Das sogar der titelgebende Stechapfel letzten Endes nur zur plumpen Metapher für die Irrealität der Spielwelt verkommt, fügt sich dann auch homogen in das hübsch anzuschauende Potpourri von Trivialitäten ein, das Plastic mir hier serviert. Immerhin müssten die Polen durch ›Datura‹ gelernt haben, dass es auch im Hinblick auf kommende Projekte immer bloß zwei Wahlmöglichkeiten geben kann: Entweder etwas weniger Stechapfel naschen und Game-Design-Nachhilfe nehmen oder aber weiterhin Grafikdemos coden.
Titelangaben
›Datura‹ (PS3 – PSN)
USK: 16
Entwickler: Plastic