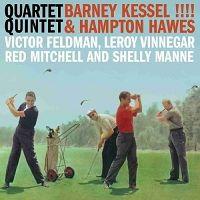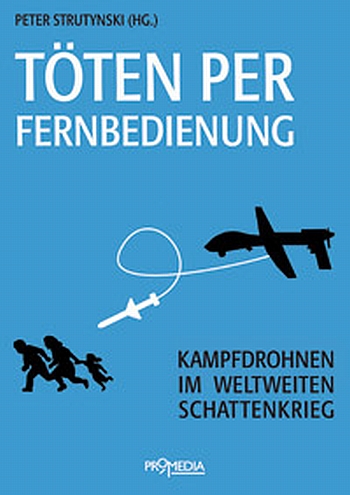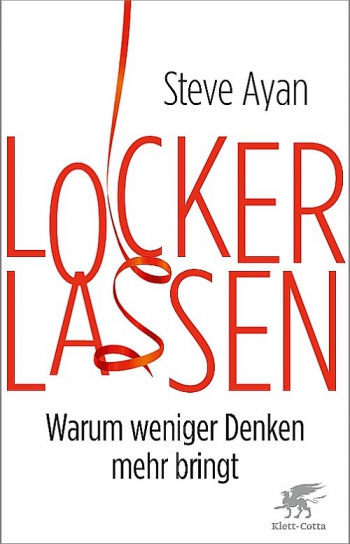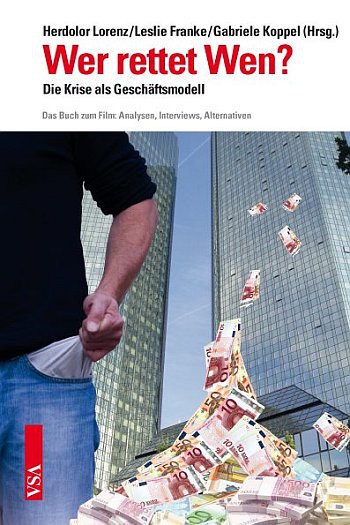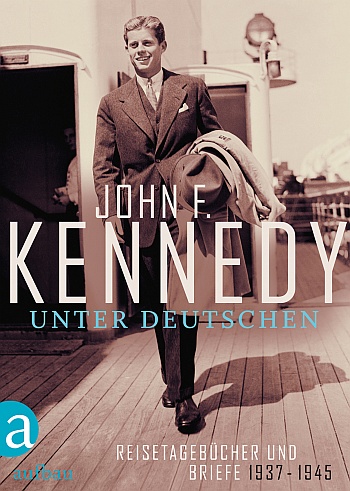Gesellschaft | Ines Geipel: Der Amok-Komplex
Wie bewundernswert eine Gesellschaft umgehen kann mit einem Massenmord, der ihr tiefe, vielleicht nie ganz vernarbende Wunden zugefügt hat, konnte man gerade am Prozess gegen den Attentäter von Oslo und Utøya studieren. Auch um ihn und seine Tat geht es in Ines Geipels neuem Buch Der Amok-Komplex oder die Schule des Tötens. Aber auch um den Versuch, einem erschreckend »modernen« und medial verstrickten Gewaltphänomen literarisch beizukommen. Von PIEKE BIERMANN
 Jede Amoktat hat ihre individuelle Vorgeschichte und Handschrift und wird zurecht juristisch als spezifischer einzelner Fall aufgearbeitet. Für die Fragen etwa, ob diese Art Verbrechen eine neue Dimension bekommen hat, warum das so sein und was man dagegen tun könnte, ist kein Gericht zuständig. Aber genau die Frage beschäftigt, ebenfalls zurecht, die Gesellschaft, und in der wird sie auch verhandelt – publizistisch, wissenschaftlich, kriminologisch, im mehr oder weniger kompetenten privaten und öffentlichen Reden darüber. Amoktaten sind Massenmorde, die tiefe Wunden in Individuen und in eine Gesellschaft schlagen. Das Gefühl, dass sie seit etwa zwanzig Jahren beunruhigend zunehmen, mag durch mediale Hysterie verschärft werden, aber es wurzelt in der Realität. Und all die Fälle, in denen ein irrwitzig überbewaffneter, junger Mann an einem öffentlichen Ort, in einer Schule ein Blutbad anrichtet, haben höchst beunruhigende Gemeinsamkeiten.
Jede Amoktat hat ihre individuelle Vorgeschichte und Handschrift und wird zurecht juristisch als spezifischer einzelner Fall aufgearbeitet. Für die Fragen etwa, ob diese Art Verbrechen eine neue Dimension bekommen hat, warum das so sein und was man dagegen tun könnte, ist kein Gericht zuständig. Aber genau die Frage beschäftigt, ebenfalls zurecht, die Gesellschaft, und in der wird sie auch verhandelt – publizistisch, wissenschaftlich, kriminologisch, im mehr oder weniger kompetenten privaten und öffentlichen Reden darüber. Amoktaten sind Massenmorde, die tiefe Wunden in Individuen und in eine Gesellschaft schlagen. Das Gefühl, dass sie seit etwa zwanzig Jahren beunruhigend zunehmen, mag durch mediale Hysterie verschärft werden, aber es wurzelt in der Realität. Und all die Fälle, in denen ein irrwitzig überbewaffneter, junger Mann an einem öffentlichen Ort, in einer Schule ein Blutbad anrichtet, haben höchst beunruhigende Gemeinsamkeiten.
Amokschützen lernen voneinander
Um diese Schnittmengen geht es Ines Geipel, die sich 2004 schon einmal ausführlich mit dem Massaker im Gutenberg-Gymnasium Erfurt auseinandergesetzt hatte. Ihnen spürt sie anhand von fünf Amoktaten und -orten nach: von Port Arthur/Tasmanien am 28. April 1996 über drei deutsche Orte – Erfurt am 26. April 2002, Emsdetten am 20. November 2006, Winnenden am 11. März 2009 – bis Oslo und Utøya am 22. Juli 2011. An ihnen lässt sich im Detail nachverfolgen, was inzwischen Standard der kriminologischen Forschung ist: Amokschützen beziehen sich aufeinander, dialogisieren durch ihr Tun miteinander – ihrem eigenen Selbstverständnis nach wie Künstler – und lernen voneinander.
Für den tasmanischen Täter hatte das Massaker an sechzehn kleinen Kindern und ihrer Lehrerin im schottischen Dunblane im März 1996 wie ein Aufputschmittel gewirkt, sechs Wochen später tötet er 35 Menschen. Der Mordlauf zweier Schüler der amerikanischen Columbine High School am 20. April 1999 mit dreizehn Toten und 24 Verletzten wurde »zum Referenzsystem, zu einer neuen Grammatik des Tötens«. Ab 2001 hat Nine-Eleven mit dreitausend Toten und seinem fatal bildmächtigen Szenario den mörderischen Horizont erweitert. Inzwischen bietet die Internet-Community regelrechte Amok-Rankings.
Trainingsplatz Online-Kriegspiele
Die Schnittmengen sind, knapp zusammengefasst: Sprachlosigkeit, frühe Ohnmachtsgefühle, Waffenfetischismus, Drogen – Alkohol und/oder chemische Keulen wie Ecstasy, Tilidin und Anabolika – und manisches Online-Kriegspielen. Amokmörder lernen als Ego-Shooter töten, kostümieren sich, der Franchise-Industrie sei Dank, zum Counterstrike in einer World of Warcraft, die allmählich mit ihrer realen Welt verschwimmt und schließlich an deren Stelle tritt.
Moderne Amokläufe sind keine spontanen Ausbrüche, sondern lange und präzis vorbereitete Taten, in denen sich eine noch viel länger verkapselte Wut und Ohnmachtsgefühle in absolute Herrschaft verwandeln und den Täter berühmt machen sollen, »damit mich kein Mensch mehr vergisst«. In jüngerer Zeit sorgen die jungen Mörder auch selbst für ihren »Nachruhm«. Wie der Attentäter von Oslo und Utøya: »Noch bevor er ans Morden geht, kümmert er sich um die Rezeption« – er stellt sein jahrelang zusammengepanschtes »Manifest« ins Netz. Amokläufer sind keine vereinsamten dummen Jungs aus sozialen Randgruppen, sie sind zumeist gut ausgebildet und bestens vernetzt. Sie »töten aus unserer Mitte heraus«.
Mediale Gewaltdröhnung durchbrechen
Das ist (fast) alles nicht neu. Über Amoktaten wird viel geforscht. Was Ines Geipels Buch besonders macht, ist die Erweiterung des Blicks auf eben diese jeweilige Mitte mithilfe psychologischer, soziologischer, auch historischer Vektoren. Sie funktioniert wie ein sprachloser »Echo-Raum«, wie ein »Trauma-Container«, in dem individuelle wie kollektive historische Gewalterfahrung nachhallen – die Entgrenzung der Menschlichkeit durch Nazigewalt zum Beispiel bis ins heutige Norwegen. Alle Täter sind durch »entborgene Kindheiten« gegangen, manche haben sogar professionelle Hilfe bekommen, aber niemand hat die vielen Zeichen, die sie ausgesendet haben, richtig gelesen.
Der Amok-Komplex ist der Versuch, einer komplizierten Gemengelage auch literarisch gerecht zu werden. Ines Geipels schreibt aus einem zutiefst aufklärerischen Impuls heraus und so emphatisch wie empathisch. Sie ist an die Tat-Orte gereist, bis nach Tasmanien, und verschränkt ihre eigenen Recherchen mit neuer Forschung aus Neuropsychologie, Kriminologie und Evolutionsbiologie und psychoanalytischen Gedanken zu Vater- und Mutter-Bilder. Das ist spannend zu lesen, gerade weil sie den Fluss ihres oft persönlichen Erzählens immer wieder unterbricht, um (sich) die entscheidende Frage zu stellen: Wie kann man von so etwas erzählen, ohne »die mediale Dauerdröhnung durch Gewalt zu bedienen«?
Eine erste Version dieser Rezension wurde am 2. Mai 2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.
| PIEKE BIERMANN
Titelangaben
Ines Geipel: Der Amok-Komplex oder die Schule des Tötens
Stuttgart: Klett-Cotta 2012
343 Seiten, 19,95 Euro
Reinschauen
Leseprobe