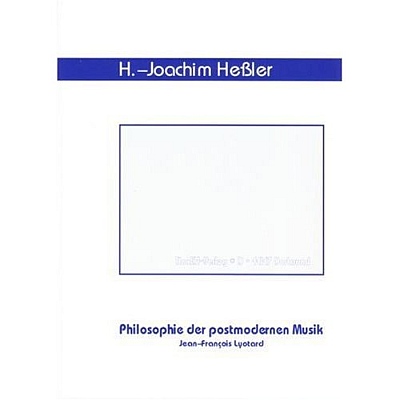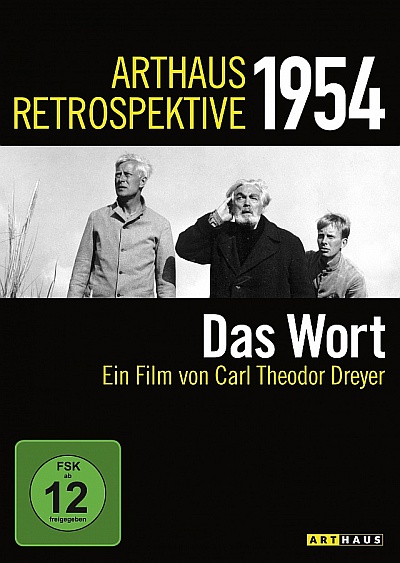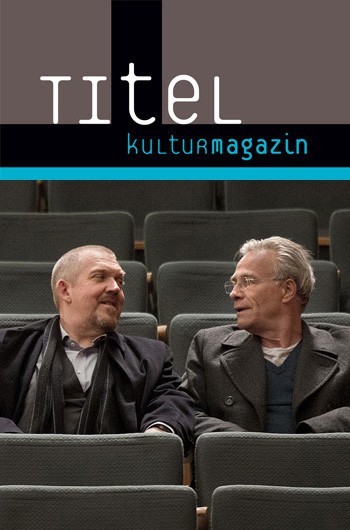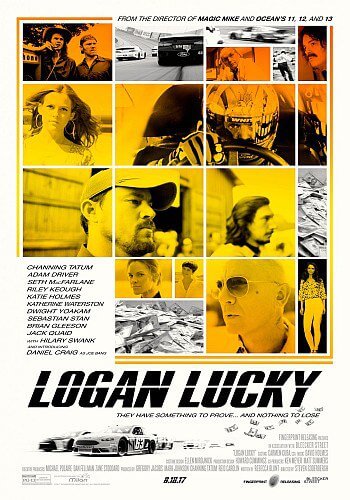Film| DVD: Peter Brooks Mahabharata
Besucher der Seebühne bei den Bregenzer Festspielen oder der Arena von Verona schwärmen von den überdimensionalen Bühnenbildern. Offenbar entspricht Gigantomanie weit über die charakteristische Ästhetik totalitärer Systeme hinaus dem Schönheitsverständnis vieler Menschen. Sie schauen gerne auf, nach oben. Sie machen sich klein, indem sie sich der Protz- und Imponiergebärde des phallisch Hochragenden, sei es ein Wolkenkratzer, ein Turm oder eben ein Bühnenbild, unterordnen. Von THOMAS ROTHSCHILD
 Mit großem Theater freilich hat das nichts zu tun. Großes Theater definiert sich nicht architektonisch, sondern durch seine Stoffe. Die Shakespeares und die Atriden der Ariane Mnouchkine waren großes Theater, gewiss wegen der Regie, wegen des Ensembles, aber auch wegen der zeitlosen Universalität der literarischen Vorlagen.
Mit großem Theater freilich hat das nichts zu tun. Großes Theater definiert sich nicht architektonisch, sondern durch seine Stoffe. Die Shakespeares und die Atriden der Ariane Mnouchkine waren großes Theater, gewiss wegen der Regie, wegen des Ensembles, aber auch wegen der zeitlosen Universalität der literarischen Vorlagen.
1985 entschied sich der englische Theatermagier Peter Brook, mithilfe des Dramatikers Jean-Claude Carrière eine szenische Fassung des indischen Nationalepos Mahabharata herzustellen. Was dabei herauskam, ist großes Theater im eigentlichen Sinne. All die aktuellen Diskussionen über ein angeblich museal gewordenes Stadttheater im Gegensatz zu Freien Gruppen werden angesichts dieses Projekts gegenstandslos. Es birgt die Möglichkeiten der beiden Organisationsformen und weit mehr als diese in sich.
Zugleich könnte es all jenen Argumentationshilfe liefern, die für die Dramatisierung von Erzähltexten plädieren – wären sie auch nur halb so begabt wie Peter Brook. Er macht aus dem Epos nicht nur Theater im emphatischen Verständnis, er hat diese Inszenierung darüber hinaus zu einem Film verarbeitet, der beides zugleich ist: die Aufzeichnung eines Bühnenkunstwerks und ein Film, der den eigenen Gesetzen der Gattung gerecht wird.
Dieser 1989 gedrehte dreiteilige Film liegt jetzt auf DVD vor, ergänzt um eine Making-Of-Dokumentation und eine auf knapp drei Stunden gekürzte Fassung. Die Bühnenversion, die in einer französischen und einer englischen Fassung um die Welt reiste, hatte eine Dauer von neun Stunden.
Ein Kunstwerk eigenen Zuschnitts
Peter Brook arbeitet hier, wie auch sonst, mit einem internationalen Ensemble. Einzelne Schauspieler kennt man aus anderen Projekten, die im Théâtre des Bouffes du Nord oder bei Gastspielen zu sehen waren. Das Mahabharata erzählt mit elementarer Wucht von Brudermord und Krieg, von Intrige und Liebe, und ist zugleich angefüllt mit philosophischen Erkenntnissen, die dem aufgeklärten Europäer zum Teil mystisch erscheinen mögen, die aber Motive aufnehmen und variieren, die auch in anderen Regionen der Welt das Denken bestimmen, weil sie die universelle conditio humana betreffen: Wie soll man leben, wie handelt man richtig, worin besteht Glück, was bedeutet der Tod?
Peter Brook versucht sich gar nicht erst in indischer Folklore. Er hat für dieses Schau-Spiel vielmehr eine Form entwickelt, die sich auch nicht vor großen Gesten, vor einem Pathos fürchtet, das dem psychologisierenden europäischen und nordamerikanischen Theater seit Ibsen und Tschechow abhandengekommen ist. Der Vorwurf der Verfälschung des in der indischen Kultur tief verankerten Epos, ja des Kulturimperialismus musste, insbesondere aus Indien selbst, voraussehbar auf Brooks und Carrières Bearbeitung folgen.
Aber er wird dem Unternehmen ebenso wenig gerecht wie der Vorwurf mangelnder Texttreue gegenüber vielen Klassikerinszenierungen im Regietheater. Zwar hat Brook das im Westen kaum bekannte Epos tatsächlich über Asien hinaus ins Bewusstsein gehoben, aber seine Inszenierung ist ein Kunstwerk eigenen Zuschnitts, keine Schulfunkeinführung in indische Kultur und Philosophie.
Man kann Macbeth ansehen, um sich über schottische Geschichte zu informieren. Dass Shakespeare 400 Jahre nach seinem Tod immer noch die Spielpläne anführt, dürfte sich jedoch kaum dem historischen Interesse verdanken. Und auch der anhaltende Erfolg von Wagners Ring ist wohl nicht Beleg für die Aktualität des deutschen Mittelalters. Was an diesen Stoffen nach wie vor fasziniert, ist von anderer Qualität. Peter Brooks Mahabharata verfügt über sie.
| THOMAS ROTHSCHILD
Titelangaben
Peter Brook: Mahabharata
absolut Medien
3 DVDs, 29,90 Euro