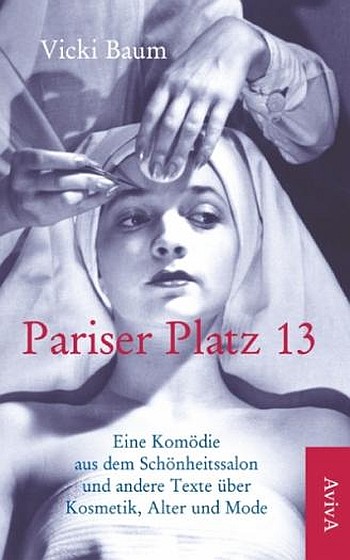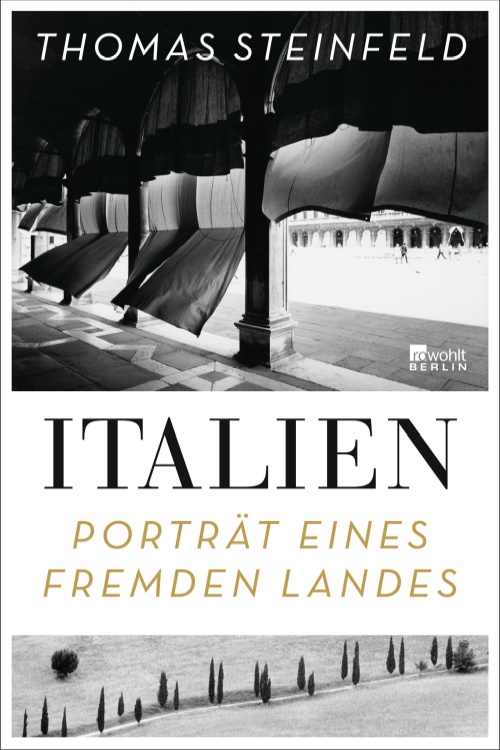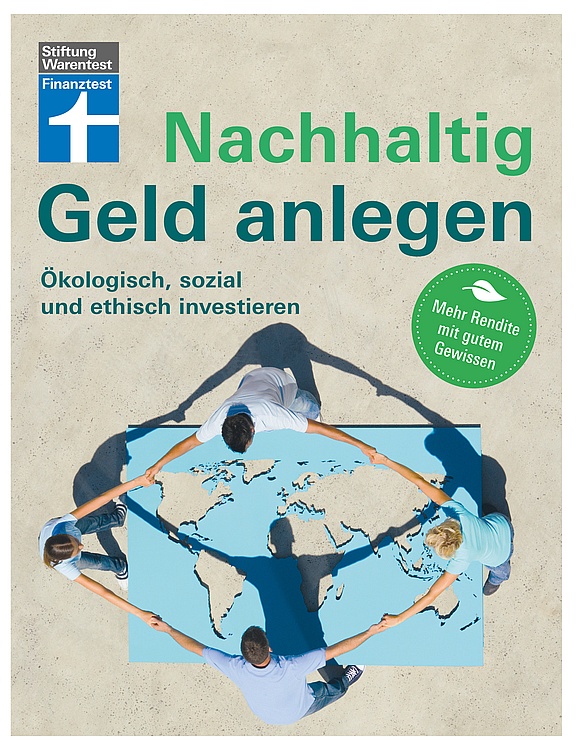Sachbuch | Jean Ziegler: Wir lassen sie verhungern
Jean Ziegler, der streitbare und nicht minder umstrittene Globalisierungskritiker und UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung beschreibt in seinem Buch Wir lassen Sie verhungern. Die Massenvernichtung in der Dritten Welt die Tragödie der weltweit grassierenden Unterernährung. Die Lösung dieser humanitären Katatrophe liege demzufolge nicht fern, scheitere jedoch oft genug an Bürokatie und Ignoranz. Das Buch schildert Erfolge und Versagen im Kampf gegen die globale Ernährungskrise. Von JÖRG FUCHS
 Alle fünf Sekunden stirbt auf dieser Welt ein Kind an den Folgen von Mangel- und Unterernährung, jeder siebte Mensch auf der Erde ist schwerstens unterernährt. Jean Ziegler kennt und nennt diese Zahlen, weiß aber auch, dass er mit statistischen Aussagen seine Leser vom Thema distanziert. Daher schildert er die Schicksale von Betroffenen in schonungsloser Härte, um den Vorhang aus Zahlen, der den Blick auf die humanitäre Katastrophe verschleiert, wegzureißen. Gute und gut gemeinte Ratschläge zur Eindämmung von Ernährungskrisen gibt es viele – doch in Zieglers Augen verhindern endlose Debatten in Gremien, akademische Diskussionen und nutzlose Projektentwürfe häufig rasche und durchschlagende Hilfe.
Alle fünf Sekunden stirbt auf dieser Welt ein Kind an den Folgen von Mangel- und Unterernährung, jeder siebte Mensch auf der Erde ist schwerstens unterernährt. Jean Ziegler kennt und nennt diese Zahlen, weiß aber auch, dass er mit statistischen Aussagen seine Leser vom Thema distanziert. Daher schildert er die Schicksale von Betroffenen in schonungsloser Härte, um den Vorhang aus Zahlen, der den Blick auf die humanitäre Katastrophe verschleiert, wegzureißen. Gute und gut gemeinte Ratschläge zur Eindämmung von Ernährungskrisen gibt es viele – doch in Zieglers Augen verhindern endlose Debatten in Gremien, akademische Diskussionen und nutzlose Projektentwürfe häufig rasche und durchschlagende Hilfe.
In den sechs Teilen seines Buches Wir lassen sie verhungern beschreibt der Schweizer seine Erfahrungen als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Zunächst schildert er den Hunger als körperliche Erfahrung in seiner ganzen Schonungslosigkeit; in den weiteren Kapiteln setzt er sich mit der Hilfs- und Verwaltungsarbeit staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen und Organisationen auseinander. Er erläutert, wie der Agrarsektor zunehmend als Spekulationsobjekt ausländischer Fonds und Konzerne (Ziegler nennt sie aufgrund ihrer Aggressivität ›Tigerhaie‹) sowie lokaler Potentaten missbraucht wird. Im letzten Kapitel setzt er sich gezielt mit denjenigen auseinander, die seiner Ansicht nach Schuld daran haben: die ›agroindustriellen Beutejäger‹ in Form von Spekulanten, Banken und Konzernen.
Wie in vielen seinen Büchern und Beschreibungen schont er den Leser nicht. Schmerzhaft sind seine Beispiele, drastisch seine Schilderungen wie der Bericht über die grauenhaften Noma-Krankheit, die auf Unterernährung bei Kindern zurückzuführen ist und deren Gesichter förmlich schmelzen lässt – bis diese monströsen Ungeheuerlichkeiten gleichen. Im krassen Gegensatz zu den individuellen Betroffenheiten stellt er die nüchternen Schilderungen der nicht immer erfolgreichen, teilweise sogar kontraproduktiven Bemühungen durch Behörden und Nichtregierungsorganisationen, auf Hungerkatastrophen zu reagieren.
Der Acker als Spekulationsobjekt
Lobenswert ist die Tatsache, dass Ziegler die Menschen in seinen Betrachtungen nicht als wehrlose Opfer von Unmündigkeit und Hilflosigkeit abqualifiziert (wie es uns manche Spendenkampagnen gerne suggerieren), und sie somit einer fürsorglichen »Leitung« durch NGOs und Verwaltungsbehörden anheimstellt. Stets nennt er die Gründe, warum Menschen in ausweglose Situationen geraten oder getrieben werden. Exemplarisch schildert Ziegler die sozialen Folgen der Landnahme (›Land grabbing‹) in vielen sogenannten ›Drittwelt- und Schwellenländern‹ mit ihren häufig nur schwach ausgeprägten Besitzverhältnissen des (Acker-) Bodens stattfindet. In diese Besitzlücke stoßen die ›Tigerhaie‹ und kaufen für wenig Geld massenhaft Grundstücke. Diese werden nach Gewinnsteigerungen weiterveräußert oder zum Anbau von lukrativen Pflanzen durch westliche oder asiatische Großkonzerne genutzt. In vielen Gegenden, beispielsweise dem Sudan, wurden die bis dahin ansässigen selbstständigen Kleinbauern vertrieben oder als Tagelöhner mit Elendsverdiensten abgespeist. Insgesamt wurde im Jahr 2010, laut Ziegler, in afrikanischen Staaten von europäischen und amerikanischen Banken sowie asiatischen Staatsfonds Grundbesitz in einer Größenordnung von fast 60 Millionen Fußballfeldern erworben. Diese Form der Landnahme durch Spekulanten zieht häufig katastrophale Folgen für die Bevölkerung nach sich. Neben der Verelendung und dem zerbrechen der sozialen Strukturen durch Vertreibung und Tagelöhnerei prangert Ziegler Umweltzerstörungen durch Rodung und den Anbau von gewinnträchtigen Monokulturen sowie Spekulation mit den Feldfrüchten durch westliche Hedgefonds an.
Es wäre für Ziegler ein Leichtes gewesen, an dieser Stelle abzubrechen, um die Ungerechtigkeiten des globalen ›Land grabbings‹ durch die ›Tigerhaie‹ als besonders verwerflich anzuprangern. Stattdessen zeigt er auch die Resonanz der Zivilgesellschaft, die sich, vor allem in zahlreichen afrikanischen Staaten, in Widerstand und Wehrhaftigkeit ausdrückt. So schlossen sich in Niger zahlreiche Gewerkschaften und Bauernverbände zu einem schlagkräftigen Verband zusammen, um – mit beachtlichen lokalen Erfolgen – weiteren Landraub zu verhindern. In Benin, wo die Regierung brachliegendes Ackerland als Spekulationsobjekt nutzt, aber zugleich Getreide und Reis importieren muss, führt die Bauerngewerkschaft Synergie paysanne einen erfolgreichen Kampf gegen illegale Landnahme.
Lösungen?
Diese Beispiele verdeutlichen die Intention des Autors: Anhand konkreter Beispiele, die er von der Ursache bis hin zu – erfolgreichen oder gescheiterten – Lösungsansätzen umfänglich beschreibt, will er ein Bewusstsein dafür schaffen, dass in der Regel nicht die eigene Unmündigkeit der Zivilgesellschaften in Drittwelt- und Schwellenländern schuld an vielen Miseren ist. Stattdessen werden dort – durch westliche und asiatische Banken, Fonds und Konzerne, teilweise unter der Mitwirkung korrupter Regime – gewachsene soziale Strukturen dem Profitstreben der Spekulanten geopfert.
Neben den Lösungsansätzen für konkrete Katastrophenfälle zeigt Jean Ziegler zahlreiche – mehr oder weniger radikale – Änderungsvorschläge, vor allem aufseiten von institutionalisierten Verwaltungs- und Konzerneinheiten. So fordert er neben dem Kampf gegen den allgemeinen Sittenverfall in den Führungseliten stärkere gesetzliche Einflussnahme auf Agrarkonzerne und Börsenspekulanten, die juristische Vorrangigkeit des Rechtes auf Nahrung, das Verbot von Biotreibstoffen sowie die stärkere Unterstützung lokaler Graswurzelorganisationen und Aktivisten.
Das Buch bewirkt beim Lesen mehrerlei: Die teils hoffnungslos scheinenden Exempel lassen uns Leser nicht kalt. Aber Ziegler verharrt nicht in der unreflektierten Darstellung des »Elendstourismus«, sondern zeigt, wie engagierte lokale und ausländische Initiativen, oft ohne Unterstützung zwischenstaatlicher Institutionen erfolgreiche Arbeit vor Ort leisten, ohne den Betroffenen die Würde zu rauben und sie zur Unmündigkeit zu verdammen. In seiner schnörkellosen, fast atemlosen Art, hetzt uns Ziegler durch die sechs Kapitel dieses Buches, so als ob er Angst hätte, man könne es aus der Hand legen, bevor seine Botschaft uns erreicht hätte.
Diese Sorge ist unbegründet!
| JÖRG FUCHS
Titelangaben
Jean Ziegler: Wir lassen sie verhungern. Die Massenvernichtung in der Dritten Welt
München: Bertelsmann 2012
320 Seiten. 19,99 Euro
Reinschauen
Leseprobe