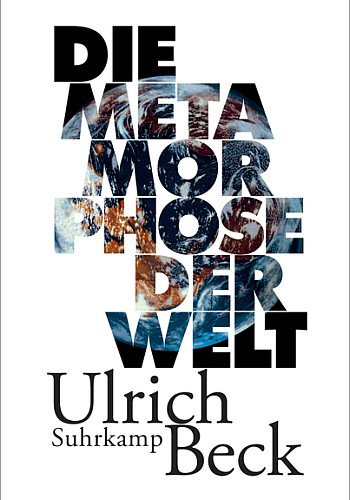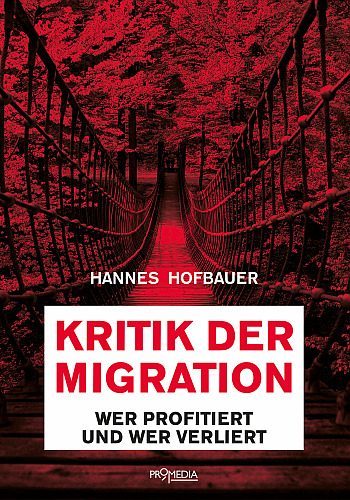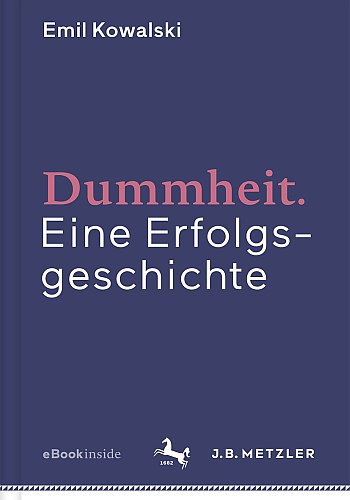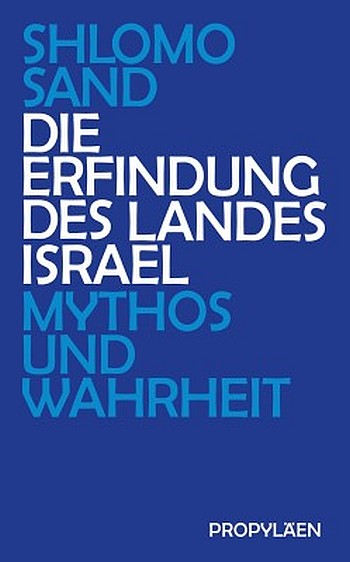Kulturbuch | Hans-Jörg Bullinger/ Brigitte Röthlein: Morgenstadt Wie wir morgen leben
Die Metropolen der Welt wachsen mit atemberaubender Geschwindigkeit. Schon heute lebt mehr die Hälfte der etwa 7 Milliarden Menschen in ihnen. Professor Hans-Jörg Bullinger, bis vor kurzem Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft – der größten Organisation für angewandte Forschung in Europa – und Wissenschaftsautorin Brigitte Röthlein präsentieren Denkanstöße für die zukünftige Gestaltung unserer Städte. Von TOM ASAM
 Städte verbrauchen drei Viertel aller Ressourcen. Ihre Bewohner produzieren Unmengen von Abgasen und Müll, der Verkehr kommt immer öfter zum Erliegen. Die Tendenz der Zunahme der städtischen Bevölkerung verlangt Gegenentwürfe zu Fehlentwicklungen, die auf Bedingungen überholter städtischer Realitäten beruhen. In Morgenstadt sammeln Hans-Jörg Bullinger und die Wissenschaftsjournalistin Brigitte Röthlein Visionen, wie Städte effizienter gestaltet werden und vom Problemfall zum Zentrum der Lösung etlicher Probleme werden können. In der Zukunft sollen die Probleme von Megastädten und Ballungsräumen vor allem mit dem Einsatz modernster Technologie angegangen werden.
Städte verbrauchen drei Viertel aller Ressourcen. Ihre Bewohner produzieren Unmengen von Abgasen und Müll, der Verkehr kommt immer öfter zum Erliegen. Die Tendenz der Zunahme der städtischen Bevölkerung verlangt Gegenentwürfe zu Fehlentwicklungen, die auf Bedingungen überholter städtischer Realitäten beruhen. In Morgenstadt sammeln Hans-Jörg Bullinger und die Wissenschaftsjournalistin Brigitte Röthlein Visionen, wie Städte effizienter gestaltet werden und vom Problemfall zum Zentrum der Lösung etlicher Probleme werden können. In der Zukunft sollen die Probleme von Megastädten und Ballungsräumen vor allem mit dem Einsatz modernster Technologie angegangen werden.
Nach einer kurzen Skizze der dringlichsten Herausforderungen werden Lösungen vorgestellt. Diese könnten nicht nur für asiatische und afrikanische Megastädte, sondern auch für europäische Großstädte relevant sein. Inwiefern unser individuell hoher Flächenanspruch dabei künftig aufrecht zu halten sein wird, muss sich zeigen. Ziel ist es, positive Aspekte der Stadt, wie kurze Wege, Kulturvielfalt oder gute Kommunikationsmöglichkeiten zu erhalten und gleichzeitig neue Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen. In der Morgenstadt sollen Stadtviertel Strom und Wärme selbst erzeugen und Elektroautos auch als Stromspeicher dienen. Menschen wohnen in intelligenten Häusern, die für umweltverträglichen Komfort und Sicherheit sorgen. Die einzelnen Kapitel des Buches widmen sich u.a. den Themen Energie, Wasser, Bauen und Wohnen, Ernährung und Gesundheit, Mobilität, Sicherheit, Arbeitswelt und Kommunikation.
Sicherheit und Kunstlicht
Vorhandene städtische Strukturen an neue Anforderungen anzupassen dürfte insgesamt schwieriger werden, als neue Superstädte, wie die Null-Emissionsstadt Masdar City am persischen Golf aus dem Sand zu stampfen. Das Buch konzentriert sich dabei auf die Möglichkeiten einer ökologisch verträglichen, nachhaltigen Urbanisierung, wobei die Tätigkeiten des Fraunhofer Instituts aus verständlichen Gründen im Vordergrund stehen. Bereits Realität ist das 2012 eröffnete Zentrum für virtuelles Engineering des Fraunhofer IAO in Stuttgart. Das futuristische Gebäude ist mit zukunftsweisenden Laboren und Bürowelten ausgestattet und soll als Plattform für die Erforschung und Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien dienen.
Das Buch Morgenstadt beschäftigt sich vor allem mit technologischen Aspekten. Die Frage, wie diese für breite Bevölkerungsschichten umsetzbar und bezahlbar sein können, wie die Städte auch für Kinder und alte Menschen ein angemessenes Umfeld bieten können und wie die Errungenschaften des urbanen Menschen mit anderen globalen Anforderungen verbunden werden können, wird natürlich auch andere Disziplinen und viele weitere helle Köpfe beschäftigen müssen. Ob Sicherheit durch Biometrie, »Smart homes« und Kunstlicht, das wie Tageslicht wirkt, wirklich zentral sind für eine lebenswerte Umgebung, bleibt zu diskutieren. Oder anders: Wer ist das »wir« in Wie wir morgen leben (wollen)?
| TOM ASAM
Titelangaben
Hans-Jörg Bullinger/ Brigitte Röthlein: Morgenstadt. Wie wir morgen leben
Hanser, 286 Seiten, 24,90 Euro