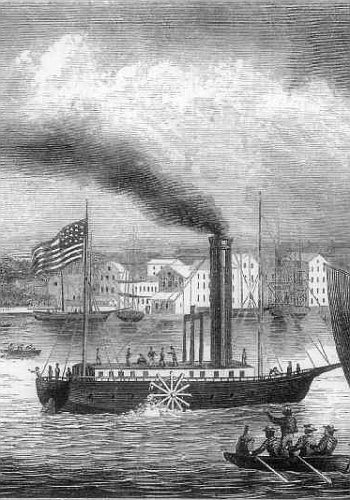Der Grazer Autor Mike Markart legt in seinem neuen Erzählband Magritte eine Sammlung von Kurztexten vor, in der mehr als nur eine literarische Begleitstimme zu Bildern des großen Surrealisten entsteht: Markart lädt ein zu einer ganz erstaunlichen Ausstellung. Ein Rundgang mit HUBERT HOLZMANN.
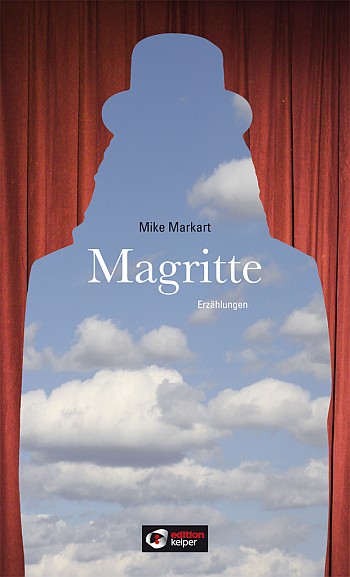
In seinem Magritte-Band stellt der Schriftsteller Mike Markart, der seit den 80ern zahlreiche Lyrikbände vorgelegt und Hörspiele u.a. für den ORF produziert hat, Kurzprosa aus fünf Jahren zusammen, die in ihrer stilistischen Ausarbeitung sehr geschlossen wirken. Der gesamte Band – und nicht nur die ersten sechs Magritte-Texte selbst – wird von einer sehr starken Bildlichkeit bestimmt. Er präsentiert hier Miniaturen, zeichnet darin einzelne, klare Motive, doch diese Einfachheit scheint nur auf den ersten Blick bestätigt.
Einen ersten deutlichen Akzent setzen die sechs Texte zu Beginn der Sammlung, die im Untertitel auf ein Bild von Réne Magritte verweisen und fast noch wie eine Art Fingerübung scheinen, treffen sie doch im Tonfall Magrittes surrealistische Traumwelten aus seiner ersten stilbildenden Anfangszeit um 1926. Von Markart werden diese Gemälde gespiegelt, gedoppelt – und doch bezeichnenderweise eigentlich nur gestreift, Bildmotive wie die grauen Männer mit Melonen aus Der Monat der Weinlese oder die mit Tüchern verhüllten Gesichter zitiert, die Bildkomposition jedoch neu gedeutet.
»Eingeschlagen in Eichenbrettern«
Markart verfasst keine Schilderungen, Nacherzählungen, Assonanzen zu Magrittes Bildern – der Künstler ist weit entfernt von kreativen Schreibwerkstätten – es entstehen Deutungen, Gegenbilder, eigene Traumwelten. Gleich der erste Text »Offensichtlich kennen diese Menschen vom Fluss eine Stelle, wo das Wasser sich anheben lässt« (zu Magrittes Die Flussbewohner von 1926) geht über einen Paralleltext weit hinaus, nimmt die Vorlage nur als Anstoß, verweist auf sie, beobachtet die Außenwelt, nimmt den Beobachter hinzu, der in seiner Welt durcheinander gerät. Markart verstört in seiner Literatur, das Normale wird zerstört. Das Außen läuft ab, ohne beeinflussbar zu sein. Jedoch auch im Innen ist das Ich isoliert. Abgeschnitten die zwei Welten. Ohne Begegnung. Entfernung und Rätsel.
Auch im zweiten Text »Nach dem Vorbild der großen Ordnung: Die in Eichenholz eingeschlagene Familie. Frachtfertige Menschen. Jener ideale Zustand« (Perspektiven II: Der Balkon von Manet, 1950) schreibt Markart das Bild weiter: setzt die Serie von Zitaten fort. Von Manet zu Magritte zu Markart. Doch er treibt damit kein harmloses Spiel, keine bloße Verdoppelung. Sitzt im impressionistischen Urbild noch eine dreiköpfige »heilige« Familie – in bester hierarchischer Ordnung; Vater, Mutter, Tochter sind ausgestellt – wurden diese von Magritte in Eichenbretter eingesargt. Auch Markart greift dies als Zitat auf. Der Grazer Dichter setzt aber auch hier den Außenblick, eine Ich-Perspektive hinzu: als flüchtenden, ausbrechenden Vogel. Die Reminiszenz an österreichische Morbidität erwacht hier sofort. Als Hinweis, eine Widmung vielleicht. Markarts Sprache ist jedenfalls deutlich: »Jemand betritt mein Blickfeld und er ist in Eichenholz eingeschlagen, also tot und frachtfertig und in einem idealen Zustand.«
Aber so düster klingt Markart nicht immer: In der Geschichte »Zuerst er, dann die Diagonale der Leine, dann die Frau« (Der Befreier, 1947) macht das reisende Ich eine kuriose Erfahrung, und zwar erneut als ausdauernder Betrachter: »Monatelang bin ich am Fenster gestanden, habe hinuntergesehen auf den Park, den Zaun. Und jenseits des Zauns habe ich mir dieses Haus vorgestellt.« Und dann fängt dieser Blick eine Bewegung auf und es zieht ein seltsam wunderbarer Zug von Hund, Leine und Frau vor seinen Augen vorbei. Als Impuls an jenem Haus, das die Frau bewohnt, schließlich auch anzuklopfen.
Die Fortsetzung ist dann nicht mehr ganz so irreal und unwirklich gebrochen: Der vierte Kurztext zu Magrittes Die Liebenden, 1928 zeigt den Ich-Erzähler mit einer Frau im intimen Tête-à-tête. Wurden von Magritte die Köpfe der Liebenden noch mit Linnen umhüllt, so entblättert Markart die Geliebte, er »streift ihr das Kleid von den Schultern«. Doch mit welcher Absicht? Mit welchem Grund? Die männliche Geste wird nämlich sogleich relativiert, »rinnt« doch das Kleid »zu Boden, und in dem See, in diesen weichen, roten Wellen, gehen wir von Bord«. Das Allzumenschliche scheint hier – allerdings merklich bedrohlicher – mit Isolde zu versinken.
Auch im Folgetext »Ich verreise, hatte ich zu ihr gesagt, ich fahre in den Norden« (Der bedrohte Mörder, 1926) verschärft sich die bedrohliche Traumwelt: Die Frau, die den Mann hintergeht, liegt bedrohlich auf dem Seziertisch. Das Opfer – alles minutiös geplant vom gehörnten Ehemann – liegt fast unschuldig, wehrlos, passiv da. Was ihr vielleicht noch fehlt? Die kleine Aster…
Italienbilder
Mit diesen Magritte-Texten stellt Mike Markart sein Programm auf, gibt die Linie vor, zeichnet wiederkehrende Motive. Dennoch verschiebt sich die Perspektive in den weiteren Texten leicht. Markart stellt seine Staffelei immer an etwas anderen Orten auf. Malt Italienbilder: Rom wird zum Traumort zweier Nachtwelten eines Träumenden, Suchenden (»Im Grunde genommen bin ich zufrieden, wenn die Dinge sind, wie sie sind«). »Ceci« spielt in einem kleinen italienischen Ort im römischen Hinterland. Markart erzählt hier eine Anekdote aus der Zeit seiner Großmutter: Ein weihnachtliches Kochduell mit Ceci, das sind Kichererbsen. Fast eine Parabel. Vielleicht auch die merkwürdige Zugfahrt durch Italien in »Campora 1990«.
Etwas anders akzentuiert ist die Erzählung »Io bevo oer non annegare. (Ich trinke an gegen das Ertrinken.)«. Beinahe liest sich der Text wie eine Persiflage oder Reminiszenz auf den Untergeher oder Holzfällen von Thomas Bernhard. Dieser 1989 verstorbene österreichische Autor ist hier der Informant eines aus Österreich Geflüchteten. Wie bei Bernhard wird hier über das Marode der Alpenrepublik hergezogen: Geschichte, Dirigenten, NS-Verstrickung: »In Südfrankreich, in der Nähe von Nizza, hat mir Thomas Bernhard von Österreichs Bergen erzählt. Von welchen ich selbst ja keine Vorstellung habe. Wir sind am Hafen gestanden und haben aufs Wasser hinausgesehen. Die Nazis, hat er gesagt, haben am Fuße der österreichischen Berge ihre großartigen Ideen gehabt.«
Gegen solch gleichermaßen realistischen Spaziergänge sind Texte wie »Ich bin ein Mahnmal und ein immerwährender Kalender« oder »An trüben Tagen erschrecke ich manchmal, wenn das Raumschiff plötzlich aus den Wolken hervorsticht. Groß wie ein Haus« Gegenentwürfe, die albtraumhaft, paranoid verstörend wirken. Dennoch beeindruckt auch hier die Schwerelosigkeit, die Leichtigkeit von Markarts Erzählweise. Er verknüpft Dinge, die nicht zusammenpassen, vergleichbar der surrealistischen Kompositionstechnik eines Magritte.
Auf die Erzählung »Das Duell« sei nur kurz hingewiesen, in der Markart die fatalistische Geschlossenheit eines zeitgenössischen Kleists-Textes wiederbelebt: die Auslöschung der ganzen Verwandschaft durch Kinobesuche. Leichtigkeit verliert sich hier ganz schnell wieder. Dazu tragen auch Texte bei, in der Markart einen Blick auf die Geschichte wirft. »Alles grau: Ihre Buntstifte. Ihre Augen. Ihr Mund« – eine Erinnerung an Sarajewo. Hier gibt es Verletzungen, Traumatisierungen. Doch bleibt auch im zweiten Teil des Erzählbandes Magritte die Perspektive immer auch ein wenig morbid, grotesk, kafkaesk.
Vor allem wenn Mike Markart Sequenzen der Alltäglichkeit mit Zwanghaftigkeit verknüpft: »Krammer«, der »auf einer mechanischen Schreibmaschine« schreibt, oder in »Todesursache: Körpersubstraktion durch im Kreis gehenden Denkvorgang«. Am Schluss bleibt nur noch eine Zahl: »Duocentosessantamilanovecentosessantatre« – eine Sequenzierung des Lebens. Alltägliches. Allzumenschliches. Eine aufregende Spurensuche.
Titelangaben
Mike Markart: Magritte
Graz: edition keiper 2012
216 Seiten. 16,50 Euro
Reinschauen
Leseprobe