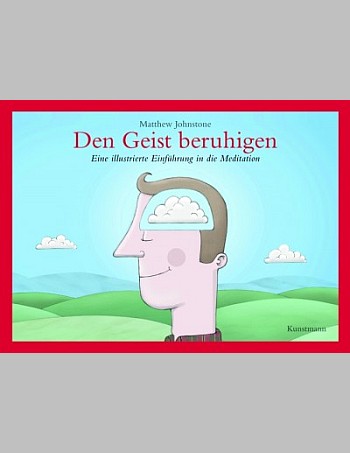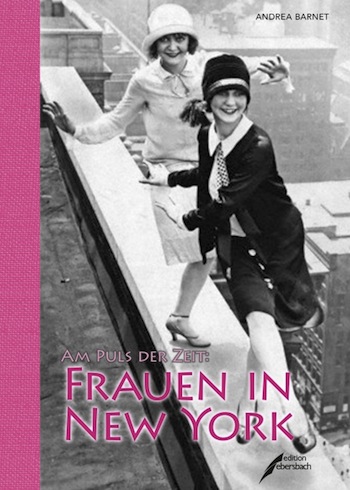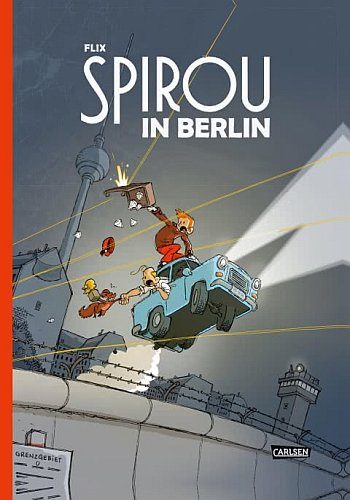Menschen | Hazel Rosenstrauch. Karl Huß. Der empfindsame Henker
Eine Biografie erfordert als Gegenstand eine Ausnahme, das Besondere, womöglich Exemplarische. Ein Scharfrichter in einer Zeit, in der die Todesstrafe nur noch selten verhängt oder überhaupt abgeschafft wurde, sein ehrloser Stand, der in sozialen Umwälzungen obsolet zu werden begann, und seine Wirkungsstätte, Eger/Cheb, das mit dem Ende des Alten deutschen Reichs zu einem neuen Staat, Österreich, geschlagen wurde, erfüllen die Voraussetzungen perfekt. Hazel Rosenstrauch, Kulturwissenschaftlerin aus Österreich, hat sich von dem speziellen Fall des letzten Scharfrichters von Eger zum Nachdenken und einem biografischen Essay Karl Huß. Der empfindsame Henker anregen lassen. Von MAGALI HEISSLER
 Die Lebenszeit von Karl Huß, von 1761 bis 1836, fällt in eine Epoche grundlegender Veränderungen, politisch, sozial, ökonomisch, denkerisch. Sie erfaßt ihn in besonderem Maß. Geboren in einer alten Henkersfamilie stirbt er als Kustos der wertvollen Sammlungen des Fürsten Metternich auf Schloß Königswart/Kynžwart. Ein unaufhaltsamer Aufstieg, also, vom unehrlichen, abseits der Gesellschaft lebenden Scharfrichter zum angesehen Mitglied der Gesellschaft. So scheint es jedenfalls.
Die Lebenszeit von Karl Huß, von 1761 bis 1836, fällt in eine Epoche grundlegender Veränderungen, politisch, sozial, ökonomisch, denkerisch. Sie erfaßt ihn in besonderem Maß. Geboren in einer alten Henkersfamilie stirbt er als Kustos der wertvollen Sammlungen des Fürsten Metternich auf Schloß Königswart/Kynžwart. Ein unaufhaltsamer Aufstieg, also, vom unehrlichen, abseits der Gesellschaft lebenden Scharfrichter zum angesehen Mitglied der Gesellschaft. So scheint es jedenfalls.
Eine Annäherung an Huß ist auf den ersten Blick einfach und unproblematisch. Er hat Zeugnisse seines Lebens hinterlassen, eine Autobiografie, eine Geschichte der Stadt Eger, sowie eine Schrift gegen den Aberglauben seiner Zeit. Auch andere äußern sich über ihn. Huß war neben seiner Tätigkeit als Scharfrichter zum einen als eine Art freier Arzt, als Heiler, tätig. Zum anderen war er ein leidenschaftlicher Sammler von Münzen, Antiquitäten und Mineralien. Sein Wohnort war von den drei Kurorten in unmittelbarer Nähe, Marienbad, Karlsbad, Franzensbad, gut erreichbar, Huß’ Sammlungen bekannt und bald ein Anziehungspunkt für interessierte Kurgäste, darunter Goethe. Für sie war Huß ein gebildeter und feinsinniger ‚empfindsamer’ Gesprächspartner.
Von den Schwierigkeiten, sein eigener Zeuge zu sein
Huß’ Lebenserinnerungen sind detailliert. Gleich, wonach man sucht, Kindheit, Familie, erste Schritte in den Scharfrichterberuf, Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses, sein Ringen mit dem aufgezwungenen Leben als Unehrlicher, der Drang, sich daraus zu befreien, man kann es nachlesen. Das Sammeln und Verwahren seiner geliebten Stücke, seine Eindrücke von der Gesellschaft, den Zeitläuften, vom Leben überhaupt, alles hat er notiert. Er ist gebildet, interessiert, aufgeklärt im Sinn seiner Epoche. Seine Schrift gegen den Aberglauben in den Köpfen seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen beweist es nachdrücklich. Aber er ist zugleich sein einziger Zeuge, es gibt keine direkten Vergleichsmöglichkeiten, kein Korrektiv. Die handschriftliche Autobiografie birgt den Fluch des Einzeldokuments in sich.
Was ist wahr an seinen Worten, wo ist er befangen? Wieweit kann man sich auf seine Erinnerungen und Einschätzungen verlassen? Schließlich sind es rein persönliche Meinungsäußerungen. Es ist schwer, die kleinen Sprünge, Risse, Unebenheiten herauszufiltern. Rosenstrauch stellt Fragen um Fragen an den Text in dem Bemühen, seine Aussagen zu überprüfen und sie in einen Kontext zu stellen. Um dem Menschen Huß nahe zu kommen. Es gelingt nur bedingt.
Dem Manko versucht Rosenstrauch durch eine ebenso detaillierte Beschreibung ihrer Forschungsreise nach Königswart, der heutigen Örtlichkeiten und ihren eigenen Überlegungen zu Huß zu begegnen. Das lenkt immer wieder von der Hautperson ab, nicht selten stark. Es macht die Lektüre nicht uninteressant, aber der Fokus verändert sich ständig.
Gründliche Arbeit, die ins Leere führt
Dem ehemaligen Scharfrichter seinen späteren Arbeitgeber, Klemens Fürst Metternich gegenüberzustellen, erweist sich zum Verständnis ebensowenig als hilfreich. Dies umso weniger, als Rosenstrauch dem schon bei Zeitgenossinnen und Zeitgenossen berühmten Charme Metternichs verfällt und sich verführen läßt, eine Darstellung seines Lebens zur Gänze geben, mehr als 20 Jahre über den Tod von Huß hinaus. Was sich daraus am ehesten ergibt, ist die Bedeutungslosigkeit von Karl Huß für diesen Fürsten, der in dem Maß am oberen Ende der Gesellschaft stand, wie Huß am unteren.
Huß, der unermüdliche Kämpfer um seine Würde, um Respekt von anderen, mag für Metternich ebensogut nur ein Kuriosum gewesen, ein Freak, das wertvollste, weil menschliche Stück in den Sammlungen, die zu betreuen er eingestellt wurde. Die Abhängigkeit des ehemaligen Scharfrichters von denen, die es ‚gut’ meinten mit ihm, bleibt, seine Freiheit ist eine strikt private. Draußen stehen die Schranken unverändert, Huß lebt mittelbar, befreit nur, wenn der Abglanz große Persönlichkeiten auf ihn fällt. Gleich, wie sehr sich die politische Landschaft geändert haben mochte, Huß ist auf die Gnade Höhergestellter angewiesen.
Der Abdruck einiger Seiten aus Huß’ Abhandlung über den Aberglauben macht Rosnestrauchs Essay farbiger, löst das Rätsel des Einzelfalls Huß’ aber auch nicht. Der letzte denkerische Sprung von Rosenstrauch, mit dem sie ihren Protagonisten zum Ahnherrn für Verfemte und Ausgestoßene küren will, ist willkürlich. Man kann ihr folgen oder auch nicht.
Der Essay ist gewiß interessante Lektüre, gelegentlich erhellend, führt aber trotz gründlicher Arbeit letztlich ins Nichts.
| MAGALI HEISSLER
Titelangaben
Hazel Rosenstrauch: Der empfindsame Henker
Berlin: Matthes und Seitz 2012
175 Seiten, 19,90 Euro