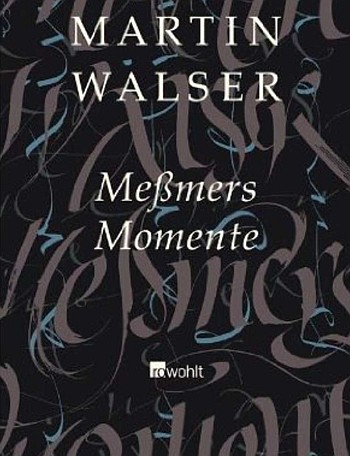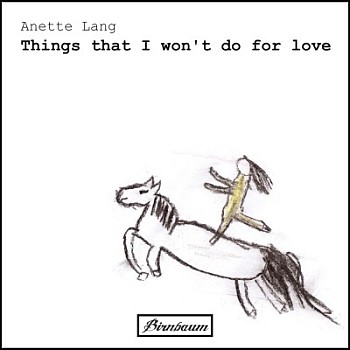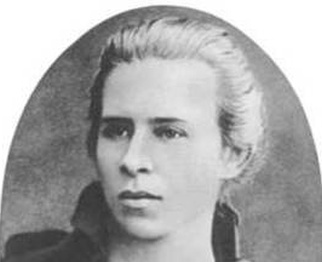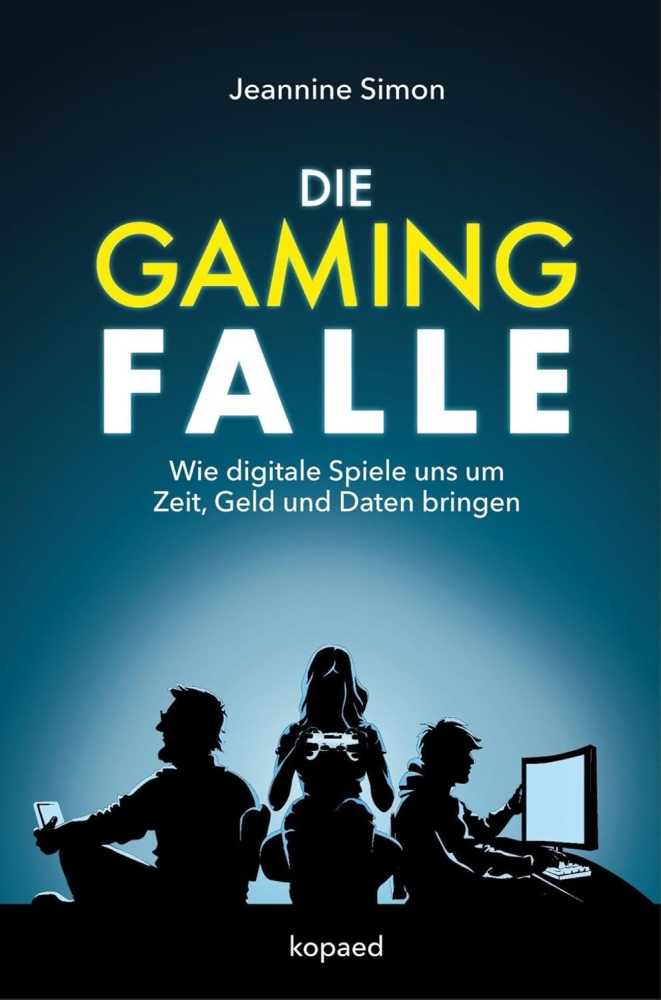Interview | Die brasilianische Autorin Carola Saavedra
Zu ihren literarischen Vorbildern zählen Roberto Bolańo, Jorge Luis Borges, W.G. Seebald und Thomas Bernhard. Die brasilianische Schriftstellerin Carola Saavedra befindet sich daher in guter Gesellschaft. Mit ihrem federleicht geschriebenen Roman Landschaft mit Dromedar stellt sie sich dem deutschen Lesepublikum vor. BETTINA GUTIÈRREZ hat mit ihr gesprochen.

Zehn Jahre, zwischen 1998 und 2008, hat die brasilianische Schriftstellerin Carola Saavedra in Europa, das heißt in Deutschland, Spanien und Frankreich verbracht, bevor sie nach Brasilien zurückging, wo sie heute lebt. »Portugiesisch ist meine Muttersprache und ich wollte unbedingt nach Brasilien zurückkehren, weil ich dort als Schriftstellerin immer erfolgreicher wurde. Mein Leben hat sich in Brasilien abgespielt und nicht hier, deshalb bin ich dorthin zurückgegangen«, sagt sie, wenn man sie nach den Gründen ihrer Rückkehr fragt.
Trotzdem sei dies eine Zeit gewesen, die sie entscheidend geprägt habe und der sie ihre Laufbahn als Schriftstellerin verdanke: »Wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, wäre ich keine Schriftstellerin geworden. Für mich bedeutet Schreiben, sich von sich selbst zu entfernen, also so zu sein wie ein Ausländer, wie jemand, der nach draußen schaut und die Ereignisse mit einer gewissen Distanz betrachtet. Es ist schwierig, wenn man sich inmitten der Ereignisse befindet, darüber zu schreiben. Außerdem finde ich, dass einem das Schreiben lehrt, sich in jemand anderen hineinzuversetzen und ihn zu verstehen. Das macht man auch, wenn man in einer anderen Kultur lebt. Man versucht nicht, sie zu beurteilen, sondern man versucht, sie zu verstehen.«
Angesichts der Tatsache, dass sie in Chile geboren ist, im frühen Kindesalter mit ihrer Familie nach Brasilien ging und zehn Jahre in Europa gelebt hat, misst sie der Frage nach der Zugehörigkeit zu einer Sprache und Kultur eine besondere Bedeutung bei, weshalb sie in diesem Zusammenhang davon spricht, dass ihr das Schreiben ein Zuhause und eine Heimat gegeben habe. Betrachtet man diesen biographischen Hintergrund, verwundert es nicht, dass sie das Motiv der Identität und des Fremdseins in ihren Werken literarisch verarbeitet.
Sie nennt es »das Gefühl des Andersseins, der Nicht-Zugehörigkeit und der Einsamkeit«, ein Gefühl, das ihrer Meinung nach bezeichnend für die Rolle des Ausländers sei und sich vor allem in ihren Kurzgeschichten Do lado de fora (»Von außen betrachtet«; 2005) widerspiegele: »Das vordergründige Thema dieser Kurzgeschichten ist die Einsamkeit. Alle meine Protagonisten sind sehr einsam, sie haben große Schwierigkeiten Gefühle zu zeigen und zu fühlen. Sie sind in sich selbst versteinert . Das hängt aber nicht nur mit dem Ausländersein, sondern auch mit unserer heutigen Gesellschaft zusammen. Wir leben in einer Welt, in der wir uns immer mehr isolieren, in der wir immer weniger auf den anderen angewiesen sind«, erläutert sie das Anliegen ihrer Geschichten.
Auch in ihrem ersten Roman Toda terça (»Jeden Dienstag«; 2007) befasst sie sich mit dem Bewusstsein der Fremdheit, indem sie ihre Erfahrungen in Deutschland in den Erlebnissen ihres Protagonisten Javier verdichtet. Es ist ein Roman, in dem drei Protagonisten aus ihrer eigenen Perspektive jeweils drei verschieden Geschichten erzählen. Alle drei Protagonisten zeichnet ihre Unfähigkeit aus, sich auf andere Menschen einzulassen.
Ihr jüngster hierzulande erschienener Roman Landschaft mit Dromedar, der mit dem renommierten Rachel de Queiroz-Preis ausgezeichnet wurde, ist allerdings nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen. Hier schildert sie die Dreiecksbeziehung zwischen Érika, Alex und Karen, die durch den Tod Karens beendet wird, und sie lässt ihre Ich-Erzählerin Érika über sich selbst, ihre Kunst und den Ursprung aller Dinge reflektieren, um sie am am Ende sozusagen ins Nichts zu entlassen.
»Das Buch handelt von einem Künstlerpaar, von Érika und Alex, und von Érika als Frau, die über ihre Kunst reflektiert. Es handelt aber auch vom Tod und von der Trauer, da Érika den Tod von Karen verarbeiten muss. Die reflexiven Passagen beziehen sich auf meine beiden Hauptthemen, die Liebe und den Tod. Es gibt einen Moment, in dem Erika sagt, dass sie niemanden liebt und geliebt hat. Das ist das Tragischste, was einem Menschen passieren kann. Aber es ist auch ein optimistisches Buch, weil Érika ihren Weg geht und dieses Nichts, in das sie am Ende geht, ein neuer Anfang für sie sein könnte«, lautet die allgemeingültigere Deutung dieses Läuterungsprozesses ihrer Protagonistin. Wohin sie dieser Prozess führt, bleibt jedoch offen.
Oder, um es mit den Worten Carola Saavedras zu sagen: »Meine Geschichten und Romane sind nie fertig. Es ist der Leser, der die Geschichte mitschreiben, mitdenken und sich seine eigene Version überlegen soll.« Das ist eine Aufforderung, der man nach dieser Lektüre gerne folgt.
| BETTINA GUTIÈRREZ
Titelangaben
Carola Saavedra: Landschaft mit Dromedar
Aus dem Portugiesischen von Maria Hummitzsch
München: Beck Verlag 2013
176 Seiten. 17, 95 Euro