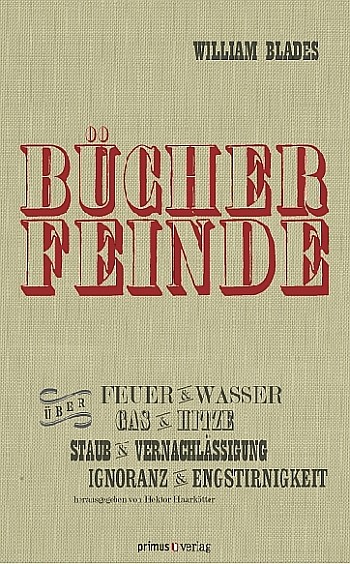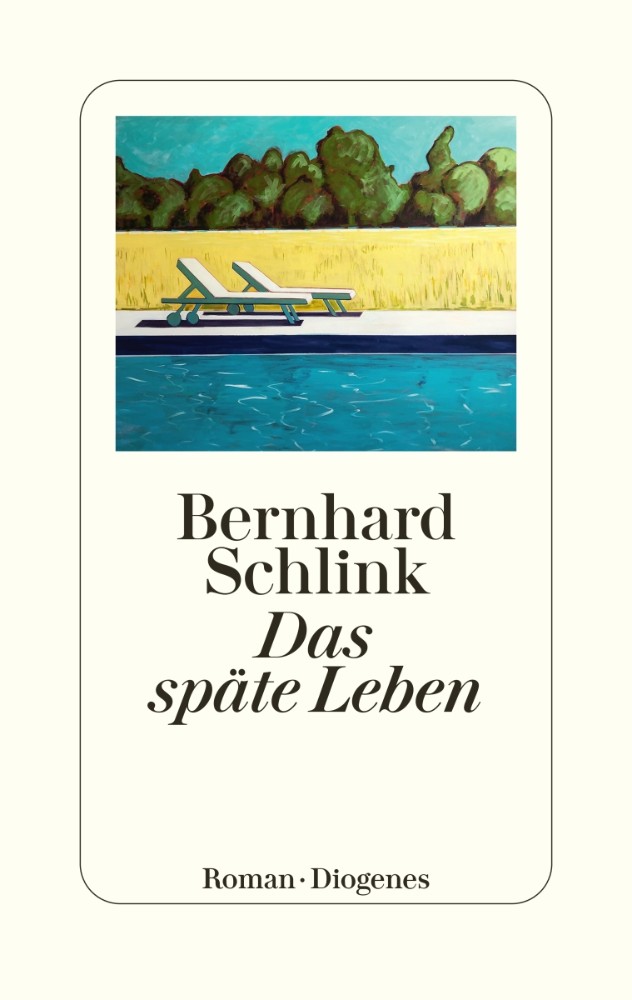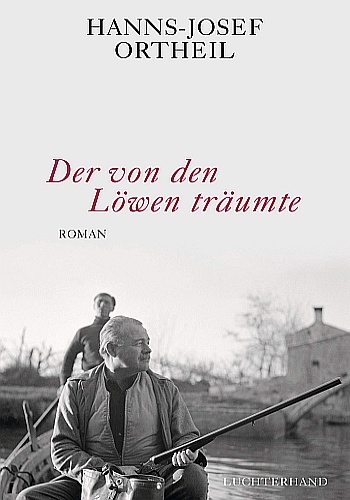Roman | Michel Bergmann: Herr Klee und Herr Feld
Mit seinem dritten Band Herr Klee und Herr Feld hält gediegene Bürgerlichkeit Einzug in Michel Bergmanns Frankfurter Trilogie: Stellenweise blitzt zwar die gewohnte Mischung aus Esprit und Absurdität auf, dennoch plätschert dieser Teil über weite Strecken eher im staatstragenden Parlieren dahin. Michel Bergmann erzählt vom jüdischen Leben als Teil Deutschlands. HUBERT HOLZMANN hat die humorvollen Pointen durchaus genossen.
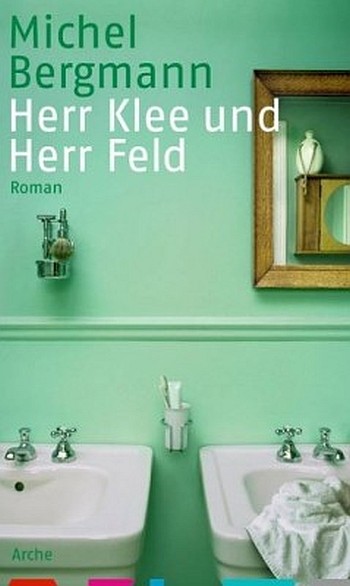
Der Frankfurter Autor und Filmemacher Michel Bergmann schließt seine Geschichte der »Teilacher«, der jüdischen Handelsvertreter, die nach dem Krieg in Frankfurt wieder Fuß fassten, mit einem liebevoll gestalteten Kabinettstück über die beiden jüdischen Brüder Moritz (77) und Alfred (75) Kleefeld ab. Die zwei Brüder, die zusammen in einer Frankfurter Stadtvilla wohnen, sind grundverschieden: Moritz ein emeritierter Professor für Psychologie, Alfred der ehemalige Filmheld und Dracula-Darsteller »Freddy Clay«, ein Lebemann und vor allem ein nicht uneitler Selbstdarsteller. Beide auf jeden Fall extrem hypochondrisch.
Bergmann startet seine Erzählung mit einem kleinen Paukenschlag, jedenfalls bedeutet es dies für die beiden Brüder: ihre langjährige Haushälterin, Frau Stöcklein kündigt ihren Dienst bei den beiden Männern auf. Chaos bricht aus, eine Neue muss her. Schließlich geben sie eine Annonce auf und laden eine ganze Reihe von Bewerberinnen ein. Nummer 14 ist endlich die Richtige: Zamira, eine Palästinenserin. Damit ist das Spannungsfeld überrissen.
Zamira mischt auf
Die neue Haushaltshilfe Zamira ist perfekt: jung, hübsch, patent. Absolut die Richtige. Und auch nicht ganz ohne Geschichte. Denn als junge Frau musste sie aus ihrer Heimat fliehen, auch ihr Vater ermordet. Von extremistischen Palästinensern erschossen. Jetzt ist sie eigentlich erneut auf der Flucht. Aus Berlin. Von ihrem Typen, mit dem sie zusammenlebt und der sie schlägt.
Doch in der kleinen Dachwohnung ist sie sicher. Zamira dankbar. Und wie ein Wirbelwind – in doppelter Hinsicht. Denn für Herrn Klee und Herrn Feld bringt die palästinensische junge Dame nicht nur neuen Schwung ins Haus, sondern einen neuen offensiv argumentativen Gegenpol zur politischen Sichtweise der beiden älteren jüdischen Herren.
Im Roman Herr Klee und Herr Feld ist Zamira dennoch eine fast schablonenhafte Spielfigur, durch deren Handeln die Gegensätze der beiden Brüder stärker hervortreten, die als Zuhörerin für die Kleefeldschen Geschichten dient und natürlich in jüdische Traditionen eingeführt wird. Bergmann kann durch sie verdeutlichen, polemisieren, ausgleichen. So lebt der Schabbes, was im Jiddischen Sabbath bedeutet, wieder auf, werden jüdische Feste gefeiert, Rituale gedeutet.
Freddy hat den Dreh raus
In diesem Frühjahr 2013 starten die Dreharbeiten zur Verfilmung von Bergmanns ersten Band Die Teilacher (2010) unter der Regie von Sam Garbarski. Auch am Stil des Romans Herr Klee und Herr Feld wird deutlich, dass Michel Bergmann Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent in einer Person ist. So wird der Handlungsstrang immer wieder von kurzen Episoden, von Rückblenden, Erzählungen, Erinnerungen durchbrochen. Es wird der einstigen Teilacher gedacht. Moritz’ Zeit als Psychologieprofessor in Amerika wird erinnert und natürlich ersteht Alfreds große Zeit als Vampirdarsteller zu neuem Leben.
Alfred denkt an seinen Aushilfsjob beim Teppichhändler Fränkel, der in Machloikes eine wichtige Rolle spielt, Gedanken an seine Zeit als einer der ersten Frankfurter Pizzafahrer im umgebauten VW-Käfer werden wach. Und dann zieht es ihn zum Film. Eine Rolle ist ihm wie auf den Leib geschneidert: der Vampir – in seinen ersten Filmen noch als erotischer Verführer, später als beinahe abgehalfterter blutsaugender Urvater. In den unterschiedlichsten Einstellungen liegt Alfred alias »Freddy Clay« in den Armen einiger Filmdiven, lernt durch einen Zufall »Klaus Kinski kennen, der mit Liedern von François Villon tourte« und der ihm »den Tipp, nach Rom zu gehen« gibt, oder er wird auf einer Prag-Reise als ehemaliger Dracula-Darsteller von Studenten erkannt.
Eine wichtige Episode nimmt auch der Tod der Mutter und ihr Begräbnis auf dem jüdischen Friedhof in Nizza ein. Zamira ist also nicht allein für den Haushalt, das Kochen, Putzen, Waschen zuständig, sondern durch sie geht es um Größeres: um die Liebe, das Leben und den Tod. Während Zamira bezahlten Urlaub für einen Flug in ihre Heimat erhält, reisen die Brüder ins fränkische Zirndorf – auf den Spuren des Vaters – zum ehemaligen Haus der Familien, auf den Friedhof. Die Zeit vergeht und doch wird sich so manches wiederholen. Und auch die Stöcklein wird wiederkommen. Ein unterhaltsames, aber auch lehrreiches Buch. Ein kurzweiliges Lesevergnügen.
| HUBERT HOLZMANN
Titelangaben
Michel Bergmann: Herr Klee und Herr Feld
Zürich: Arche Verlag 2013
384 Seiten.19,95 Euro