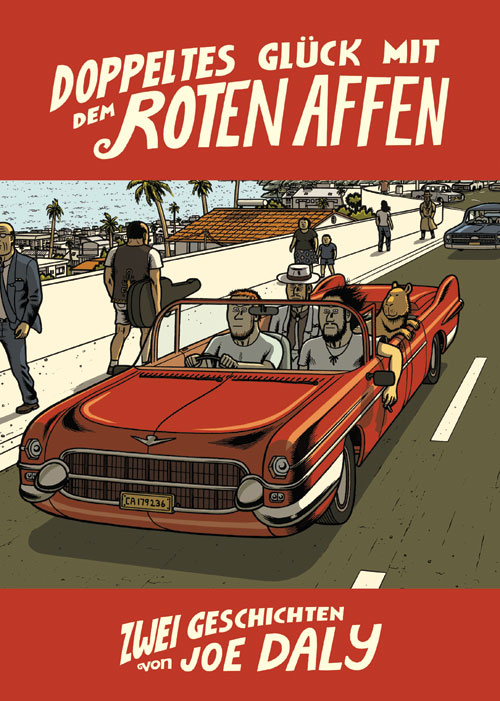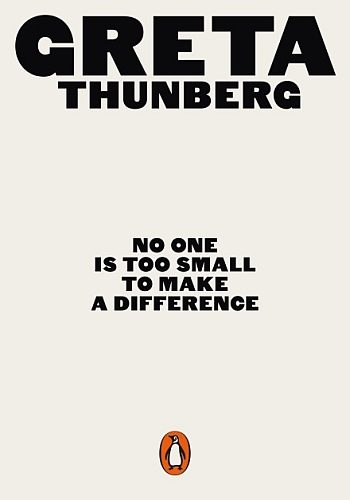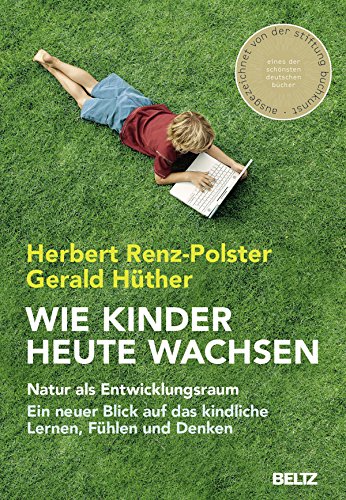Gesellschaft | Peter Köpf: Wo ist Lieutenant Adkins?
Von Wolf Biermann weiß man es und von Frau Merkels Eltern, ehemalige Bürgerinnen und Bürger der DDR werden sich auch an Dean Reed erinnern. Es gab nicht nur die Massenflucht aus der DDR nach Westen, es gab immer auch, wenn auch viel bescheidener, eine West-Ost-Wanderung in die DDR mit dem Ziel der Niederlassung. Auf West-Ost-Wanderer der besonderen Art macht Peter Köpfs Buch Wo ist Lieutenant Adkins? aufmerksam. Von PETER BLASTENBREI

Technisch gesehen waren diese etwa 200 Männer, die zwischen 1949 und dem Mauerbau 1961 in die DDR kamen, Deserteure, Überläufer aus einer der Armeen der NATO. Vielfach waren es US-Amerikaner, Briten, Franzosen, arabische Nordafrikaner im französischen Dienst, aber auch Niederländer, Iren, Spanier und ein Nigerianer. Fast alle waren kleine Rädchen im militärischen Getriebe gewesen. Damit war der Propagandawert ihres Übertritts bei weitem höher als der Wert mitgebrachter Informationen. Und diesen Propagandawert schlachtete die DDR jedes Mal genüsslich aus. Entsprechend giftig reagierten Westmedien auf solche Vorfälle: für sie waren diese Soldaten gewaltsam Verschleppte, Geistesgestörte oder Kriminelle.
Die Wahrheit war komplizierter. Wenige suchten den Weg nach Osten aus politischer Überzeugung (wie der titelgebende Leutnant Adkins) und weil sie sich in den USA der McCarthy-Jahre bedroht fühlten. Farbige Soldaten flohen vor dem Rassismus, der ihnen unmöglich machte, ihre weißen »Frauleins« nach Hause mitzubringen. Bei den meisten waren die Motive aber viel prosaischer: Furcht vor einem Einsatz in Korea oder Indochina, Streit mit Vorgesetzten, Liebeskummer. Oft mehrere Motive durcheinander. Unteroffizier William Smallwood schließlich stolperte 1954 in Hessen im Vollrausch über die Grüne Grenze.
Einmal in der DDR angekommen wurde der weitere Weg der Überläufer vom Ministerium für Staatssicherheit koordiniert. Der Autor schenkt seine Aufmerksamkeit zu Recht dem jungen Projektleiter Karl Schenk, einem intelligenten und erfindungsreichen Stasi-Offizier. Die Überläufer wurden zuerst in einer Villa am Müggelsee bei Berlin zusammengefasst, wo intensive Verhöre mögliche West-Spione herausfiltern sollten. Hinterher wurden sie von der allzu durchlässigen Westgrenze weg ins Hinterland der DDR verlegt. Ab 1951 wurden die Überläufer nach einer Idee von Schenks sowjetischem Führungsoffizier in Bautzen konzentriert, um sie gemeinsam durch Sprachkurse und politische Schulung für die »Auswilderung« in der DDR fit zu machen.
Provinz-Tristesse
Die Konzentration in Bautzen erwies sich als fataler Fehler. In der tristen, noch halbzerstörten Provinzstadt braute sich schnell ein dumpfes Klima aus Langeweile, Selbstmitleid, Misstrauen und Alkohol zusammen. Projektleiter Schenk versuchte, dem mit intensivem Unterricht und verbesserter Betreuung abzuhelfen – und stieß bei Partei und Behörden auf Desinteresse und Ablehnung. Von den zehn vom Autor ausgewählten Deserteuren starb einer nach einer Kneipenschlägerei, zwei begingen Selbstmord. Eine Fluchthelferorganisation schleuste mehrere »Bautzener« in den Westen, andere musste die DDR wegen hoffnungsloser Integrationsunfähigkeit selbst abschieben.
Gescheiterte Lebensläufe also, die Köpf hier vorstellt, denn selbstverständlich warteten auf die Rückkehrer Militärgerichte und mehrjährige Haftstrafen. Aber ist das das ganze Bild? Wie hätte im Kontrast dazu eine nach den Maßstäben der DDR und der Überläufer geglückte Niederlassung ausgesehen? Köpf erwähnt beiläufig für 1956 die Zahl von über 60 erfolgreichen Integrationen (S. 173). Gab es solche unauffälligen Lebensläufe bis 1989/90 und was wurde dann aus ihnen?
Falsche Richtung oder fatale Illusionen
Interessanter ist aber die Frage, warum viele Überläufer gescheitert sind. Köpf deutet an, dass Integration in einem totalitären Staat an sich kaum glücken kann (S. 12). Das überzeugt nicht ganz. Migranten aller Länder und Zeiten sind von Missständen zu Hause motiviert, nicht vom Ziel, über das in der Regel Illusionen herrschen. Nicht anders die Überläufer in die DDR. Mit zeitlichem Abstand verloren die heimischen Probleme an Schärfe. Heimweh, Trennung von Familie und Kameraden und das ungewohnte Milieu eines armen, im Aufbau befindlichen Staates gewannen täglich an Gewicht und ließen viele nur noch an Rückkehr denken.
Karl Schenk legte 1956 seinem Ministerium einen Bericht vor, in dem er Illusionen aufdeckte, die die DDR ihrerseits über ihre prospektiven Neubürger hegte. Anders als angenommen waren fast durchweg unpolitische Menschen gekommen, die oft genug simple Trotzreaktionen über die Grenze getrieben hatten. Leichtgläubig, wenig gebildet, oft ohne Berufsausbildung und persönlich labil hatten viele Überläufer von einem leichten und angenehmen Leben in der fernen neuen Heimat geträumt, legitimiert allein durch die Flucht. Das Scheitern ihrer Eingliederung in einen normalen Arbeitsprozess war damit so gut wie vorprogrammiert.
Köpf ist ein trotz seiner übermäßigen Detailverliebtheit spannendes und in vielen Passagen überraschendes Buch gelungen. Die DDR erscheint hier nicht als versteinertes, unbewegliches Gesellschaftssystem. Es wurde experimentiert und improvisiert, Fehler gemacht und (manchmal) korrigiert, Behörden rangen um Kompetenzen. Wie immer bei Büchern, die auf Material der ehemaligen Staatssicherheit basieren, ist man sich aber des Fehlens westlicher Geheimdienstquellen schmerzlich bewusst. Zumindest wüssten wir dann wohl, wo Leutnant Adkins ist. Denn der ist verschwunden, seitdem er im Mai 1963 den Übergang Berlin-Friedrichstraße Richtung Westen passierte.
| PETER BLASTENBREI
Titelangaben
Peter Köpf: Wo ist Lieutenant Adkins? Das Schicksal desertierter Nato-Soldaten in der DDR
Berlin: Ch. Links 2013
224 Seiten. 19,90 Euro