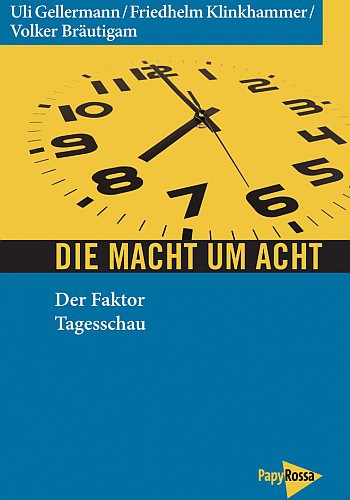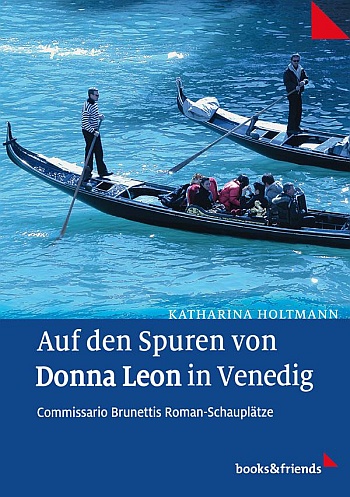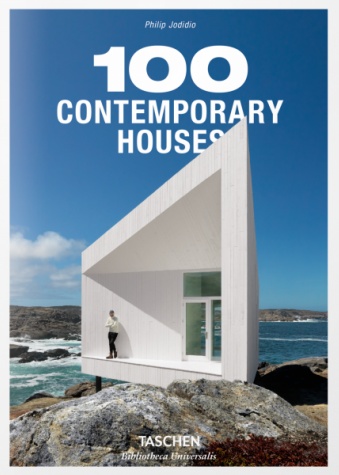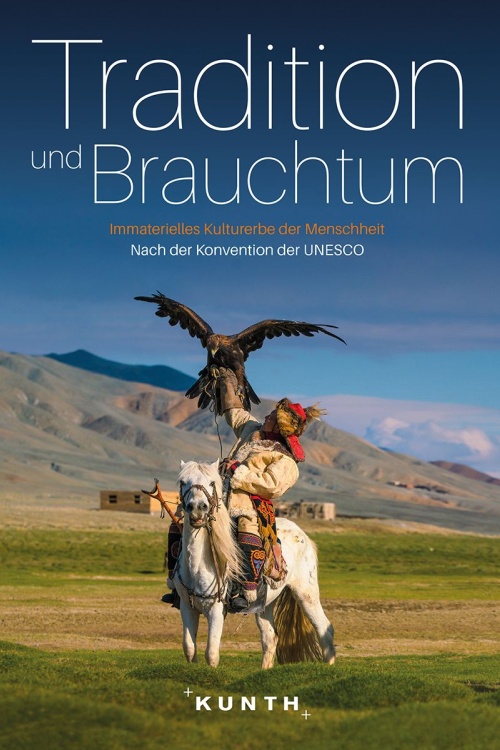Kulturbuch | Judith Herrin: Byzanz
Mehr als tausend Jahre hat es existiert, das byzantinische Reich. Neunzig Kaiserinnen und Kaiser, 125 Patriarchen, ein Machtbereich, der sich zu Hochzeiten vom Balkan bis zur arabischen Halbinsel erstreckte, Begegnung und Auseinandersetzung dreier religiöser Systeme, dem antiken Götterglaube, dem Christentum und dem Islam, intellektuelle und künstlerische Höchstleistungen, die einen heute noch staunen lassen, all das hat es vorzuweisen. Seine Spuren finden sich bis heute. Was hat dieses Reich trotz umwälzender Veränderungen überleben und so lange weiterwirken lassen? Judith Herrin, Archäologin und Byzantinistin, erzählt es mit Schwung und Leidenschaft in Byzanz. Die erstaunliche Geschichte eines mittelalterlichen Imperiums. Von MAGALI HEISSLER

Es sind zwei Gründe, die Herrin nach ihrer Emeritierung veranlasst haben, ein umfassendes Buch über ihr Fachgebiet zu schreiben, dem sie sich seit ihrer Studentinnenzeit in den 1970ern, zunächst in München, später dann als Wissenschaftlerin in Griechenland, der Türkei, den USA und zuletzt in England gewidmet hat. Der eine, der letzte Anstoß eigentlich, war die Frage zweier Bauarbeiter, die während eines Umbaus zufällig in ihrem Büro vorbeikamen, was dieses ‚Byzanz‘ denn sei. Sie schildert den Vorfall amüsiert und zugleich ein wenig betroffen darüber, wie wenig ihr Fach außerhalb der Wissenschaft bekannt ist. Energisch, wie sie ist, – auch das macht schon das ausführliche Vorwort klar – , widmet sie sich der Sache gründlich und umfassend.
Der zweite Grund ist etwas, das offenbar schon lange an ihr nagt. Das ist der Ausdruck ‚byzantine‘ im Englischen, mit dem alles beschrieben wird, was unnötig verwickelt, verkrustet, unflexibel ist. Byzanz, so Herrins Erkenntnis eines langen Forscherinnenlebens, war exakt das Gegenteil davon. Es ist ihr ein Bedürfnis, das klarzustellen. Und eben davon profitieren die Leserinnen und Leser ihres Buchs.
Herrin erzählt chronologisch in vier großen Kapiteln. Sie fügt politische, wirtschaftliche, geistes- und kulturgeschichtliche Entwicklungen zu einem großen Bild zusammen. Der Informationsfluss ist dicht. Herrin weiß jedoch genau, wovon sie spricht, sie hat ihre Fakten korrekt aufgereiht und kann deshalb die Schwerpunkte immer mit Blick auf das Interesse des Publikums setzen. Sie zeigt auf faszinierende Weise das Entstehen einer Kultur, die tatsächlich für einmal den Namen ›Schmelztiegel‹ verdient. Aus antikem Erbe, aufkommendem Christentum, ökonomischen und politischen Interessen entstand ein Reich von höchster Komplexität, das seine Riten dafür entwickelte und dazu einsetzte, unter allen Bedingungen lebensfähig zu bleiben. Es nahm auf, was es brauchen konnte, gab weiter, ohne jemals sein Selbstverständnis zu verlieren. Die günstige strategische Lage am Bosporus und das Gold, über das Byzanz verfügte, halfen. Aber sie waren es nicht allein. Herrin zeichnet ein sehr schlüssiges Bild eines Byzanz, das zudem fast siebenhundert Jahre lang Bollwerk war gegen den aufkommenden Islam, den es gleichermaßen bekämpfte, wie es in Grenzgebieten, etwa zum persischen Reich hin, eine friedliche Koexistenz lebte. Immer offen für Neues, änderte es nie seinen Kern. Andere Traditionen wurden eingeschmolzen und sich zu Nutze gemacht. Das gilt z. B. für persische höfische Sitten ebenso wie für die griechisch-antiken Texte, deren Weiterleben es damit sicherte. Und natürlich für das Christentum. Es war diese Konkurrenz zum ehemaligen Weströmischen Reich, das Byzanz 1204 im Vierten Kreuzzug seinen ersten großen Untergang brachte. Sein Selbstverständnis, das macht Herrin sehr deutlich, hielt es auch in seinen drei Teilreichen noch fast zweihundertfünfzig Jahre lang weiterhin am Leben.
Ein Staatswesen voller Lebendigkeit
Dem mittelalterlichen Byzanz ist der längste der vier Abschnitte gewidmet. Geistesgeschichte, Politik und Wirtschaftsgeschichte werden vorgestellt. Kosmopolitisch, belesen, philosophisch interessiert und geschult, handwerklich innovativ, rege im Handel, so stellt sich die byzantinische Gesellschaft vor. Spannend dabei die Rolle der Frauen der Oberschicht, die schon seit der Spätantike eine überraschend aktive war. Auch das ist ein Grund dafür, dass Byzanz in der Geschichtsschreibung gerade des 19. Jahrhunderts schlechte Karten hatte. Das Aufkommen des Begriffs ›in Purpur geboren‹, die Rolle der Eunuchen am Hof, der Einsatz der zweizinkigen kleinen Gabel bei Tisch und das Übernehmen der Hose als Männerkleidung aus dem Westen sind vor dem komplexen Hintergrund, den Herrin zeichnet, nicht mehr nur witzige Details einer längst verflossenen Vergangenheit, sondern überzeugende Belege für eine aufnahmebereite und entwicklungsfähige Gesellschaft und einem dazu passenden Staatswesen voller Lebendigkeit.
Für theologisch Interessierte, aber nicht nur, besonders spannend, ist die ausführliche Darstellung der religiösen Diskussionen etwa des späteren 14. Jahrhunderts zwischen Christentum und Islam. Und natürlich nimmt sie die Regensburger Rede Benedikts XVI. von 2006 auf – und widerlegt seinen Standpunkt.
Der Blick zurück kann nützen
Mindestens genauso spannend, wie die Geschichte von Byzanz, ist die Beschreibung der intellektuellen Auseinandersetzung, die die Autorin mit sich selbst als Erzählerin oder Berichterstatterin, das ist schon eine der Fragen, führt. Man trifft bei der Lektüre auf eine ausgeprägt kritische, höchst selbstkritische und zugleich leidenschaftliche Wissenschaftlerin. Die kurze Beschreibung ihrer Ausbildung und ihres Werdegangs wirft zugleich ein Schlaglicht auf die Entwicklung des ganzen Fachs, das über Jahrzehnte maßgeblich von Herrin geprägt wurde. Am Ende steht dann die Diskussion der Byzanz-Rezeption in der traditionellen englischen Geschichtsschreibung. Hier spürt man bei aller gewahrten Fairness noch einmal den Zorn von einer, die es gewagt hat, genau hinzusehen und einen Schatz entdeckt hat, den andere sich über Generationen bemühten, zu einem Schrotthaufen zu erklären. Der Blick zurück kann nützlich sein, sagt Herrin, gerade heute in einem Vielvölker-Europa. Sie beweist es mit ihrem faszinierenden Bild eines aktiven, innovativen, kreativen Staatswesens, dessen strenge Traditionswahrung und seltsame Riten nur ein Korsett für übersprudelndes Leben waren.
Im Anhang gibt es eine kleine Liste mit weiterführender Literatur zu den einzelnen Kapiteln, die vornehmlich englischsprachige Titel aufweist, aber dankenswerter Weise auch einige moderne deutsche nennt. Dazu gibt es eine Chronologie der Ereignisse, eine Liste der im Text genannten Kaiserinnen und Kaiser (was ein bißchen befremdet, weil auf diese Weise eine knappe Handvoll von ihnen nicht genannt wird), ein ausführliches Sach- und Namensregister und Landkarten. Warum den Leserinnen und Lesern hierzulande die Illustrationen, die die englische Ausgabe hat, vorenthalten wurden, muss man wohl zu den Arcana des deutschen Verlagswesens zählen. Schade drum.
| MAGALI HEISSLER
Titelangaben:
Judith Herrin: Byzanz. Die erstaunliche Geschichte eines mittelalterlichen Imperiums
(Byzantium. The Surprising Life of a Medieval Empire, 2007. Deutsch von Karin Schuler)
Stuttgart: Reclam 2013
416 Seiten. 29,95 Euro
Reinschauen