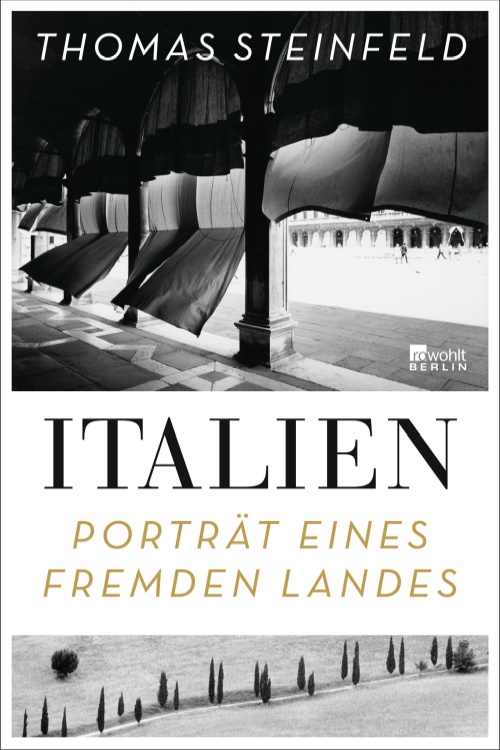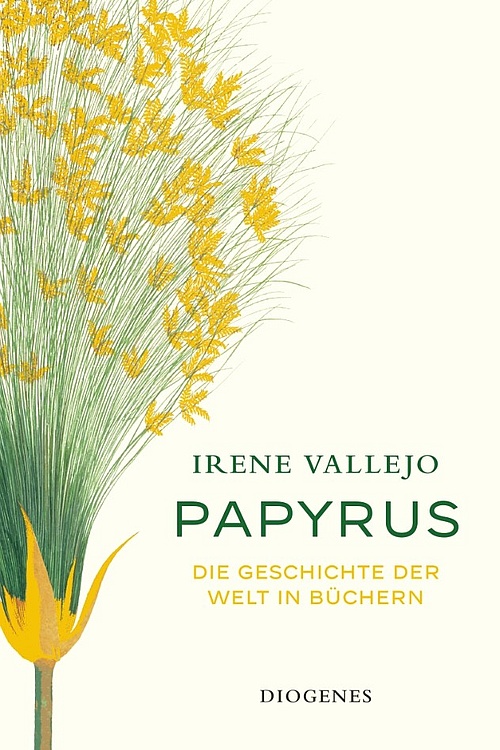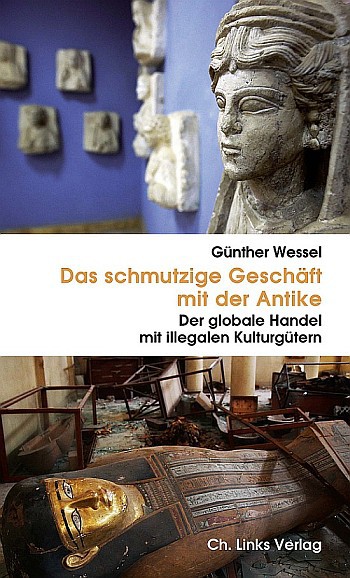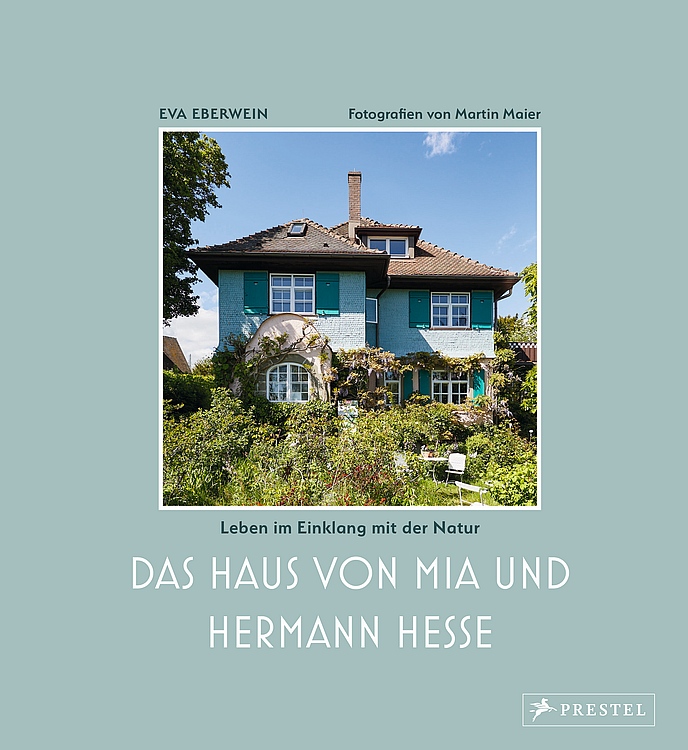Kulturbuch | Yoko Kawaguchi: Japanische Zen-Gärten
In ihrer Reduktion auf wenige, metaphorische Gestaltungselemente sind sie schlicht und beeindruckend zugleich: Japanische Zen-Gärten. Die Autorin Yoko Kawaguchi und der Fotograf Alex Ramsay präsentieren einen traumhaft schönen, höchst informativen Bildband zu Geschichte, Entstehung und Bedeutung dieser Anlagen. Von INGEBORG JAISER
Fein geharkter Marmorkies schlängelt sich wellenförmig über einen Innenhof. Kissenförmig geschnittene Azaleen schmiegen sich an eine Steinwand. Über eine Mauer ergießt sich ein Schwall blühender Kirschzweige. Ein dichter Moosteppich überzieht einen lang gestreckten Hügel. Eine verwitterte Steinplatte überspannt einen kleinen Teich. Drei Monolithen neigen sich wie im Gespräch einander zu.
Reduktion und Minimalismus
Die Ruhe und Ausgeglichenheit asiatischer Gärten beeindruckt seit Jahrhunderten: Adlige, Mönche, Besucher. Eine besondere Faszination geht vor allem von Zen-Gärten aus, die als Trockenlandschaftsgärten (»kare-sansui«) mit ihrer minimalistischen Reduktion und ihrer sparsamen Beschränkung auf wenige Gestaltungselemente weitgehend auf größere Pflanzen verzichten. Sie verstehen sich als idealisierte Darstellungen der Natur, dienen dem Entdecken und Erkennen, der Betrachtung und Meditation. Entstanden sind sie im Zusammenspiel von japanischen und chinesischen Traditionen der Kunst, meist im Umfeld von Tempeln des Zen-Buddhismus. Ihr einzigartiger Stil setzt sich noch heutzutage fort im prägenden Vorbild für zahlreiche zeitgenössische Gartenanlagen.
Seit langem beschäftigt sich die in Tokyo geborene Autorin Yoko Kawaguchi mit der Gestaltung und Geschichte von Gärten. In Japanische Zen-Gärten legt sie ihr profundes Wissen und ihr tiefes Verständnis auf nachvollziehbare Weise auch westlichen Lesern offen. Erklärt Symbolik und Interpretation, Hintergründe und Lesarten. Denn die Geisteshaltung, mit der man sich einem Zen-Garten nähert, ist von größter Bedeutung.
Kranich und Schildkröte
Mit beeindruckender Ausführlichkeit und großem Feingefühl stellt Yoko Kawaguchi eine Vielzahl meist historischer Beispiele vor und erläutert die wichtigsten Motive und Gestaltungselemente. So ist die Bildsprache japanischer Zen-Gärten sowohl auf eine buddhistische Kosmographie und Mythologie, als auch auf Fabeln und Allegorien zurückzuführen. Fein geharkter Kies erzeugt die Illusion einer weitläufigen Wasserfläche. Steinformationen stellen die Inseln der Unsterblichen dar, wobei Kranich und Schildkröte als Metaphern für langes Leben zu sehen sind. Auch Kompositionen mit drei Steinen sind beliebt – stehen sie doch traditionell für die Darstellung eines Buddhas mit zwei Begleitern.
Formvollendet werden Yoko Kawaguchis Texte von rund 140 eindrucksvollen Fotografien des international tätigen und vielfach ausgezeichneten Fotografen Alex Ramsay begleitet. Sie vermitteln stimmungsvolle, kontemplative Bilder der Atmosphäre traditioneller Zen-Gärten. Dabei spielt die Perspektive eine große Rolle, erschließt sich doch die angestrebte Panoramawirkung oftmals erst im Sitzen vollständig. Schematische Gartengrundrisse, ein historischer Abriss, fundiert recherchierte Adressen und Öffnungszeiten zahlreicher japanischer Tempelgärten, sowie ein ausführliches Glossar vervollständigen diesen opulenten und höchst informativen Bildband. Ein Traum für alle Gartenliebhaber und Anhänger fernöstlicher Philosophie.
| INGEBORG JAISER
Titelangaben
Yoko Kawaguchi: Japanische Zen-Gärten. Wege zur Kontemplation
Fotos von Alex Ramsay. Übersetzung von Claudia Arlinghaus
München: DVA 2014
207 Seiten. 49,99 Euro