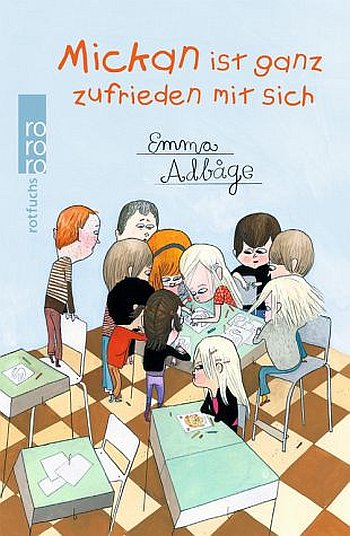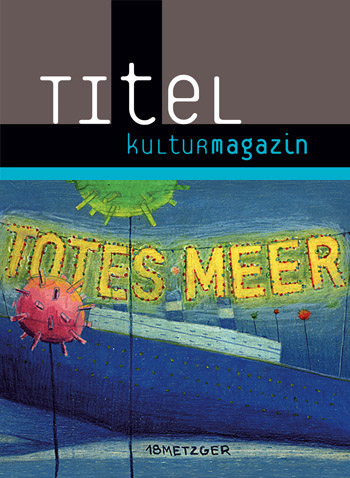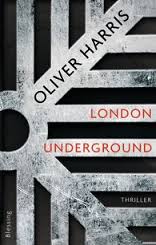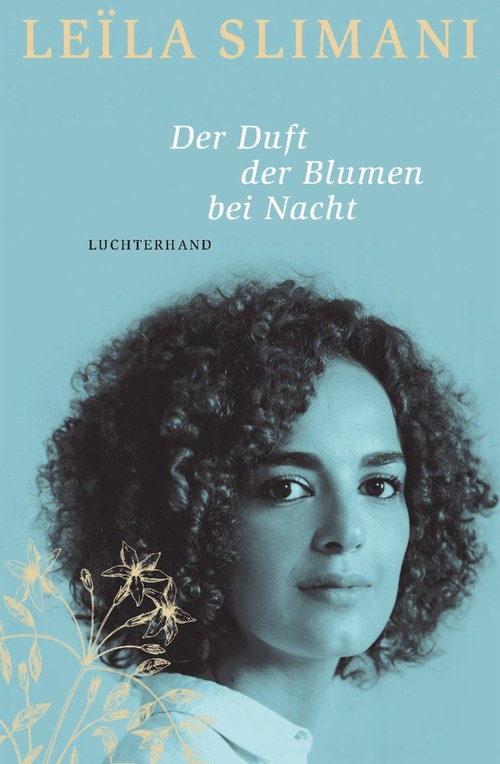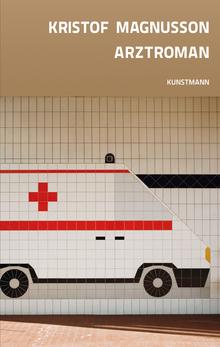Roman | Wilhelm Genazino: Bei Regen im Saal
Bei Regen im Saal – der neue Roman von Georg-Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino. Von PETER MOHR
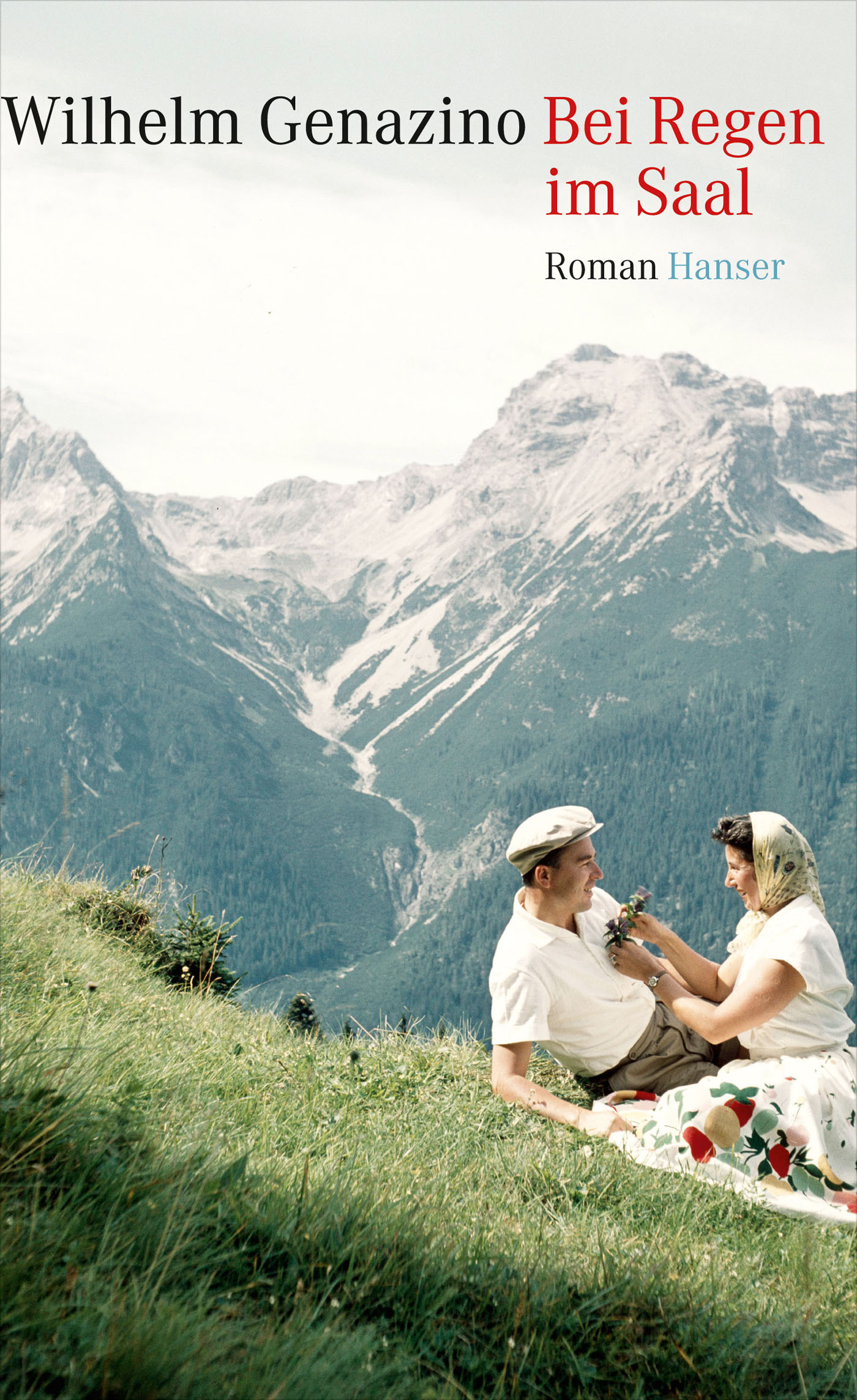 »Wenn ich mich genug geschämt habe, werde ich befreit sterben dürfen«, lautete eines der quälenden Selbstzeugnisse der Genazinofigur Gerhard Warlich aus dem Roman Das Glück in glücksfernen Zeiten (2010). Wir erinnern uns: Der promovierte Philosoph arbeitete mehr als ein Jahrzehnt in einer Wäscherei und landete (mit sich selbst im Einklang) am Ende in der Psychiatrie.
»Wenn ich mich genug geschämt habe, werde ich befreit sterben dürfen«, lautete eines der quälenden Selbstzeugnisse der Genazinofigur Gerhard Warlich aus dem Roman Das Glück in glücksfernen Zeiten (2010). Wir erinnern uns: Der promovierte Philosoph arbeitete mehr als ein Jahrzehnt in einer Wäscherei und landete (mit sich selbst im Einklang) am Ende in der Psychiatrie.
Dieses Schicksal bleibt dem neuen Genazino-Protagonisten Reinhard zwar erspart, aber ansonsten könnte er wahrhaftig ein Warlich-Zwillingsbruder sein – auch er promovierter Philosoph, auch er ein auf skurrile Weise gescheiterter Akademiker mit den aus den Vorgängerromanen bekannten Beziehungsproblemen.
Jener Reinhard ist Anfang vierzig und trägt in seinem tiefsten Innern durch seine dominante Mutter ausgelöste frühkindliche Schädigungen mit sich herum; er hat als Nachtwächter und Barkeeper gearbeitet, ehe er einen Job als Lokalredakteur beim Taunus-Anzeiger fand. Die Beziehung zu seiner Dauerfreundin Sonja, einer ehrgeizigen Finanzbeamtin, verläuft (kein Wunder!!) höchst kompliziert.
Die Genazino-Figuren lösen bei ihren Partnerinnen nämlich keine erotischen Gefühle aus, sondern wecken Mutterinstinkte und setzen Beschützerreflexe in Gang. Bei Sonja ist es ähnlich. Sie will seine Unterwäsche austauschen, sein äußeres Erscheinungsbild verändern und ist doch irgendwann erschöpft vom alltags-untauglichen Kantianer, der so gern an den Brüsten der Finanzbeamtin saugt, zieht die Beziehungsnotbremse und heiratet einen Kollegen.
Wie bei allen Genazino-Figuren ist auch bei Reinhard das Leben in eine leichte Schieflage geraten. Ein wackelnder Backenzahn, büschelweise ausgehende Haare, neben der Waschmaschine sterbende Nachtfalter: Es sind vermeintliche Marginalien, die sich aber sukzessive zu handfesten Störungen auswachsen und Reinhard etwa über eine Form der »Halbgeborenheit« reflektieren lassen.
Die Figuren des 71-jährigen Wilhelm Genazino pendeln stets zwischen Flaneur und Streuner, zwischen Müßiggänger und Penner. Sie sind keine lautstarken Weltverbesserer, sondern haben sich einen kommoden Mikrokosmos des Scheiterns eingerichtet. Ein wenig hilflos sind sie allemal, richtig unglücklich nicht, denn sie scheinen sich mit ihren Lebensverhältnissen arrangiert zu haben. So geht auch Reinhard mit großer Freude auf seine endlosen Spaziergänge durch Frankfurt.
Auch dahinter steckt ein bekanntes Genazino-System: Der Antiheld mit all seinen psychischen »Blessuren« entwickelt bei seinen »Touren« eine sehr selektive Wahrnehmung. Vor allem die negativen Dinge seines Lebensumfeldes stechen ihm ins Auge: die architektonische Sünden, leerstehende Ladenlokale, verfallende Häuser, unendliche Brachflächen. Diese von subtiler Beobachtungsgabe zeugenden Sequenzen lesen sich wie eine »Ästhetik« des Verfalls.
»Mein Leben verwandelte sich mehr und mehr in eine Elegie, an der ich allmählich Gefallen fand«, heißt es (völlig zutreffend) über die mal träumende, mal trauernde, zumeist jedoch in Selbstmitleid zerfließende Hauptfigur.
Erst durch ein überschwängliches Lob für seinen Roman Ein Regenschirm für einen Tag (2001) im »Literarischen Quartett« des ZDF wurde das Werk des Georg-Büchner-Preisträgers des Jahres 2004 einer größeren Öffentlichkeit bekannt. »Ich weiß selber keinen richtigen Grund dafür, warum ich jetzt auf einmal Erfolg habe«, bekannte Wilhelm Genazino in einem Interview.
Eigentlich hat er schon immer (seit seiner »Abschaffel«-Trilogie) auf hohem literarischem Niveau geschrieben, und immer schon standen liebenswerte, leicht skurrile »Verlierer« im Mittelpunkt seiner Romane, die stets eine Gratwanderung zwischen Komik und Tragik, zwischen Leid und Selbstmitleid, zwischen Verlierer und Verweigerer präsentierten.
Und irgendwie ist jener Reinhard aus Genazinos neuem Roman (wie all die anderen männlichen Anti-Helden aus den Vorgängerwerken) ein ganz enger Seelenverwandter von Dieter Rotmund aus dem Roman Mittelmäßiges Heimweh (2007), der auf die Frage nach seinem Wohlbefinden knapp antwortete: »Ich vereinsame gerade.« Nur drei Worte, ein Prozess der schmerzhaften Rückentwicklung, aber niemand kann dies so präzise in Worte kleiden und daraus so unglaublich berührende Romane komponieren wie Wilhelm Genazino.
Titelangaben
Wilhelm Genazino: Bei Regen im Saal
München: Carl Hanser Verlag 2014
158 Seiten. 17,90 Euro
Reinschauen
| Wilhelm Genazino in TITEL kulturmagazin