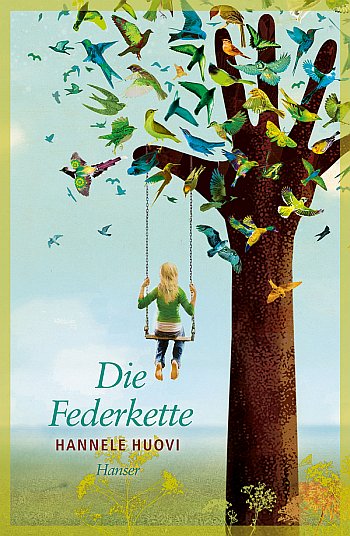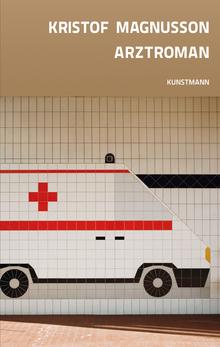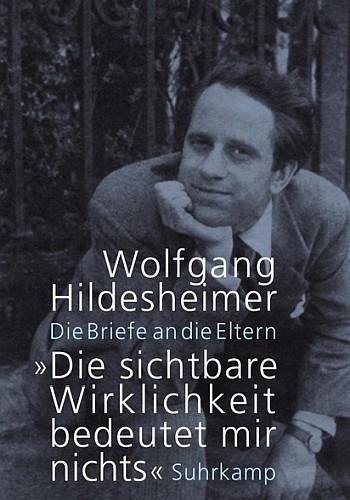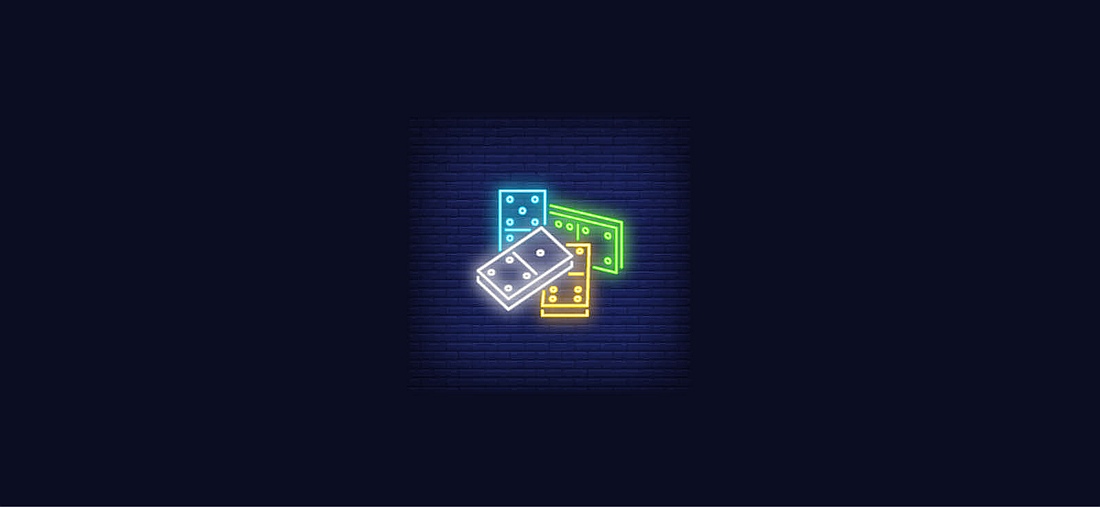Kurzprosa | Arthur Schnitzler: Später Ruhm
Im Wiener Zsolnay Verlag wird ein bislang unveröffentlichter Text des großen Wiener Dramatikers und Autors des Fin de Siècle Arthur Schnitzler aufgelegt: Der Wiener Autor selbst plante die frühe Novelle Später Ruhm aus dem Jahr 1894 zunächst in einer Zeitschrift zu veröffentlichen. Der Text wanderte schließlich in die Schublade und wurde erst jetzt aus dem Nachlass für die Nachwelt neu im Wiener Zsolnay Verlag aufgelegt. Von HUBERT HOLZMANN
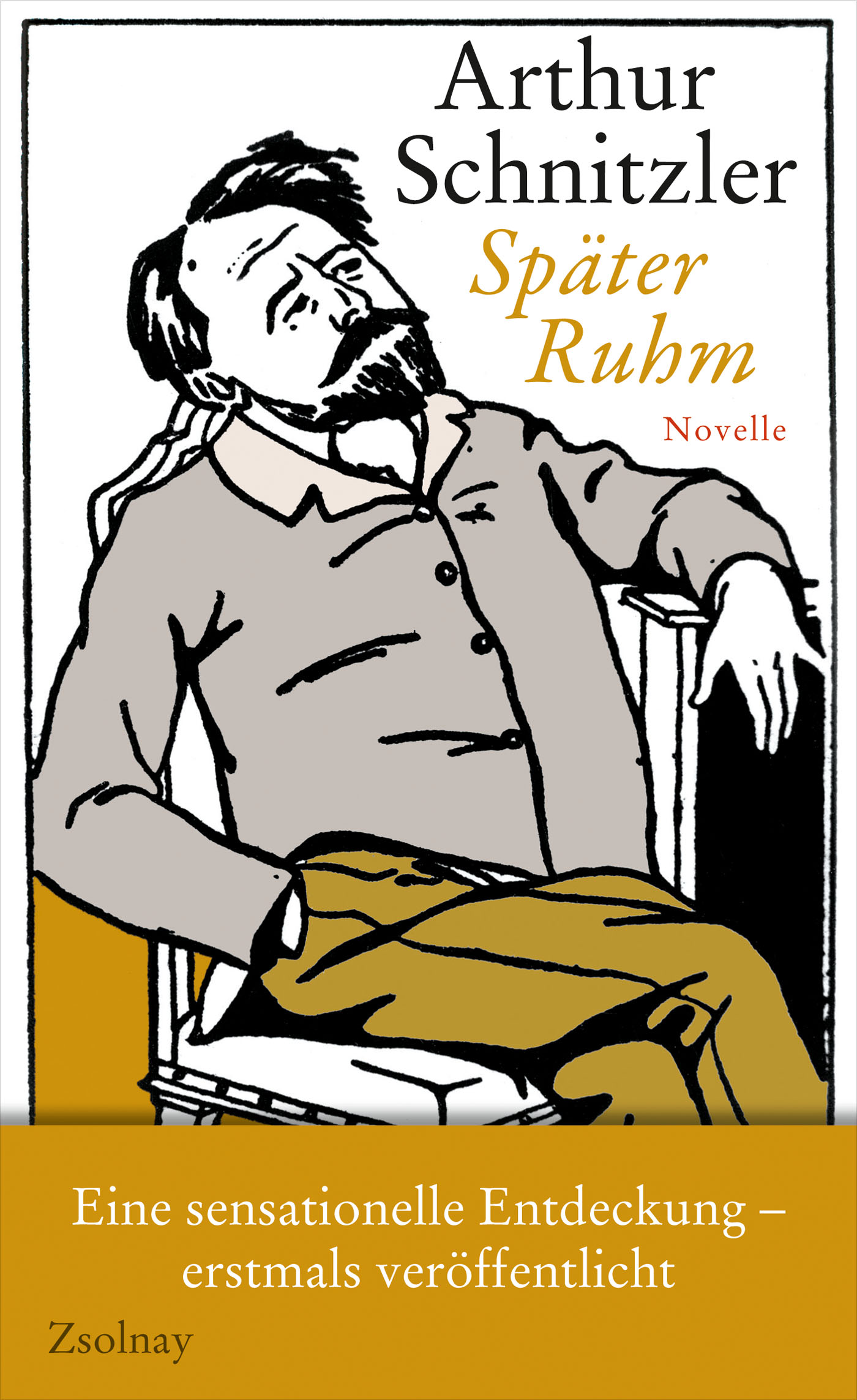 Arthur Schnitzler erzählt in seiner Novelle Später Ruhm, die er mit 32 Jahren, also in noch durchaus jungen Jahren, schreibt, vom alten Eduard Saxberger. Dieser alte Herr erinnert sich zurück an seine Jugend, in der er mit dem Lyrikbändchen »Die Wanderungen« in der Wiener Literaturszene reüssierte und auch durchaus einen Achtungserfolg erzielte.
Arthur Schnitzler erzählt in seiner Novelle Später Ruhm, die er mit 32 Jahren, also in noch durchaus jungen Jahren, schreibt, vom alten Eduard Saxberger. Dieser alte Herr erinnert sich zurück an seine Jugend, in der er mit dem Lyrikbändchen »Die Wanderungen« in der Wiener Literaturszene reüssierte und auch durchaus einen Achtungserfolg erzielte.
Dennoch entscheidet sich Saxberger gegen die Schriftstellerlaufbahn und schlägt schließlich doch als Beamter eine bürgerliche Karriere ein. Diese Ambivalenz von freiem Künstlertum und abgesicherter Existenz in einem bürgerlichen Beruf hat auch Schnitzler zeitlebens bewegt.
Erinnerungen ans Café Griensteidl
Doch eines Tages holt Saxberger die Vergangenheit ein. Er wird von einer Gruppe enthusiasmierter junger Männer, die sich selbst die »Begeisterten« nennen, – alles ambitionierte Jungdichter, die kurz vor der ersten Veröffentlichung stehen, einige »Möchtegern«-Theatermacher, die revolutionäre Ideen im Kopf haben, und vor allem Theoretiker sind – in seiner Wohnung »aufgestöbert« und für seine Dichtkunst geehrt. Und er wird von den Jungen eingeladen, an den Sitzungen ihres Schriftstellervereins teilzunehmen. All dies erinnert an die Kaffeehausrunden im Café Griensteidl um 1890, wo sich das junge Wien mit Schnitzler, Hugo von Hofmannstal, Felix Salten, Richard Beer-Hofmann und auch Hermann Bahr versammelte.
In der Novelle Später Ruhm besucht der alte Saxberger also die »Begeisterten« in ihrem Stammlokal, wird dort von den anwesenden Mitgliedern gefeiert und versucht sich in die Diskussionen einzumischen. Doch kann er mit ihren Plänen, Projekten, aberwitzigen Ideen kaum etwas anfangen. Denn zum einen ist die Altersdiskrepanz zwischen ihm und den Jungen riesig, zum anderen hat er selbst seine Produktivität längst begraben. All dies vermag er nicht zu äußern. Bewegt nimmt er zur Kenntnis, dass er bei einem literarischen Abend, der zur Frage nach der »wahren Kunst« geplant wird, der zentrale Programmpunkt sein soll. Mit Saxberger zusammen wollen die Jungdichter zum ersten Mal an die literarische Öffentlichkeit treten.
Bürger oder Künstler
Saxberger soll seine Gedichte aus den »Wanderungen« rezitieren. Allerdings wagt er sich nicht auf die Bühne. Den Vortrag der Texte übernimmt die recht adrette und kokette Schauspielerin Fräulein Ludwiga Gasteiner aus dem Kreis der Runde. Hinter dieser Figur verbirgt sich wohl die von Schnitzler und seinen literarischen Freunden umworbene Muse Adele Sandrock. Diese Schauspielerin versucht den alten Saxberger dazu zu animieren, wieder zu dichten. Saxberger will es noch einmal wissen.
»Am Nachmittag drauf setzte sich Saxberger an seinen Schreibtisch, lehnte sich in den Sessel zurück und dachte nach. Heute musste endlich mit der Dichtung für den Vortragsabend begonnen werden.« Doch der »Dichter« hat eine Schreibkrise. Das leere Blatt der »horror vacui«. Die eigenen Stimmungen bringt er nicht mehr zu Papier. »Er stand auf, er ging im Zimmer hin und her, er murmelte vor sich hin. Er wollte nach den einzelnen Worten haschen, die nicht stillhielten, die plötzlich wieder, kaum aufgetaucht, wie im Nebel zu verschwinden schienen.« Auch an den Orten der Vergangenheit wird er von der Muse nicht mehr geküsst. Die »Sturm und Drang«-Zeit Saxbergers ist uneinholbar entschwunden.
Der Leere in seinem Kopf will er in seinem eigenen Stammlokal entfliehen. Dort trifft er seine alten Bekannten; Schnitzler zieht diese Figuren aus der Wiener Klamottenkiste hervor: den »pensionierten Major«, den »Inhaber eines großen Delikatessengeschäftes«, »einen Gymnasiallehrer«. Als Saxberger dort auf seine Jugenddichtung zu sprechen kommt, ruft er absolutes Unverständnis bei den anderen Herren hervor und wird von ihnen nicht ernst genommen. Die Ambivalenz von Künstlertum und Spießbürgertum ist unüberbrückbar. Saxberger gehört keiner der Welten mehr an. Beinahe tragisch verlässt der Alte die angestammte Runde: »Nein – hierher wollte er nicht mehr kommen, wenigstens in der nächsten Zeit.«
Schnitzler selbst wandelt zwischen diesen beiden Welten. In der Figur des jungen Christians (er ist gerade 27 Jahre alt, »Tragödiendichter, Romantypus, lange Haare, fliegende Krawatte, etwas unstete Augen«) porträtiert er sich selbst, plagen ihn doch in den Jahren um die Entstehung der Novelle Später Ruhm noch großer Zweifel, ob er sich ganz der Schriftstellerei widmen soll – trotz erster Erfolge von Anatol (1893) oder von Liebelei (1895). Und diese Zweigleisigkeit wird Schnitzler in seinem Leben beibehalten: Neben dem Schreiben wird er seinen bürgerlichen Beruf als Arzt zeitlebens weiter ausüben.
Und trotz all dieser Zweifel überwiegt Schnitzlers Selbstironie: So unreif die jungen Dichter auch erscheinen – ihre Ideen und Pamphlete sind abstrus, die Titel ihrer Werke zeugen von einer gewissen Naivität –, so doppelbödig und humorvoll zeichnet Schnitzler die ganze Korona: So sehr sie auch Saxberger wegen seiner »Wanderungen« als ihren neuen Propheten stilisieren, so ist doch äußerst merkwürdig, dass niemand aus der Truppe überhaupt einen Blick in das Bändchen geworfen hat. Der literarische Abend bleibt dementsprechend extrem merkwürdig, denn auch hier wird das enthusiastische Presseecho von einem Kritiker aus der Gruppe verfasst. Arthur Schnitzlers Novelle Später Ruhm versammelt noch einmal die gesamte Wiener Moderne der Jahrhundertwende 1900 in einem durchaus ironischen Licht.
Titelangaben
Arthur Schnitzler: Später Ruhm
Wien: Zsolnay Verlag 2014
160 Seiten. 17,90 Euro
Reinhören
| Arthur Schnitzler: Später Ruhm gelesen von Udo Samel