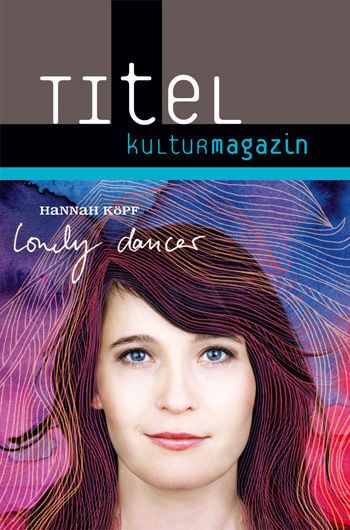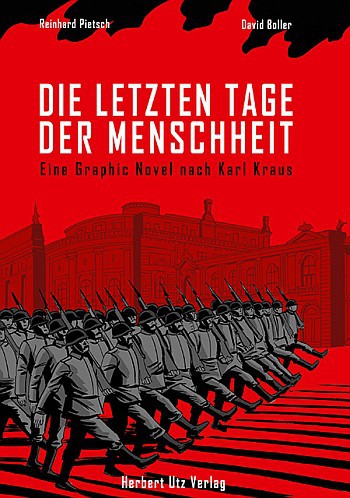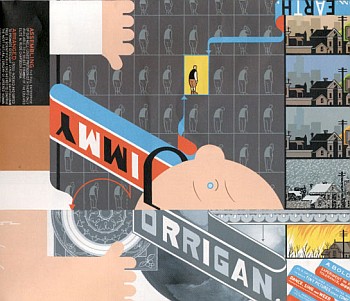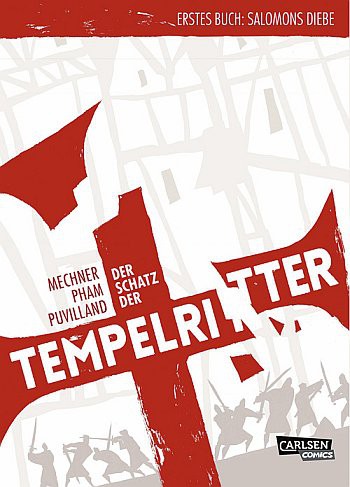Comic | Bernie Wrightson. Die ultimative Gesamtausgabe seiner Werke aus Creepy und Eerie
Der US-Verlag Warren stand von Ende der 1960er bis Anfang der 80er Jahre für »erwachsene« Horrormagazine abseits des bunten Comichefte-Markts. Er machte Zeichner groß, die oft Mühe gehabt hätten, im Hefte-Geschäft Fuß zu fassen, wo es allein darum ging, möglichst viele Seiten in möglichst kurzer Zeit zu produzieren. Einer von ihnen war Bernie Wrightson. ANDREAS ALT würdigt die jetzt erschienene Gesamtausgabe seiner Arbeiten für Warrens ›Creepy‹ und ›Eerie‹.
 Bernie Wrightson glaubt an die Wirkung des romantischen, gotischen Horrors. Seine Comics und Illustrationen sind an dieser Vorliebe sofort zu erkennen ebenso, wie an seiner ausgefeilten, enorm aufwendigen Schraffurtechnik und seinem Können im Umgang mit Licht und Schatten. Seine Monster wirken gleichermaßen erschreckend und mitleiderregend. Seine Helden sind ebenso nervlich überspannt wie die Protagonisten der Gruselgeschichten Edgar Allen Poes.
Bernie Wrightson glaubt an die Wirkung des romantischen, gotischen Horrors. Seine Comics und Illustrationen sind an dieser Vorliebe sofort zu erkennen ebenso, wie an seiner ausgefeilten, enorm aufwendigen Schraffurtechnik und seinem Können im Umgang mit Licht und Schatten. Seine Monster wirken gleichermaßen erschreckend und mitleiderregend. Seine Helden sind ebenso nervlich überspannt wie die Protagonisten der Gruselgeschichten Edgar Allen Poes.
In einem großformatigen, dicken Band sind nun alle Arbeiten Wrightsons für den Warren-Verlag gesammelt. Und doch ist es ein schmales Werk. In den Jahren 1974 bis 1978 hat er nicht mehr als sieben Kurzgeschichten für das Magazin ›Creepy‹ und fünf für ›Eerie‹ gestaltet. Hinzu kommen drei Magazincover und knapp 30 Einzelillustrationen. Offenbar hat er in diesen Jahren nicht viel mehr gezeichnet und doch von den Honoraren leben können.
Von Carmine Infantino entdeckt
Wrightson war eine Ausnahmeerscheinung im Comicgeschäft der 70er Jahre. Der 1948 in Baltimore geborene Zeichner hat sein Handwerk durch einen Fernkurs vervollkommnet, das auf Meisterillustratoren wie Norman Rockwell und Robert Fawcett zurückging. Zunächst arbeitete er als Pressezeichner für die ›Baltimore Sun‹. Von Jugend an war er jedoch auch von den EC-Horrorcomics fasziniert, und auf einer Comicmesse fiel er schließlich Carmine Infantino auf, der ihn nach New York und zu DC holte. Hier schuf Wrightson zusammen mit dem Autor Len Wein die Serie ›Swamp Thing‹, die bis heute für einen Gutteil seines Ruhms verantwortlich ist.
Immerhin zehn Ausgaben zeichnete Wrightson, aber er war kaum imstande, ein 20seitiges Comicheft in relativ kurzer Zeit fertigzustellen (auch wenn ›Swamp Thing‹ zweimonatlich erschien). Er steuerte auch Kurzgeschichten zu dem Horrormagazin ›House of Mystery‹ bei, aber der Wechsel zu Warren ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Wrightson hier keinen Zeitdruck hatte und auf einem größeren Format mit unterschiedlichen Schwarzweiß-Techniken nach Herzenslust experimentieren konnte. Der Farbdruck bei DC konnte damals wegen des stark holzhaltigen Papiers filigrane Zeichnungen regelrecht zerstören.
›Wir kamen, weil wir gern zeichneten‹
Es spricht für die Honorarpolitik von Verleger Jim Warren, dass der Künstler sich Zeit nehmen konnte und nicht zum Broterwerb Fließbandaufträge abarbeiten musste. Es ist bekannt, dass Warren wesentlich besser zahlte als die führenden Verlage wie DC oder Marvel. Bruce Jones, der zahlreiche Storys für Wrightson schrieb, erinnert sich jedoch im Vorwort zu diesem Sammelband: »Wir suchten weder Ruhm noch Reichtümer und hätten jeden ausgelacht, der behauptet hätte, dass Comics eines Tages hip wären, dass sogar Hollywood sich dafür interessieren würde. Wir kamen, weil wir gern zeichneten.« Mit »wir« meint Jones die ›Studio‹-Mitglieder Wrightson, Jeff Jones und Mike Kaluta, zu denen sich später noch Barry Windsor-Smith gesellte. Ein Jahr nach Wrightsons Ausscheiden bei Warren trat das ›Studio‹ ans Licht der Öffentlichkeit.
Jede der zwölf Storys in diesem Buch über Wrightsons Warren-Phase hat grafische Besonderheiten. Seine erste Arbeit für ›Creepy‹, ›Die schwarze Katze‹ nach Edgar Allen Poe, weist so kunstvolle Schraffuren wie wohl kein anderer Comic von ihm auf – ohne dass ein einziges Panel überladen wirkt. Bei ›Jenifer‹, einer Geschichte, deren Ende den Anfang erklärt, und ›In der Nacht‹ ersetzt Wrightson die Schraffuren teilweise durch Grautöne. ›Clarice‹ und ›Marsianersaga‹ fallen jeweils durch ihren strengen Seitenaufbau und den Verzicht auf Sprechblasen aus dem Rahmen.
Wrightson verwendete nie Vorlagen

Dass Wrightson ein hervorragender Inker ist, beweist er bei zwei von Carmine Infantino gezeichneten Storys: ›Landlust‹ und ›Dick Swift und sein elektrischer Power-Ring‹. Und schließlich hat er einmal das Inken einem damals noch unbekannten Künstler überlassen: Howard Chaykin in ›Reuben Youngblood, Privatdetektiv‹. In dem Splitter-Band kann man sich in die Grafik vertiefen, denn das Seitenformat ist deutlich größer als das der Warren-Magazine und die Druckqualität hervorragend.
Zur Autorenschaft hatte er keine Ambitionen
So wie Wrightson eher Illustrator als Comiczeichner ist, so kann man ihn auch kaum als Comicautor bezeichnen. Er scheint da keine Ambitionen gehabt zu haben – die Manuskripte lieferten meist Leute wie Bruce Jones oder Bill DuBay. ›Creepy‹ und ›Eerie‹ hatten wegen des Magazinformats den Vorteil, den Bestimmungen des Comic Codes nicht unterworfen zu sein, die zu diesem Zeitpunkt freilich bereits gelockert waren. Dennoch: Manche Gewaltdarstellungen wären in ›House of Mystery‹ und ähnlichen farbigen Grusel-Comicheften nicht möglich gewesen. Man konnte noch einmal an die morbide Atmosphäre der EC-Klassiker (die Mitte der 1950er Jahre zur Einführung des Codes geführt hatten) anknüpfen und an den ›Twist‹ in den Storys, der dort perfektioniert worden war. Aus heutiger Sicht bieten die Arbeiten freilich wenig Gänsehaut und milden Schrecken. Die Tabugrenzen sind längst viel weiter hinausgeschoben.
Gleichwohl waren die Warren-Magazine wegweisend für die US-Comicindustrie. Zusammen mit dem Underground, der Fantasyszene rund um die Zeitschrift ›Heavy Metal‹ und den bahnbrechenden Veröffentlichungen von Will Eisner (›A Contract with God‹) schufen sie ein Angebot für erwachsene Leser, das es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht – oder höchstens in vereinzelten intellektuellen Zeitungsstrips – gegeben hatte. Und ohne exzeptionelle Zeichner wie Bernie Wrightson hätten sich die Erwachsenencomics nicht vom Mainstream der Comic Books (Comichefte) abheben können. Das macht der Wrightson-Sammelband unübersehbar deutlich.
Titelangaben
Creepy präsentiert: Bernie Wrightson. Die ultimative Gesamtausgabe seiner Werke aus Creepy und Eerie.
Aus dem Amerikanischen von Resel Rebiersch
Bielefeld: Splitter Verlag 2014
144 Seiten, 22,80 Euro
Reinschauen
| Wrightsons Frankenstein-Illustrationen
| Weiteres Artwork von Wrightson