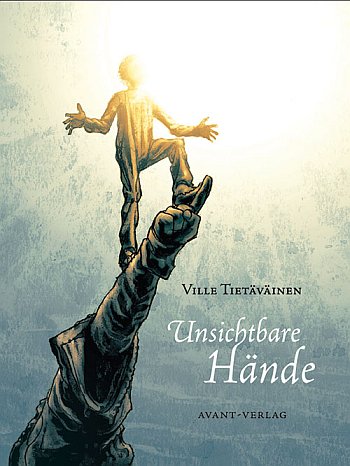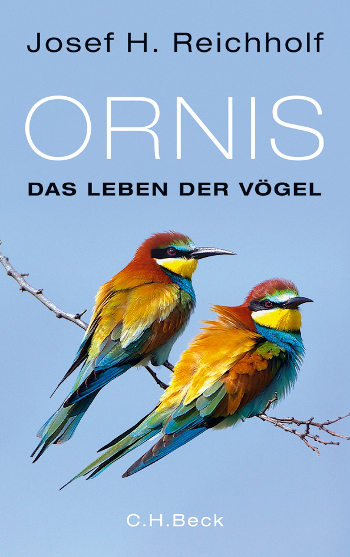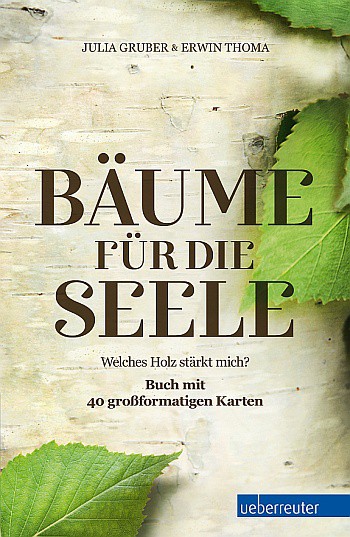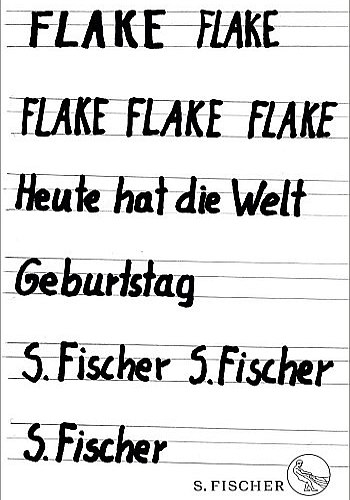Menschen | Manfred Wieninger: Die Banalität des Guten
Das Böse hat Konjunktur. Die Jahrestage von Erstem und Zweitem Weltkrieg sorgen für einen steten Schub an Darstellungen von Abgründigem. Warum blicken wir so selten auf diejenigen, die sich in dieser Zeit ein Minimum an Menschlichkeit bewahrt haben? Ist Gutes zu tun einfach zu banal – oder in einer Zeit des Opportunismus viel zu schwierig? Das fragt sich Biografieforscher JÖRG FUCHS angesichts der Lektüre von Manfred Wieningers Buch ›Die Banalität des Guten‹.
 Böses fasziniert! Nur so lässt es sich erklären, dass heutzutage vor allem die Protagonisten des nationalsozialistischen Regimes in Print- und Fernsehdokumentationen eine Präsenz erlangt haben, die sie zu Lebzeiten stets angestrebt hatten. Noch das kleinste Licht in Hitlers Hofstaat (inklusive Hund und Haushaltshilfe) wird durch die Mühlen der Gedenkmaschinen gedreht. Neuester Schrei ist die Einfärbung historischen Filmmaterials, um den Schrecken der Zeit einerseits möglichst zeitgemäß wirken zu lassen, andererseits einfach konsumierbar zu machen, auf dass sich kein Youtubebewohner – abgeschreckt durch sperrige Schwarz-Weiß-Aufnahmen – mit einem Gähnen abwenden möge.
Böses fasziniert! Nur so lässt es sich erklären, dass heutzutage vor allem die Protagonisten des nationalsozialistischen Regimes in Print- und Fernsehdokumentationen eine Präsenz erlangt haben, die sie zu Lebzeiten stets angestrebt hatten. Noch das kleinste Licht in Hitlers Hofstaat (inklusive Hund und Haushaltshilfe) wird durch die Mühlen der Gedenkmaschinen gedreht. Neuester Schrei ist die Einfärbung historischen Filmmaterials, um den Schrecken der Zeit einerseits möglichst zeitgemäß wirken zu lassen, andererseits einfach konsumierbar zu machen, auf dass sich kein Youtubebewohner – abgeschreckt durch sperrige Schwarz-Weiß-Aufnahmen – mit einem Gähnen abwenden möge.
Wie kommt es, dass das »Gute« in diesem Kontext so oft ein Randthema bleibt? Hinterfragt die Zurschaustellung des Guten im Bösen unsere Positionen zu heiklen Themen? Haben wir Angst, vor der stets hinter dem Guten lauernden Frage: »Wie hätten wir uns entschieden?« Aus der sicheren Distanz von Jahrzehnten fällt es leicht, hypothetische Fragen dieser Art im Brustton der Überzeugung nach bestem Gewissen zu beantworten. Aber auch nach bestem Wissen? Was genau wissen wir vom Wirken des Guten in der Epoche der Barbarei des Nationalsozialismus?
Okay, Oskar Schindler hat es dank Hollywood posthum zu einiger Prominenz gebracht. Auch einige Widerstandskämpfer sind im kulturellen Gedächtnis fest verankert – auch wenn ihre Motive sehr oft im Dunklen bleiben. Diese Ambivalenz der »Guten« in einer Zeit des Bösen zeichnet auch Feldwebel Anton Schmid zunächst aus, dessen Lebens- und Todesgeschichte das Buch ›Die Banalität des Guten‹ von Manfred Wieninger in Egodokumenten und Archivmaterialien nachzeichnet.
Zwischen Opportunismus und Opposition
Es fällt anfangs nicht leicht, Schmid in seiner Zeit zu verorten; die Grenzen zwischen Opportunismus und Opposition sind mitunter fließend. Als Uniformträger mag man ihn als Mitläufer, als tragende Säule des Regimes abstempeln; Zeitzeugen erinnern seinen Charakter jedoch anders: Schützend habe er sich vor eine jüdische Geschäftsfrau gestellt, deren Laden von Nazischergen zertrümmert wurde, einen Hitlerjungen ohrfeigend. Offiziell angeklagt wurde er dafür zwar nicht, doch wurde die Angelegenheit wohl auf der nächsten Polizeistation durch »Handauflegen« (Verprügeln des Delinquenten, Anm. d. Autors) unbürokratisch aus der Welt geschafft.
Als Leiter einer Versprengtensammelstelle kommt Schmid 1941 nach den ersten großen Pogromen ins litauische Wilna. Die Verfolgungen von Juden und Kommunisten sind auch während seiner Dienstzeit dort in vollem Gange – und ihm sicherlich gegenwärtig. Ob Schicksal oder Zufall: Schmid gerät in Kontakt mit einer jüdischen Frau, die sich, was ihre Verzweiflung ausdrückt, dem deutschen Uniformträger offenbart; ein zu dieser Zeit bereits todeswürdiges Vergehen.
Schmid stellt sich der Gewissensprüfung. Er bietet Hilfe an, verschafft der Hilfesuchenden arische Papiere und eine Arbeit bei der sie – Ironie der Geschichte? – deutsche Soldaten vor der unerbittlichen Militärgerichtsbarkeit der Wehrmacht schützen hilft. Einem polnischen Juden verschafft Schmid eine arische Herkunft sowie Arbeit in seiner eigenen Dienststelle. Dort gibt sich der Gerettete betont preußisch-zackig und beeindruckt als vermeintlicher deutscher Gefreiter tagtäglich seine nichts ahnenden Häscher.
Gegen die Knopps dieser Welt
»Einem Menschen zu helfen sei für den, der wolle, gar nicht so schwer«, resümiert der Feldwebel. Es wirkt, so der Titel des Buchs, auf den ersten Blick geradezu »banal«. Ein offenes Wort, einige Schwindeleien an offiziellen Stellen, einige helfende Hände und schweigende Zungen – mehr braucht das Gute dem Anschein nach nicht, um zu wirken.
Ruft man sich jedoch ins Bewusstsein, dass der kleinste Fehler, das geringste Misstrauen, der leiseste Zweifel in dieser Zeit den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten konnten, verblasst die vermeintliche »Banalität«, neigt sich die Waagschale. Bereits die geringste Tat fällt ins Gewicht, auch wenn ihr edle Motive fehlen mögen. Diesem Wirken kann sich auch Schmid nicht entziehen. Mit der Rettung weiterer litauischer Juden setzt er Ereignisse in Gang, die ihn vor die Läufe des Pelotons bringen werden.
Was erzählt uns das Buch über ›Die Banalität des Guten‹ – oder gar die geschichtlichen Ereignisse? Ob sich aus den Dokumenten und Zusammenhängen, die Wieninger vorstellt, tatsächliche historische Wahrheiten konstruieren lässt, ist nicht von Belang. Was die Quasidokumentationen im Geschichtsfernsehen verschweigen ist, dass es keine geschichtliche »Wahrheit« gibt. Es gibt eine »Wirklichkeit«, die sich für jeden, der an Geschichte teilnimmt, anders darstellt.
Ein Dokument, ein für Historiker scheinbar unbestechliches Geschichtszeugnis, ändert seinen Aussagewert, wenn wir es in den Kontext der Handlung stellen. Es kann retten, oder es kann das Schicksal besiegeln. Wieninger tappt nicht in die Dokumentationsfalle, den Materialien die alleinige Deutungshoheit zu verleihen. Stattdessen stellt er den Menschen in den Vordergrund, überlässt es uns, zu bewerten.
Das Ende der Bedeutung
Das Buch stellt einen wohltuenden Kontrapunkt zu den Knopps und Neitzels dieser Welt dar, die uns Geschichte vermitteln wollen, ohne Geschichten zu erzählen. Die Perspektive auf das Leben Anton Schmids entfaltet sich in den Blicken von uns Betrachtenden – nicht in der politischen Korrektheit des heutigen gesellschaftlichen Interpretationsrahmens (= guter Nazi vs. böser Nazi!)
Ohne Anspruch auf Deutungshoheit schildert ›Die Banalität des Guten‹ das Geschehen. Manfred Wieninger weiß, dass historische Wahrheit und subjektive Wirklichkeit selten deckungsgleich sind. Wohltuend ist die Zurücknahme des erläuternden Textes hinter den Kontext; sie betont die Wucht der persönlichen Dokumente, ohne das Geschehene zu dramatisieren, oder schlimmer: zu instrumentalisieren.
Auch wenn es einen roten Faden gibt, der die dokumentarischen Stellen verknüpft und uns durch die Geschehnisse leitet, unterbleibt dankenswerterweise die Festlegung auf eine herausdestillierte Bedeutung, das meist unvermeidliche historische »Fazit«. Denn was Historiker oftmals nicht bereit sind zu akzeptieren: Bereits eine winzige Perspektivverschiebung bedeutete das Ende der mühsam konstruierten Deutung: »Eine Geschichte anders zu erzählen, bedeutet eine andere Geschichte erzählen« (Pierre Bourdieu).
Lediglich der Titel irritiert uns, er mag nicht zu den Ausführungen passen. Dort, wo das Gute wirkt, ist es selten banal, auch wenn es beiläufig geschehen mag. Dieses gilt ganz besonders für eine Zeit, in der das »gute Handeln« die eigene Existenz vernichten kann. Die Frage »Wie wirst Du handeln?« hat in unserer Epoche, in der offen zur Schau getragene Kaltherzigkeit gegenüber Bedürftigen längst wieder salonfähig geworden ist und nur durch ironische Brechung mühsam kaschiert wird, ihre Gültigkeit nicht verloren.
Titelangaben
Manfred Wieninger: Die Banalität des Guten
Wien: Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft 2014
192 Seiten, 21 Euro
Reinschauen
| Leseprobe im TITEL kulturmagazin