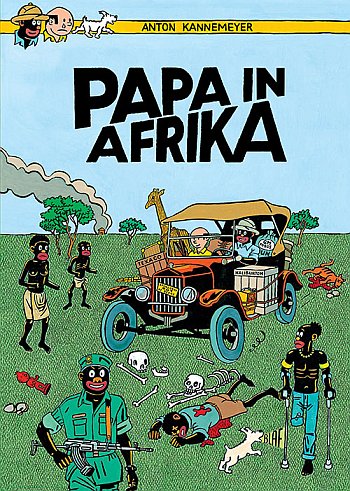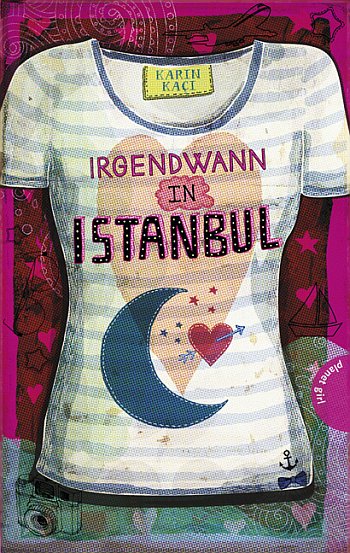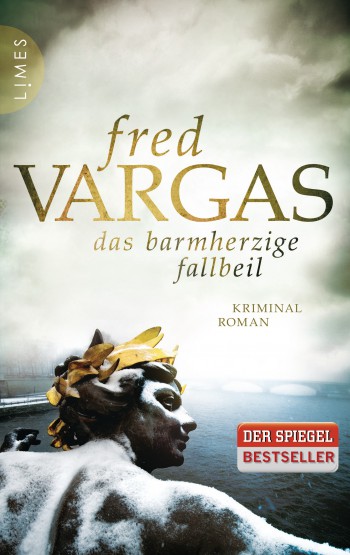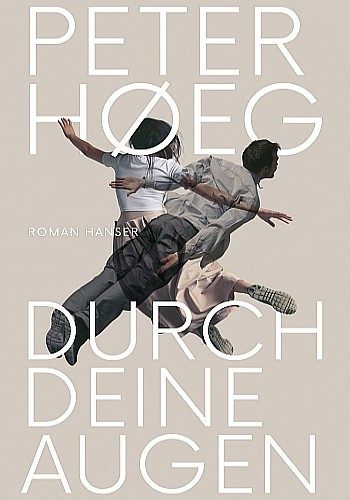Roman | Pier Paolo Pasolini: Ragazzi di vita
Klaus Wagenbach hat zum 50-jährigen Verlagsjubiläum letztes Jahr Pier Paolo Pasolinis Ragazzi di Vita in einer Neuauflage herausgebracht. – TITEL kulturmagazin gratuliert dem »Verlag mit der Tür nach Italien«. Von HUBERT HOLZMANN
 Pier Paolo Pasolini (1922-1975) kennen wir als Regisseur von Filmen wie Decameron (1970), Die 120 Tage von Sodom (1975) und nicht zuletzt durch seinen Film Teorema – Geometrie der Liebe (1968). In diesen Filmen verbindet er Extreme – Monumentales steht neben Abseitigem, sein extremes ästhetisches Programm provoziert nicht nur die Konservativen der Gesellschaft, denn seine Kameraführung fängt all das ein, was das Bürgertum zu verbergen versucht (R. Barthes).
Pier Paolo Pasolini (1922-1975) kennen wir als Regisseur von Filmen wie Decameron (1970), Die 120 Tage von Sodom (1975) und nicht zuletzt durch seinen Film Teorema – Geometrie der Liebe (1968). In diesen Filmen verbindet er Extreme – Monumentales steht neben Abseitigem, sein extremes ästhetisches Programm provoziert nicht nur die Konservativen der Gesellschaft, denn seine Kameraführung fängt all das ein, was das Bürgertum zu verbergen versucht (R. Barthes).
Auch Pasolinis Debütroman Ragazzi di vita – erstmals 1955 im Mailänder Verlag Garzanti erschienen – schlug im nachfaschistischen Italien wie eine Bombe ein. Prozesse folgten, die Beschlagnahmung des Skandalromans drohte. Der Erfolg des Autors, der zuvor wegen seiner bekannt gewordenen Homosexualität aus dem Staatsdienst entlassen worden und mit seiner Mutter nach Rom gezogen war, konnte allerdings nicht verhindert werden. Dort begann auch seine Zusammenarbeit mit Federico Fellini, seine Freundschaft mit Alberto Moravia und Elsa Morante.
Banlieus, Borgate, trostloses Brachland
Ragazzi di vita – wie später auch sein Erstlingsfilm Accattone (1961) – hat einen Schauplatz, den Pasolini mit Absicht wählt, weil er ihn aus eigener Erfahrung kennt, die römischen Vorstädte, die »borgate«. In einem dieser verlorenen Viertel, an der Ponte Mammolo in der Nähe des Gefängnisses Rebibbia im Nordosten der Stadt, wohnte auch Pasolini zunächst nach seinem Weggang aus dem Friaul 1950. Diese Vorstädte Roms waren damals wie heute die Welt der Unterprivilegierten, der Entwurzelten. Arbeitslosigkeit, Prostitution, Kriminalität gehörten und gehören hier zur Tagesordnung.
Noch lange nach dem Krieg hausten dort die von der Gesellschaft Vergessenen in einfachen Hütten, Baracken, Elendsquartieren oder schnell hochgezogenen Betonbauten. Auch die jungen Männer Ricette, Agnolo, Marcello, Caciotta und Amerigo, von denen Pasolinis Roman erzählt, kommen von dort. Die touristischen Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt werden von diesen Halbstarken kaum wahrgenommen. Die bekannten Kulturorte geben nur die Kulisse für Pasolinis Erzählung ab: »Rechts lag das Kolosseum, glühend wie ein Backofen, und aus den Löchern seiner Bögen quoll mal schnaubend, mal säulenartig blutig rötlicher Qualm hervor, wie granatfarbenes Bonbonpapier, der im Licht der Autoscheinwerfer hoch aufstieg…«
Geschichten junger Männer
Ragazzi di vita ist kein herkömmlicher Roman. Pasolini erzählt hier keine Handlung, sondern konzentriert acht Momentaufnahmen aus dem Leben dieser jungen Männer. Der Filmemacher hält dabei seine »Kamera« fast dokumentarisch auf diese Gruppe der Halbstarken und erzählt einzelne Sequenzen aus deren Leben.
Ricette und seine Freunde sind Geächtete, die ohne jede Perspektive die Straßen Roms durchstreifen, auf Hinterhöfen und Brachflächen herumhängen und sich mit kleineren Diebstählen, Gaunereien oder mit Zuhälterei über Wasser halten. Der Weg in den Jugendknast ist da nicht weit. Denn die Jungen haben keine Perspektive. Es fehlt ihnen die Schulbildung. So schlagen sie die Zeit tot, hängen tagsüber auf Plätzen herum, verbringen manche Nächte in den Parkanlagen der Stadt. Und an den Sommertagen lümmeln sie am Ufer des Tibers herum oder fahren hinaus an den Strand von Ostia.
Der junge Ricette steht in den meisten Episoden von Pasolinis Ragazzi di vita im Zentrum. Er überlebt, indem er Hehlerware vertickt, sich mit Kleinkriminellen im Zentrum der Stadt befreundet und auch schon mal einen Strichjungen ausraubt. Dabei hat er Glück, dass nicht er, sondern einer seiner Kumpane auf einer dieser nächtlichen »Organisationstouren« von der Polizei geschnappt und eingeknastet wird. »›Und wenn ich mir zehn Jahre Regina Coeli [Jugendknast in Rom] reinhaue, aber heut Nacht muß ich spieln‹, sagte er leise. – ›Mit dein’ Eiern!‹, dachte Ricette bei sich und schwieg, um Amerigo nicht zum Reden zu reizen.«
Das Glück scheint ihm gelegentlich auch wirklich gewogen. Er lernt eine junge Frau kennen, verlobt sich und sie heiraten schließlich. Allerdings verbessert sich nichts. Vielmehr verschärft sich seine soziale Not. Also schickt er die Frau anschaffen, während er selbst nur kurz einer geregelten Arbeit nachgeht.
The bright side of death…
Dieser Ricette versucht sich dabei nicht wirklich aus seinem Schlamassel zu befreien. Faszinierend ist seine Unbedarftheit, seine Natürlichkeit, mit der er das Schicksal so nimmt, wie es zuschlägt. Um einen toten Freund wird kurz getrauert: »Das sind seine eigenen Scheißangelegenheiten sind das.« Kurz darauf ruft bereits wieder das »Tagesgeschäft«. Aber Ricettes Überlebenstrieb ist stärker.
Nichts desto trotz verstört Pasolini mit Ricette und dessen Leuten. Durch ihre kriminelle Energie, ihre Gewissenlosigkeit, ihre Obszönität. Diese junge Männer leben an dunklen Orten. »Der Mond stand inzwischen hoch am Himmel… Der Welt schien er nur noch seinen Hintern zuzuwenden…« Die Vergnügungen sind rar. Also werden die wenigen Lira verzockt, verzecht, verhurt. Einen Rückzugsort haben sie nicht. Die Familie hat ihn jedenfalls nicht zu bieten.
Die seltenen ausgelassenen Momente verleben die Jungen am Ufer des Tiber. Dort können sie herumtollen, werden zu Kindern, protzen mit ihrer aufkeimenden Männlichkeit, machen sich an die Mädchen heran. Die Mutigen unter ihnen springen in die Fluten. Dass der Fluss vom Abwasser der Fabriken und Haushalte extrem verdreckt ist, kümmert sie nicht. Auch nicht, dass die Strömung des Flussen nicht immer berechenbar ist. Aber Leben und Sterben, Eros und Thanatos, Anziehendes und Obszönes gehören für Pasolini zusammen. Provokation, Angriff und seine »verzweifelte Ehrlichkeit« (Umberto Eco) waren nicht zuletzt ein Grund für Pasolinis Ende. Er wurde 1975 in Ostia ermordet.
Ragazzi di vita von Pasolini liegt in der Übersetzung von Moshe Kahn vor, dem es gelingt, die römische Gossensprache in ihrer derben Dialektfärbung ins Deutsche zu übertragen, um das besondere Vorstadtmilieu von Pasolinis Szenen wiederzugeben. Im Nachwort erläutert der Übersetzer Kahn die Wirkung des Skandalromans und seine Arbeit an der Übersetzung von Pasolinis Text. Außerdem abgedruckt ist Umberto Ecos Nachruf auf Pasolini aus dem Jahr 1975.
Titelangaben
Pier Paolo Pasolini: Ragazzi di vita
Aus dem Italienischen von Moshe Kahn
Berlin: Wagenbach 2014
240 Seiten. 11,90 Euro