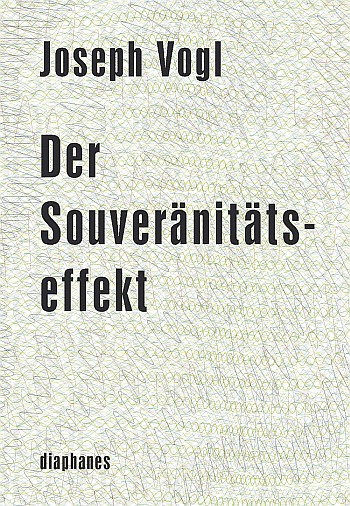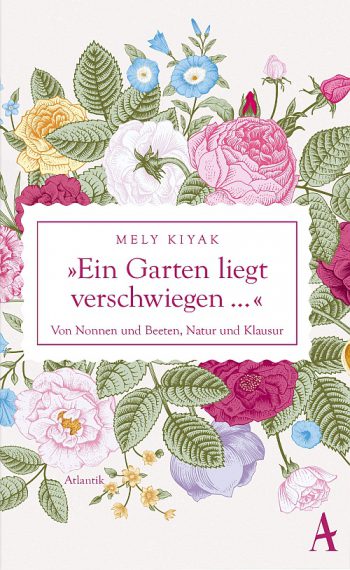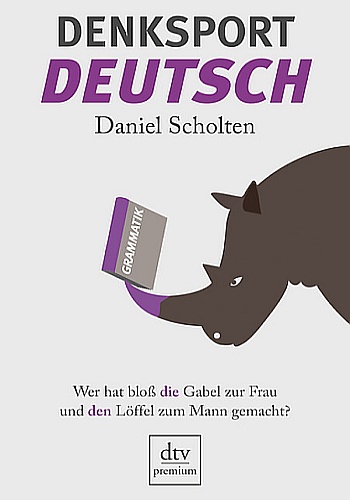Kulturbuch | Karl-Heinz Göttert: Mythos Redemacht
Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2015
In seiner umfangreichen Untersuchung über Rhetorik arbeitet Karl-Heinz Göttert die von der europäischen Antike ausgehende Tradition der Rede als Mittel der Machtausübung heraus. Wenngleich er sich dabei kühn zwischen den Jahrhunderten bewegt, zeigt sich ein erstaunlich stabiles Prinzip. Der Redner wolle »sein Gegenüber beeindrucken, ihn regelrecht unterwerfen, indem er kunstvoll redet«, Göttert sieht einen überlegenen Redner und den passiven Zuhörer. Von WOLF SENFF
 Dieses, verbunden mit argumentativer Schärfe, sei eine ›männliche‹, europäische Tradition rednerischer Kunst, die »in Schwierigkeiten geriet, als sich das Geschlechterverhältnis neu formierte«. Göttert arbeitet die Entwicklung der vorherrschenden europäischen Tradition an diversen Beispielen heraus, zeigt interne Konflikte etwa im antiken Streit zwischen attizistischer und asianistischer Rhetorik und vergleicht »argumentative Kunst in Athen und bei Hitler«.
Dieses, verbunden mit argumentativer Schärfe, sei eine ›männliche‹, europäische Tradition rednerischer Kunst, die »in Schwierigkeiten geriet, als sich das Geschlechterverhältnis neu formierte«. Göttert arbeitet die Entwicklung der vorherrschenden europäischen Tradition an diversen Beispielen heraus, zeigt interne Konflikte etwa im antiken Streit zwischen attizistischer und asianistischer Rhetorik und vergleicht »argumentative Kunst in Athen und bei Hitler«.
Predigt als Form der Rede
Er sieht beim ›europäischen‹ Redner stets auch das kalkulierte Vorgehen, die Rede sei wohlüberlegt auf das Gegenüber abgestimmt. »Der ›gute‹ Redner weiß, was sein Gegenüber will«, er werde die eigene Argumentation entsprechend gestalten, die Rede orientiere sich am Publikum, ein Musterbeispiel dafür liefere Cicero in seinen Reden gegen Catilina.
Auch die am einfachen Stil orientierte christliche Predigt durch Augustinus halte an diesen ›europäischen‹ Grundsätzen fest, jedoch das täuschende Prinzip, »nicht Redner sein zu wollen«, sei, wie Göttner in einem amüsanten Kapitel nachweist, Charakteristikum der Predigten von Augustinus genauso wie der Reden Bismarcks. Schön zu lesen auch, wie Göttert die Predigten des Bernhard von Clairvaux, »Bernhard, der Honigsüße«, seziert und auch hier die ›europäische‹ Tradition nachweist.
Parlamentarische Rede
Anders liegen die Dinge bei Philipp Jakob Spener, einem Prediger des Pietismus, der sich an ein Gegenüber wendet, »dessen Glaube in der Seele liegt und der in dieser Seele angesprochen sein will«. Mit der Aufklärung rücke aber die Rede ins Zentrum von politischen Kontexten, und Göttert lenkt unsere Aufmerksamkeit unter anderem auf Robespierres Revolutionsreden und auf Winston Churchills Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede. Unter diesen parlamentarischen Bedingungen gehe es dem Redner darum, Mehrheiten zu gewinnen.
Auch die parlamentarische Rede folgt dem ›männlichen‹ Konzept europäischer Rede, Göttert zeigt dies am Beispiel John F. Kennedys und Willy Brandts. Aber ab und zu lässt Göttert erkennen, was er für ein alternatives Redemodell halten könnte. Gleich zu Beginn geht er auf die berühmte Rede des Häuptlings Seattle von 1855 ein, die dieser an den »Großen Häuptling der Weißen« Franklin Pierce richtet und die, so Göttert, »in geradezu provozierender Weise nicht auf Überredung angelegt« sei.
Jenseits europäischer Rhetorik
»Wir wissen«, zitiert er Seattle, »dass der weiße Mann unsere Art nicht versteht. Ein Teil des Landes ist ihm gleich jedem anderen, denn er ist ein Fremder, der kommt in der Nacht und nimmt von der Erde, was immer er braucht. […] Er behandelt seine Muttter, die Erde, und seinen Bruder, den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern.« Seattle weist auf die unüberbrückbaren kulturellen Unterschiede, seine Aussagen drohen, heute die gesamte ›europäische Rationalität‹ einzuholen.
Auch an hiesigen Beispielen sieht Göttert Abweichungen von dem Rhetorik-Modell europäischer Rationalität und verweist etwa auf Reden des europäischen Parlamentspräsidenten Martin Schulz, die mit narrativen Elementen arbeiten und, so Göttert, ein ›weibliches‹ Verständnis von Rede offenbaren.
Gibt es andere Rede-Kulturen?
Göttert lässt jedoch keine Zweifel, dass die von ihm dargestellte europäische Rede kulturell begrenzt ist, und es genügt der Hinweis auf bekannte fernöstliche Weisheit. »Wer nach den richtigen moralischen Grundsätzen handelt, wird schon auch reden können. Wer jedoch reden kann, vertritt nicht immer schon die richtigen Grundsätze.« (Konfuzius) bzw. gar: »Ein Wissender redet nicht; ein Redender weiß nicht« (Lao-Tse).
Aufschlussreich wäre durchaus der Versuch, eigene Traditionen an Reden aus Fernost, auch aus Afrika nachzuweisen, vielleicht fände man dort ein neues, belebendes Verständnis von Rede. Aber das ginge weit über den Ansatz dieses kenntnisreichen und unterhaltsamen Beitrags von Karl-Heinz Göttert hinaus.
Titelangaben
Karl-Heinz Göttert: Mythos Redemacht
Eine andere Geschichte der Rhetorik
Frankfurt: Fischer 2015
510 Seiten, 24,99 Euro
Reinschauen
| Leseprobe