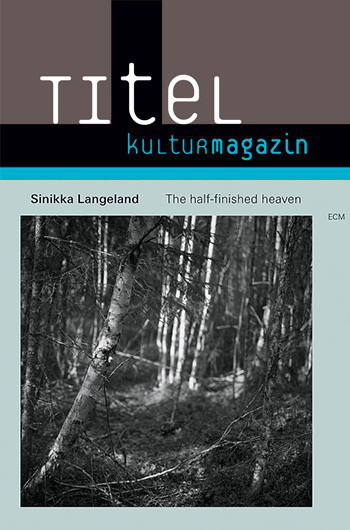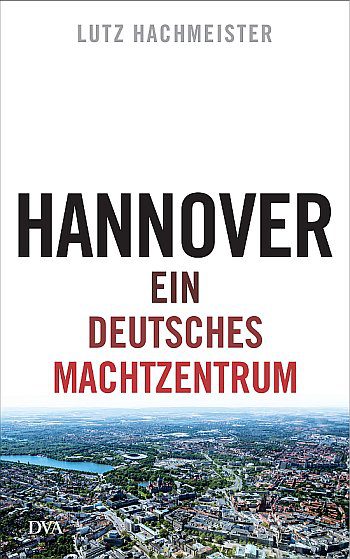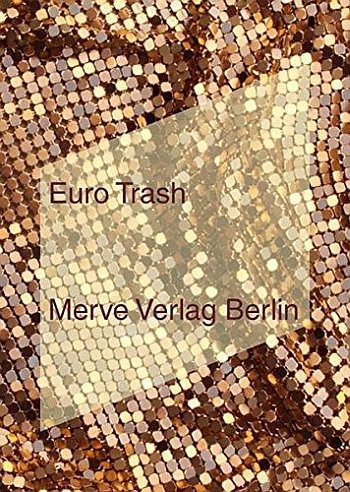Gesellschaft | Julia Friedrichs: Wir Erben. Was Geld mit Menschen macht
Geschätzt zweihundertfünfzig Milliarden Euro werden jährlich an Erben weitergereicht, eine runde Summe. Nein, muss sich niemand schämen dafür. Das ist Hochleistungsgesellschaft und was dabei hinten rauskommt. Neben mir wurden acht Reihenhäuser verkauft. Bevor sie fertig waren, traf ich ein älteres Ehepaar, das eines dieser Objekte für seine Kinder erworben hatte. Von WOLF SENFF
 Schön für die Leute. Wir sind ja – um den Blickwinkel vorweg zu erweitern – weit mehr als eine Erbengesellschaft, wir sind auch eine Glücksspielgewinnergesellschaft, es müssen ordentlich Lotto- und Glücksspielgewinner unter uns herumlaufen oder haben sich, plausible Idee, auf Teneriffa ein Café gekauft.
Schön für die Leute. Wir sind ja – um den Blickwinkel vorweg zu erweitern – weit mehr als eine Erbengesellschaft, wir sind auch eine Glücksspielgewinnergesellschaft, es müssen ordentlich Lotto- und Glücksspielgewinner unter uns herumlaufen oder haben sich, plausible Idee, auf Teneriffa ein Café gekauft.
Linksherum? Rechtsherum?
Eine gute Freundin erzählt nach zwei Glas Rotwein – aber nur dir und sag’s nicht weiter –, dass sie ihr repräsentatives öffentliches Amt aus eigenen Mitteln finanziere, sie habe vor mehreren Jahren in einem TV-Glücksspiel gewonnen, keinen Nebenpreis, sondern zwei Millionen, damals noch D-Mark. Na Glückwunsch, mit Geld kannst du ein Leben gestalten.
Ist mir schnuppe, Freundschaft bleibt sowieso Freundschaft. Nur dass man sich die Augen reibt, was sich hier eigentlich abspielt und ob da nicht ›Hochleistungsgesellschaft‹ still und heimlich an ihrem eigenen Untergang bastelt. Wie dreht sich die Erde? Linksherum? Rechtsherum? Die Astronomie hat nachgewiesen, sie würde schlingern, unglaublich, man könnte meinen, das wär‘ Verschwörungstheorie.
Wie leben Erben?
Soviel zur Vorrede. In diesem Lande leben, wie wir von Julia Friedrichs erfahren, mehr als eine Million Millionäre mit einem Gesamtvermögen von zwei Komma sieben Billionen Euro. Da sind wir garantiert auch Millionärsweltmeister, ist das nicht schön, wer hätte das gedacht, und bleibt viel für die Erben, Papst sind wir eh gewesen.
Dass Politik das ändern könnte, klar, ist eher ein Thema am Rande, Julia Friedrichs möchte mehr darüber wissen, wie Erben leben, und uns wird ein breites Panorama präsentiert, illustre Details.
Peer Steinbrück sei Dank
Wir lernen einige Erben kennen, die bereit waren, über ihre Situation Auskunft zu geben, anonymisiert selbstverständlich, und die menschlichen Schwierigkeiten, die mit der ›Last‹ unverdienten Reichtums verbunden sind. Das schlechte Gewissen, das wir an den ersten Beispielen kennenlernen, dürfte die Ausnahme sein, und generell gelte für Reiche »das Bedürfnis, unter sich bleiben zu wollen«.
Julia Friedrichs erzählt von Peer Steinbrücks Verringerung der Vermögenssteuer von zuvor 42 auf 25 Prozent in 2009, einer wichtigen Etappe auf dem nimmermehr endenden Pfad der Begünstigung der Wohlhabenden hierzulande. Nach Berechnungen der FU Berlin zahlten die sechsundvierzig reichsten Deutschen 48,2 Prozent Steuern (1998) und 2005 eh nur noch 28,2 Prozent, da wird ihnen Peer Steinbrück 2009 ja weitere Erleichterungen angeschwemmt haben.
Machenschaften der ›Betreuer‹
Sie beschreibt uns Familienunternehmen, die Grupps, die Reimanns, die Haniels, die Oetkers, die Springers, Merckle, die Rossmanns, die Neckermanns, die Mohns – von denen sich die meisten völlig bedeckt halten, sich aber ebenfalls intensiv um ihren Familienbesitz und um die Erbfolge kümmern, es gibt einen winzigen Blick in Clanstrukturen so wie Fürstenhäuser. Interessant wäre gewesen, etwas über eine Jeunesse dorée zu erfahren, die zwischen universitären Gesangsklassen, Schauspielseminaren und Literaturinstituten herumvagabundiert, an Jan Wagner, Preisträger der Leipziger Buchmesse, sehen wir, was dabei herauskommt.
Da das Geld in den Mittelschichten knapp wird, sind die Erblasser dort besonders umworben. Wir erfahren unangenehme, peinliche Details, erfahren vom umtriebigen Leben manches Nachlassverwalters, von Machenschaften der amtlichen ›Betreuer‹ – schon klar, dass in Zeiten der Gier das Geld besonders hell leuchtet.
Informationswert bleibt zweifelhaft
Mord und Totschlag, Goldbarren unter der Matratze, die buckelige Verwandtschaft, es gibt viel Leid, gibt Fehlurteile, und letztlich entsteht der Eindruck, dass über diese Einzelfälle hinaus das Faktenmaterial eher dürftig ist.
Man fragt sich, welchen Informationswert es hat, zu erfahren, dass der Kampf um die Finanzen erbarmungslos geführt wird – wir erleben es alle Tage, wir kennen das längst von den smarten Nadelstreifencharakteren in vornehmen Bankhäusern, kennen das aus der Politik.
Titelangaben
Julia Friedrichs: Wir Erben. Was Geld mit Menschen macht
Berlin: Berlin Verlag 2015
320 Seiten. 19,99 Euro
Reinschauen
| Leseprobe