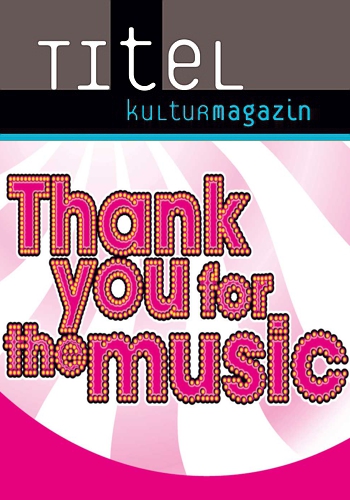Bühne | Richard Wagners ›Lohengrin‹ im Stadttheater Pforzheim
Ist eine Oper, die aus der Feder Richard Wagners (1813-1883) stammt, eine Herausforderung an die Moderne? Studiert man die Sekundärliteratur, ist davon die Rede, dass sich Interpreten bis heute nicht einig darüber sind, wie sie eine solche Oper zu interpretieren haben. Nicht nur literarische Texte, auch Schauspiel und Oper in ihrer Aufführungspraxis sind mehrdeutig. Eine einzige Interpretation, die für ein Werk gilt, kann es nicht geben. Bei Richard Wagner stellt sich an den Interpreten noch eine ganz andere Herausforderung: Die nämlich, seinem Traum vom »Gesamtkunstwerk« aus Schauspiel, Musik und Text gerecht zu werden. Von JENNIFER WARZECHA
 Ist Wagner, der entgegen dem Trend seiner Zeit sowohl das Libretto zu ›Lohengrin‹ als auch die Musikpassagen selbst verfasste, dies gelungen? In Pforzheim (in der Fassung eingerichtet von Tobias Leppert, unter der musikalischen Leitung von Markus Huber) zumindest kommen moderne Inszenierungs- und Aufführungspraxis, mythologischer Stoff und Zeitbezug nicht so recht zusammen.
Ist Wagner, der entgegen dem Trend seiner Zeit sowohl das Libretto zu ›Lohengrin‹ als auch die Musikpassagen selbst verfasste, dies gelungen? In Pforzheim (in der Fassung eingerichtet von Tobias Leppert, unter der musikalischen Leitung von Markus Huber) zumindest kommen moderne Inszenierungs- und Aufführungspraxis, mythologischer Stoff und Zeitbezug nicht so recht zusammen.
Liebe als Dauerthema – oder unnötige Reduktion?
Nicht nur, was den interpretatorischen Teil anbelangt, ist der Genuss einer Wagnerschen Oper kein leichtes Brot. Wagner soll sich wiederholt antisemitisch geäußert haben. Adolf Hitler war großer Wagner-Fan und setzte seine Gedanken über das Deutsche Reich – erkennbar an dem Reichsapfel im Stück –gerne in seiner Ideologie um. Vermutlich genau deshalb steht in der Pforzheimer Inszenierung die Liebesgeschichte zwischen Elsa von Brabant (Tiina-Maija Koskela) und Lohengrin (Reto Rosin) mehr im Vordergrund als mythologischer Stoff und aktueller Zeitbezug – der in modernen Stücken sowieso schwer zu leisten ist.
Bei ›Lohnengrin‹ ist das insofern noch schwieriger, da zwischen der einen stofflichen Ebene des Stückes, der mythologischen von Gral und Bezug auf Wolfram von Eschenbachs ›Parzifal‹, schon allein im Wagner‘schen Zeitfenster 650 Jahre liegen, gerechnet von 1200 (Parzifal) bis zur Uraufführung am 28. August 1850 im Großherzoglichen Hoftheater zu Weimar. Heute, mehr als 200 Jahre nach dem Erleben des Komponisten und Librettisten, fällt es zumindest dem ungeübten Theater- und Opernbesucher bzw. Spezialisten noch schwerer, den heroischen Text nachzuvollziehen, mit seinen Bezügen zur Gottesherrschaft, göttlichen Liebe, Liebe zwischen Paaren und Machtanspruch an sich selbst – zieht man das Bühnenbild mit ein.
Wagners Absicht, ein »Gesamtkunstwerk« zu schaffen, wird nicht erfüllt
 Im Vergleich mit dem ebenfalls in Pforzheim aufgeführten lyrischen Märchen ›Rusalka‹ von Antonín Dvořák lässt dies zu wünschen übrig. Wagners Musik – in Pforzheim interpretiert von Seiten der Badischen Philharmonie sowie des Chors und Extrachors, alleine wirkt schon gewaltig – die Instrumentalfassung und die einzelnen Chöre noch mehr als die Interpretation der einzelnen Sänger. Damit allein schon ist das von Wagner selbst gewünschte Gesamtkunstwerk nicht zu schaffen. Die Liebesgeschichte zwischen Elsa und Lohengrin wirkt daneben manchmal schon fast kitschig, zum Beispiel, wenn Lohengrin im Laufe der scheinbar nicht endend wollenden Hochzeitszeremonie spätestens innerhalb einer Szene im dritten Akt die Rosenblätter ausstreut oder Elsa sagt, er liebe sie »nicht aus Nacht und Leiden, sondern aus Wonne.« Dieser unmittelbare mit dem Wort »Nacht« ausgedrückte Bezug zur Romantik ist gegeben. Das entsprechende Motiv im Bühnenbild nicht. Was spräche dagegen, solch eine bildlich gewordene Metapher unmittelbar ins Bühnenbild einzubauen und zumindest die Schatten des Mondlichtes abzubilden, wie es schon bei angesprochener ›Rusalka‹ gelang?
Im Vergleich mit dem ebenfalls in Pforzheim aufgeführten lyrischen Märchen ›Rusalka‹ von Antonín Dvořák lässt dies zu wünschen übrig. Wagners Musik – in Pforzheim interpretiert von Seiten der Badischen Philharmonie sowie des Chors und Extrachors, alleine wirkt schon gewaltig – die Instrumentalfassung und die einzelnen Chöre noch mehr als die Interpretation der einzelnen Sänger. Damit allein schon ist das von Wagner selbst gewünschte Gesamtkunstwerk nicht zu schaffen. Die Liebesgeschichte zwischen Elsa und Lohengrin wirkt daneben manchmal schon fast kitschig, zum Beispiel, wenn Lohengrin im Laufe der scheinbar nicht endend wollenden Hochzeitszeremonie spätestens innerhalb einer Szene im dritten Akt die Rosenblätter ausstreut oder Elsa sagt, er liebe sie »nicht aus Nacht und Leiden, sondern aus Wonne.« Dieser unmittelbare mit dem Wort »Nacht« ausgedrückte Bezug zur Romantik ist gegeben. Das entsprechende Motiv im Bühnenbild nicht. Was spräche dagegen, solch eine bildlich gewordene Metapher unmittelbar ins Bühnenbild einzubauen und zumindest die Schatten des Mondlichtes abzubilden, wie es schon bei angesprochener ›Rusalka‹ gelang?
Das immer wieder auftauchende Gerüst, auf dem Männerchor, Sachsen und Brabanten thronen, wirkt schon aufgrund seiner metallischen Struktur recht kühl. Es passt zum deutschen König, Heinrich der Vogler (Matthias Degen, der leider stimmlich auch nicht die ganze Aufführungsdauer über durchhält), und dem sozialen und zeitgeschichtlichen sowie politischen Bezug, der aus oben genannten Gründen dem Zuschauer letztendlich doch verborgen bleibt. Stellenweise wirkt dieser Kontrast zwischen kühler Zeitdarstellung und der der Liebesszenen nicht nur komisch, sondern fast schon lächerlich – zum Beispiel dann, wenn Lohengrin Elsa umgarnt und vor ihr auf die Füße fällt und im nächsten Moment vor dem Zuschauer wieder das kühle Gerüst erscheint, wie es an mehreren Stellen der Oper passiert.
Moderne Inszenierungspraxis – um jeden Preis?!
 Das wahre Gesamtkunstwerk, unabhängig von den Intentionen Wagners, besteht heute für Zuschauer/-hörer und Operndirektor darin, die Distanz zwischen ursprünglicher Intention und moderner Absicht samt des mythologischen Stoffes zu wahren. Dabei ist es nicht leicht und gelingt es in Pforzheim nicht, einer modernen Wirkungsweise gerecht zu werden, ohne sich in Reduktionen zu verlieren – die stellenweise die Oper als Kunstwerk nicht nachvollziehbar und lächerlich erscheinen lassen. Und auch, wenn dem heftig Beifall spendenden Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Großen Haus des Stadttheaters besonders der Schwan gut gefällt, der dafür sorgt, dass Lohengrin sich von Elsa entfernt, weil seine ursprüngliche, vom Orakel ausgehende Bestimmung von ihr verraten ist, stellt sich die Frage: Warum darf es bei aller modernen Inszenierungsweise nicht doch ein bisschen mehr Klassik sein, im Sinne eines Bild eines Schwans oder einer entsprechenden Figur? Das träfe Wagners Inszenierungsabsicht mit Sicherheit besser.
Das wahre Gesamtkunstwerk, unabhängig von den Intentionen Wagners, besteht heute für Zuschauer/-hörer und Operndirektor darin, die Distanz zwischen ursprünglicher Intention und moderner Absicht samt des mythologischen Stoffes zu wahren. Dabei ist es nicht leicht und gelingt es in Pforzheim nicht, einer modernen Wirkungsweise gerecht zu werden, ohne sich in Reduktionen zu verlieren – die stellenweise die Oper als Kunstwerk nicht nachvollziehbar und lächerlich erscheinen lassen. Und auch, wenn dem heftig Beifall spendenden Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Großen Haus des Stadttheaters besonders der Schwan gut gefällt, der dafür sorgt, dass Lohengrin sich von Elsa entfernt, weil seine ursprüngliche, vom Orakel ausgehende Bestimmung von ihr verraten ist, stellt sich die Frage: Warum darf es bei aller modernen Inszenierungsweise nicht doch ein bisschen mehr Klassik sein, im Sinne eines Bild eines Schwans oder einer entsprechenden Figur? Das träfe Wagners Inszenierungsabsicht mit Sicherheit besser.
Das eigentlich Dramatische am Musikdrama im Wagnerschen Sinne liegt dementsprechend nicht in der eigentlichen Dramatik der Geschichte, dass Elsa Lohengrin dadurch verliert, dass sie ihn im Zeichen des Orakles und Auftauchen des Schwans erkennt und er dementsprechend verschwinden muss – unabhängig von dem darstellerisch und gesanglich sehr überzeugenden Auftreten Ortruds (Anna Agathonos), die sich ihrer Konkurrentin in den Weg stellt. Das eigentlich Dramatische an der Aufführungspraxis ist, dass eine klassische Inszenierungsweise dem Stück besser getan hätte, seine volle Wirkung zu entfalten.
| JENNIFER WARZECHA
| Fotos: SABINE HAYMANN
Titelangaben
Richard Wagner: ›Lohengrin‹ (Stadttheater Pforzheim)
Musikalische Leitung: GMD Markus Huber
Inszenierung: Wolf Widder
Bühne und Kostüme: Joanna Surowiec
Choreinstudierung: Salome Tendies
Dramaturgie: Isabelle Bischof
Besetzung
Heinrich der Vogler, deutscher König: Matthias Degen
Lohengrin: Reto Rosin
Elsa von Brabant: Tiina-Maija Koskela
Friedrich von Telramund, brabantischer Graf: Hans Gröning
Ortrud, Friedrichs Gemahlin: Anna Agathonos
Der Heerrufer des Königs: Aykan Aydin
Vier brabantische Edle: Steffen Fichtner, Brian Garner, Spencer Mason, Karel Pajer
Vier Edelknaben: Mitglieder des Kinderchors
Herzog Gottfried, Elsas Bruder (Schwan): Davide Degano
Badische Philharmonie Pforzheim
Chor und Extrachor des Theaters Pforzheim
Termine
Mittwoch, 10.06.2015, Beginn: 18:00
Samstag, 13.06.2015, Beginn: 18:00
Samstag, 20.06.2015, Beginn: 18:00
Dienstag, 07.07.2015, Beginn: 18:00
Freitag, 10.07.2015, Beginn: 18:00