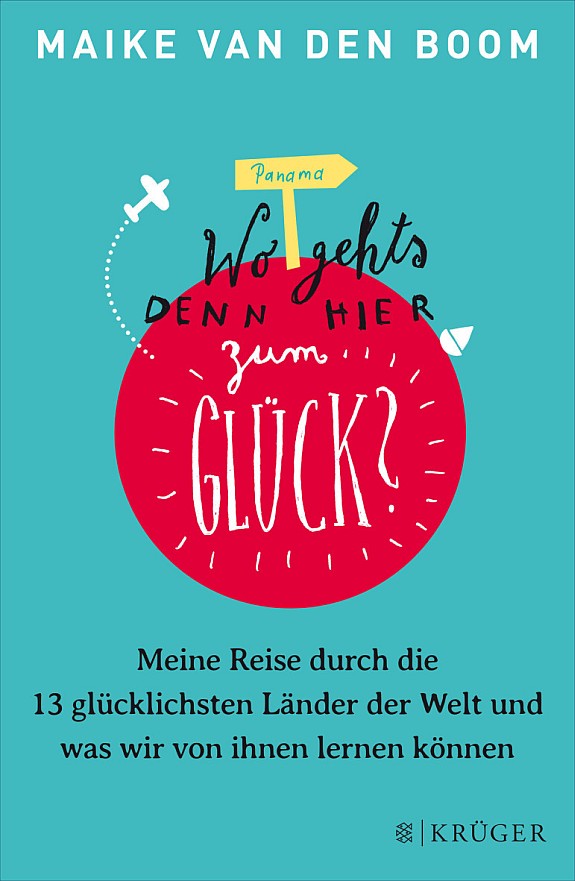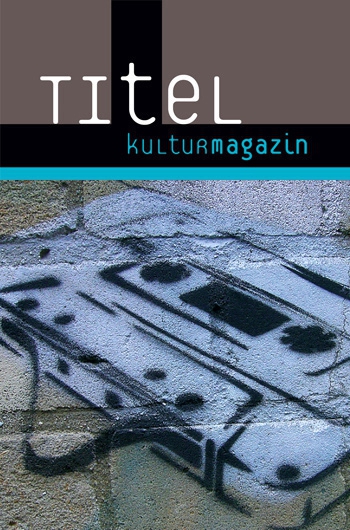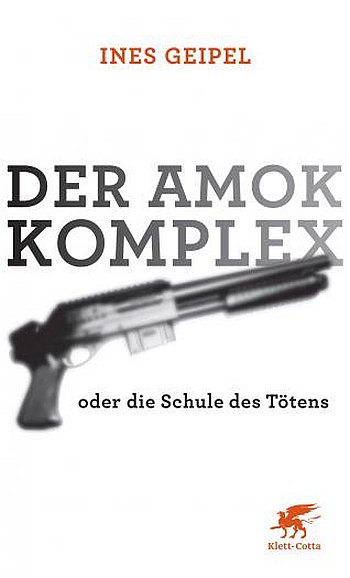Gesellschaft | Hans Joachim Schellnhuber: Selbstverbrennung. Die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung genießt in der Klimaforschung hohes Ansehen, und sein Gründungsdirektor legt terminlich passend zur Weltklimakonferenz, die Anfang Dezember in Paris stattfindet, ein umfangreiches Werk zur Lage des Klimas vor. Von WOLF SENFF
 Was generell auffällt, ist ein Paradigmenwechsel, wissenschaftlicherseits. Eine neue Melodie wird angestimmt, und zwar nicht entlang der angloamerikanischen Vorgaben. Sie ist seit einiger Zeit als mediales Hintergrundgeräusch vernehmbar und findet in Joachim Schellnhubers umfassender Arbeit einen facettenreichen, gewichtigen Ausdruck.
Was generell auffällt, ist ein Paradigmenwechsel, wissenschaftlicherseits. Eine neue Melodie wird angestimmt, und zwar nicht entlang der angloamerikanischen Vorgaben. Sie ist seit einiger Zeit als mediales Hintergrundgeräusch vernehmbar und findet in Joachim Schellnhubers umfassender Arbeit einen facettenreichen, gewichtigen Ausdruck.
Begriffsstutzig
Dieser Paradigmenwechsel ist simpel und einleuchtend. Die Frage lautet nicht länger, wie wir die Natur für unsere Zwecke nutzen und profitabel ausbeuten, sondern sie lautet, wie die Bedingungen für menschliches Leben auf diesem Planeten zu retten sind.
Für diese Fragestellung ist nicht eben viel Hirnschmalz erforderlich, man wundert sich über jahrzehntelange Begriffsstutzigkeit, noch für Helmut Schmidt war Ökologie eine »Marotte gelangweilter Mittelstandsdamen«. Doch es beruhigt, dass sich diese Einstellung ändert. Schon Seattle, Häuptling der Cree, der von 1786 bis 1866 lebte und weder vom Klima noch von Naturwissenschaften etwas verstand, wird die Einsicht zugeschrieben, dass man Geld nicht essen könne.
Wind of change
Wir sind beim Klima, genauer: Beim planetarischen Kohlenstoffkreislauf und seiner Störung durch den Menschen, und Schellnhuber schildert aus persönlichem Erleben, wie desaströs der Klimagipfel 2009 in Kopenhagen sich dieses Themas annahm – er habe »niemals so viel heiße Luft auf einmal erlebt«.
Der Charme dieses vielhundertseitigen Werks liegt darin, dass Joachim Schellnhuber sich nicht hinter einer unzugänglichen Fassade von Wissenschaftlichkeit verbirgt, sondern seine persönliche Haltung einbringt – er ist empört, er ist nachhaltig angefressen. »Empört euch!«, 2010, wir erinnern uns, war ein viel beachteter Essay des seinerzeit dreiundneunzigjährigen ehemaligen französischen Widerstandskämpfers und UN-Diplomaten Jérome Hessel. Wind of change.
Hagelschlag, Sturm, Dürre
Joachim Schellnhuber redet nicht nur von ›Klimawandel‹, er wechselt wenngleich zögerlich in den Modus der ›industriellen Destabilisierung des Klimas‹ oder des ›Klimachaos‹, was den Sachverhalt genauer trifft, denn es geht darum, dass die gewohnten planetarischen Rhythmen aus dem Takt kommen – ein großes, fein abgestimmtes Orchester bricht ein. Der Mensch ist der Störenfried, dessen wenige Jahrhunderte dauerndes heilloses Wirken einem diverse Millionen Jahre währenden organischen Prozess die Luft abdreht.
Der Leser erschrickt ob der zahlreichen Beispiele, etwa des Petoukhov-Effekts, der aufgrund des Rückgangs der Eisdecke der Barents-See über dem Polarmeer ein starkes Hochdruckgebiet ausbildet, das über eine konstante Ostströmung die Regionen bis locker nach Mitteleuropa mit klirrend kalter Luft versorgen kann, und sehr konkret spielen Extremwetterlagen wie Dauerregen, Hagelschlag, Sturm, Dürre eine Rolle im Hinblick auf Ernteerträge, möglicherweise gibt es die Normalität gar nicht mehr, man weiß das nicht.
Diese Dimension ist neu
Schellnhuber zeigt an zahlreichen Beispielen Sinn und Zweck der Klimafolgenforschung, so die Frage nach der Aufrechterhaltung der Stromversorgung dort, wo die Gletscher schmelzen, die Versorgung aber auf Wasserkraft basiert, in Österreich und Indien. Es gilt zu retten, was zu retten ist, und weitsichtig umzusteuern.
Das gab’s auch früher, sicher, wir lesen über die Einflüsse klimatischer Veränderung auf die Historie des Menschen, z. B. die Eroberungen Dschingis Khans und dessen fruchtlose Versuche, mit einem überlegenen Heer Japan zu erobern, die Hungersnot in Irland, den Kollaps der Ming-Dynastie, die Auswirkungen der ausgeprägten El-Nino-Episode auf die britische Kolonie Indien u.a.m. – das Werk wird oft genug zu einem Schmöker, den man nicht leicht aus der Hand legt, es ist lehrreich und wird ein Augenöffner im Hinblick auf erbarmungslos marktradikale Politik im neunzehnten Jahrhundert, es gibt nichts Neues unter der Sonne, nur dass heutzutage die Dimension planetarisch ist, vulgo: dieser Schuh ist groß, vielleicht zu groß.
Gefällige Narrative
Schellnhubers Wortwahl einer »Zivilisationsgeschichte der Menschheit«, die von einer »Aufwärtsbewegung« geprägt sei, zeigt, dass er sich vom Fortschrittsdenken nicht loslösen will, die technologische Entwicklung, auf der ja seine Arbeit beruht, ist für ihn conditio sine qua non.
Hinsichtlich des Zustands einer Gesellschaft gebe es »nur Fortschritt, Stagnation oder Niedergang«. Und, na klar, wenn einer nicht weiß, was gerade Sache ist, steht er halt »am Beginn einer noch größeren Umwälzung« und nennt das gern auch »Innovationsschübe«. So lassen sich die Tatsachen mittels Sprache in ein gefälliges Narrativ kleiden. Im Gegensatz dazu sind jedoch die von Joachim Schellnhuber ausgebreiteten Sachverhalte haarsträubend, und man erwartet zurecht, dass eine grundlegende Veränderung des Umgangs mit Natur eingefordert wird – ein neues Narrativ.
Macher 2.0
Auch die Pathologie wirkt halbherzig dargestellt. Die im neunzehnten Jahrhundert neu einsetzende Epoche nennt er wohlwollend »Maschinenzeitalter«, das »einen neuartigen Konsumrausch« habe bedienen müssen, der Sklavenhandel des achtzehnten Jahrhunderts sei Beispiel für eine funktionierende »Wertschöpfungskette«, begleitet von der Industrialisierung und Auflösung des britischen Feudalsystems, und seitdem werde »die Unterwerfung der Naturkräfte durch die Menschheit mit brutaler Konsequenz […] fortgesetzt«.
Moment. Sein Ziel – an dem im Potsdamer Institut gearbeitet wird – ist, eine »Systemanalyse der Erde« zu erstellen, einen »Erdsimulator […], der alle möglichen Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen den planetarischen Hauptkomponenten […] der Systemevolution berücksichtigen würde«, und Schellnhuber schränkt selbst ein, dass Ergebnisse von den verfügbaren Informationen, also vom Wissensstand, abhängig seien. Letztlich ist das jedoch ein alter Hut, zeitgemäß verpackt, und einmal das Blendwerk der Rechner beiseitegelegt, sehen wir in Potsdam eine neue Generation der Macher am Werk, eine Speerspitze im besten Sinne soliden intellektuellen Handwerks, kreativ und mit großer Freude an ihrer sinnstiftenden Arbeit.
Mechanik und mehr
Die Szenarien, die dem Weltklimarat seitens der Wissenschaftler vorgelegt wurden, basieren auf unterschiedlichen Prämissen. Für den Fall fehlender klimapolitischer Interventionen wird ab ca. 2100 eine mittlere Temperatursteigerung von etwa 8 °C prognostiziert, günstigstenfalls ist eine lang anhaltende Erwärmung von 2 °C erreichbar. So drastisch die Konsequenzen jeglicher Erwärmung sein mögen, so klar ist, dass allein die Reduktion der CO2-Emissionen sie reduzieren kann; Schellnhuber nennt die »2-Grad-Linie« eine »Brandmauer«. Sie wurde auf dem Desaster von Kopenhagen 2009, so kann’s gehen, anerkannt und ein Jahr später in Cancún als Orientierungsmarke für den gemeinsamen Klimaschutz bestätigt.
Schellnhuber benennt dann das zentrale Gefährdungspotenzial, die »Kippelemente« im »Erdgetriebe« bzw. in der »planetarischen Maschinerie«. Auch das hatten wir schon, es ist ein mechanistischer Blick auf das Geschehen.
Die Saite und der schräge Ton
Der kann hilfreich sein, wenn man das Fahrrad repariert, doch sein Wirkungsbereich ist begrenzt, und dass rein mechanistische Verfahrensweisen die Probleme zufriedenstellend lösen werden, darf bezweifelt werden. Denn es geht ebenfalls um den Erhalt der hochsensiblen Komplexität des Lebens.
Die pragmatische Arbeit des Potsdamer Instituts, die Klimafolgenforschung, ist jedoch unzweifelhaft von elementarer Bedeutung, sie wird hoffentlich dazu beitragen, drängende Probleme zu bewältigen. Und es geht keineswegs um menschliche Eingriffe in die ›Mechanik‹, sondern – Reduzierung des CO2-Ausstoßes – um eine behutsame Anpassung, eine Wieder-Annäherung an den status quo ante, schwierig genug, ähnlich dem Stimmen eines Klaviers, bei dem eine Saite einen schrägen Ton hervorruft, der das Konzert gefährden würde.
Kulturelle Wurzeln
Hochinteressant und überaus angebracht sind Schellnhubers Ausfälle gegen die imperialistische Ausbreitung des westlichen Lebensstils, die westliche »Verschwendungssucht«, dubiose Machenschaften der Brüder Charles und David Koch, US-amerikanischer Oligarchen, bei ihrem »Ringen um Freiheit«; in der Macht des Geldes und dessen Dominanz über politische Entscheidungen sieht er zentrale Hindernisse auf dem Weg zu einer rationalen Klimapolitik, aber auch im alltäglichen, an kurzsichtigem Eigennutz orientierten Denken.
Schellnhuber weist darüber hinaus auf schwerwiegende ungelöste Fragen hin, etwa die von einer etwaigen ›Umsiedlung‹ betroffenen Regionen. Wo sollen die Menschen ›angesiedelt‹ werden? Wie soll das gehen? Kann kulturelle Identität überhaupt bewahrt werden? Oder lässt man sich vom Vorbild der hippen Eliten leiten, die überall präsent, aber längst nirgends mehr verwurzelt sind?
›Global Divestment Day‹
Offene Fragen und ein äußerst heikles Thema jenseits der rein mechanistischen Herangehensweise. Eine ungezügelte Erderwärmung werde in jedem Fallle eine »große humanitäre Krise« auslösen, und Schellnhuber zitiert Befürchtungen, dass sie »zu gewaltigen Migrationsströmen und schließlich zum planetarischen Überlebenskampf um Boden, Wasser und andere Lebensressourcen führen muss«.
Er geht ausführlich auf die Divestitionsbewegung ein und setzt große Hoffnung in diese Form des Protests, ja aktiven Widerstands. Am ›Global Divestment Day‹, dem 13. Februar 2015, fanden in vielen Ländern Aktionen statt, bei denen Kapitalanleger aller Art aufgefordert wurden, ihre Gelder aus den zweihundert umsatzstärksten Konzernen der Fossilindustrie zurückzuziehen.
Die höchst lehrreiche Episode vom Kirschenessen
Man fragt sich, worüber an einem solchen Tag unsere Großbuchstabengazetten schreiben, wie man sich generell während der Lektüre häufig fragen musste, weshalb unsere sogenannten Leitmedien einer tumben Celebrity-Kultur hinterherhecheln, anstatt dass sie über Details und Bedrohungen der sich bereits ereignenden Erderwärmung informieren.
Der britische ›Guardian‹ führt eine vorbildliche Kampagne ›Keep it in the ground!‹ mit dem Ziel, die weitere Ausbeutung fossiler energetischer Ressourcen einzustellen, und der Präsident der Weltbank rief auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2012 zur Divestition auf. Das lässt hoffen. Joachim Schellnhuber beschließt sein Werk mit einer höchst lehrreichen Episode vom Kirschenessen.
Titelangaben
Hans Joachim Schellnhuber, Selbstverbrennung. Die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff
München: Bertelsmann, 2015.
779 Seiten, 29,99 Euro
Erwerben Sie dieses Buch bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe