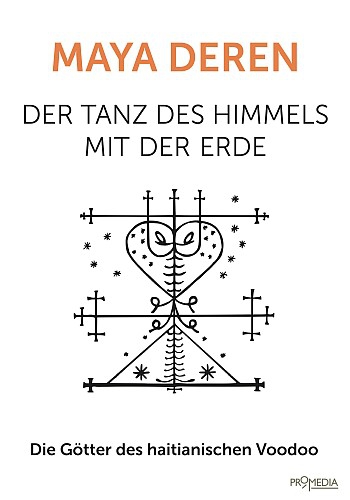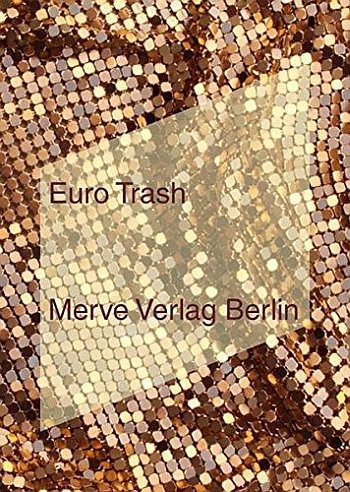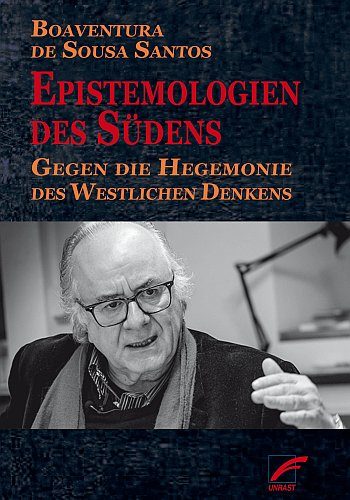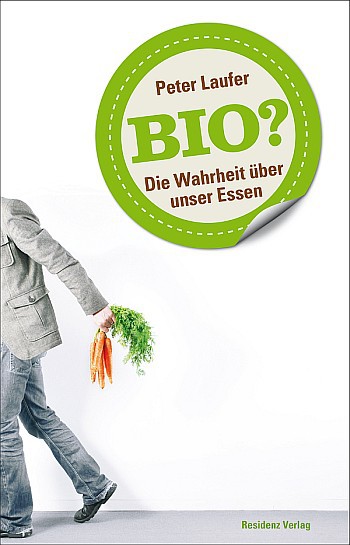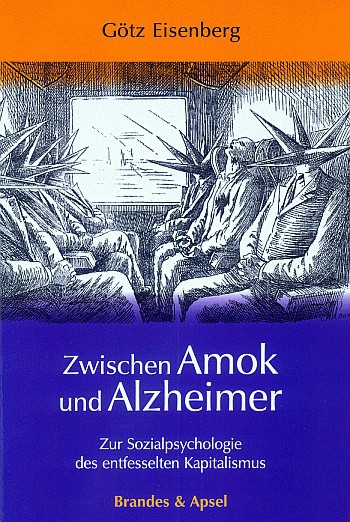Gesellschaft | Markus Metz, Georg Seeßlen: Hass und Hoffnung
›Hass‹ und ›Hoffnung‹ beschreiben die konträren Dispositionen im gegenwärtigen Flüchtlings-Hype, den man – das ganze Land ist involviert, so oder so – ähnlich verstehen darf wie den Sommermärchen-Hype von 2006, dessen korrupte Anbahnung erst heute nach und nach aufgeblättert wird – ohne Moos nichts los, so geht’s. Von WOLF SENFF
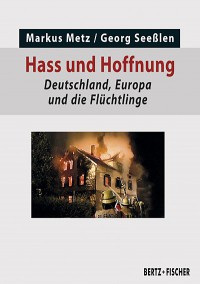 Postdemokratisches Regieren, so Seeßlen und Metz in Anlehnung an Carl Schmitt und Giorgio Agamben, baue darauf, das ein Ausnahmezustand hergestellt und dauerhaft reproduziert werde: Krieg gegen den Terror, Finanzkrise, Griechenland-Krise und nun Flüchtlingskrise, der Text ist auf der Höhe der Zeit.
Postdemokratisches Regieren, so Seeßlen und Metz in Anlehnung an Carl Schmitt und Giorgio Agamben, baue darauf, das ein Ausnahmezustand hergestellt und dauerhaft reproduziert werde: Krieg gegen den Terror, Finanzkrise, Griechenland-Krise und nun Flüchtlingskrise, der Text ist auf der Höhe der Zeit.
Wohlstand? Demokratie? Nation?
Unter diesen Vorzeichen erweisen sich einst zentrale Begriffe – »Narrative« – wie Wohlstand, Demokratie, Nation als Schimären. ›Nation‹ etwa, gar ›Kultur‹, das sei real bloß noch eine »Inszenierung der Unterhaltungsindustrie«, Seeßlen und Metz sehen uns in einem von Dispositiven, Mythen und Ökonomisierungen regierten »geschmeidigen Übergang« hin zu einem oligopolistischen Finanzkapitalismus.
In der Ukraine-, der Griechenland- und der Flüchtlingskrise seien erkennbar keine offenen Debatten mehr geführt worden, sondern es sei Kampagnenjournalismus betrieben worden, »Dispositive« (Agamben) wurden ans Volk ausgegeben. Atmosphärisch seien diese Dispositive geprägt durch Nationalisierung, Militarisierung und Dehumanisierung. Anders gedreht, real, sei dies wiederum ein Symptom des Auseinanderbrechens von Wohlstand, Demokratie, Nation. Damit dürfte der aktuell dominante politische Trend treffend wiedergegeben sein.
Öffentlich verbalradikal
Seeßlen und Metz stellen die mit der Integration verbundenen Probleme – rechtliche Stellung, Arbeitsbedingungen, Wohnungsversorgung – konkret und sachgerecht dar; sie arbeiten die niederträchtige, unmenschliche Haltung der lautstark und aggressiv auftretenden Pegida-Front heraus, die diese auf dasselbe Niveau wie den Front Nationale, die skandinavischen Neofaschisten, die »wahren Finnen« sortiere.
Real zeigen sie besonders in ihrer dezidierten Darstellung der bayrischen Haltung, dass es starke und einflussreiche integrative Bestrebungen gibt, z. B. seitens der katholischen Kirche, die selbst von einer lautstark und aggressiv auftretenden CSU nicht ignoriert werden können; die Flüchtlingspolitik an sich, von öffentlichem Verbalradikalismus einmal abgesehen, arbeite durchaus effektiv.
Demütigungen vs. Fürsorge
Mit dem unversöhnlichen Auftreten Seehofers seit ca. Oktober, einer »Rhetorik von Abschreckung, Herabwürdigung und Denunziation«, werde – der Realität in den Kommunen zum Trotz – gezielt Macht- und Parteipolitik betrieben, die Flüchtlinge würden politisch instrumentalisiert. Wichtige Landtagswahlen stehen ins Haus.
Es sei ein Konflikt entstanden zwischen zivilgesellschaftlicher Fürsorge und administrativer Abschreckung und Demütigung; generell positiv schätzen Seeßlen und Metz jedoch die Tatsache ein, dass allein die Notwendigkeit, den Flüchtlingen zu begegnen, diese Gesellschaft verändern werde.
Geopolitische Fronten
Abschließend gehen sie auf den Zusammenhang von westlicher Zivilgesellschaft und Islamischem Staat ein, der einer Schätzung Interpols zufolge über dreißig Prozent seiner etwa 25.000 Soldaten aus Europa rekrutiere – an der kaltschnäuzig betriebenen Entsolidarisierung dieser ›Zivilgesellschaft‹ gescheiterte Existenzen. Unübersehbar hängt eins am anderen, die Gesamtlage hat unverkennbare Qualitäten von Schizophrenie.
Realiter führe der Weg einer ›alternativlosen‹, ›marktkonformen‹ Demokratie in ein Schreckensszenario zwischen einerseits diktatorischem IS und andererseits einer die Grundlagen der Zivilgesellschaft ruinierenden neoliberalen Politik. Markus Metz und Georg Seeßlen zeigen in ihrer hochaktuellen Untersuchung, wie sehr die Lage derzeit Spitz auf Knopf steht.
Titelangaben
Markus Metz, Georg Seeßlen. Hass und Hoffnung. Deutschland, Europa und die Flüchtlinge
Berlin: Bertz + Fischer 2016
260 Seiten, 9,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Inhaltsverzeichnis
| Leseprobe