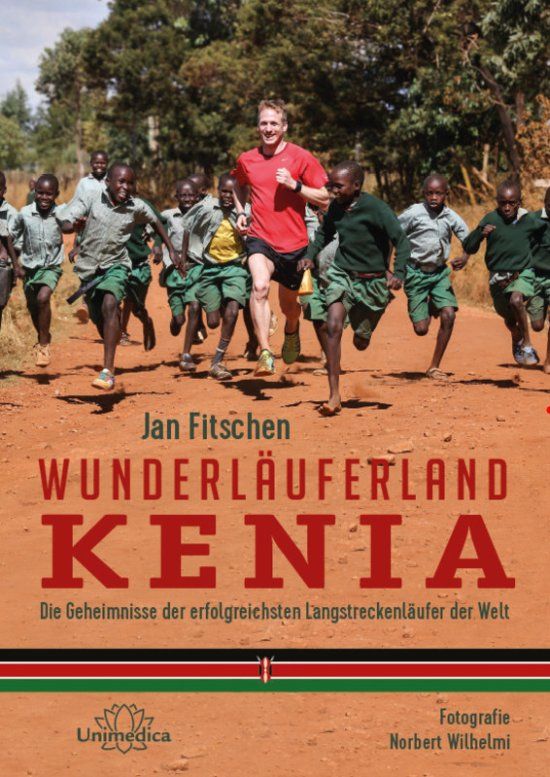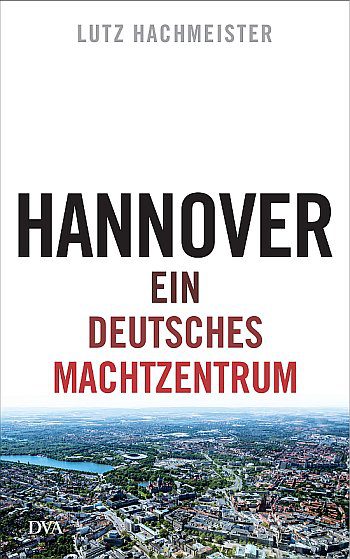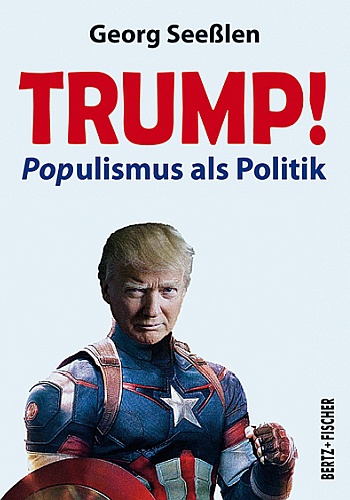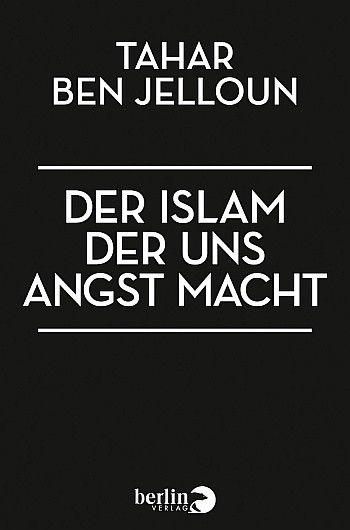Gesellschaft | Harald Welzer: Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit
Gegenwärtig wird viel sachlich fundierte, ernstzunehmende Kritik an den Zuständen westlicher Gesellschaften geübt – und die Mutter blicket stumm / auf dem ganzen Tisch herum. War nicht vor ein paar Jahren noch jedermann eifrig bemüht, ›Reformen‹ einzuleiten? Wurde nicht beflissen ›dereguliert‹? Und jetzt? Was ist? Ende Gelände? Tote Hose? Von WOLF SENFF
 Dem Michel wird beredt erklärt, wie kompliziert die Lage sei. Der Finanzminister wirft alle naselang aus, dass eine Neuordnung des Finanzsystems unverzichtbar sei und endlich, endlich die Finanztransaktionssteuer eingeführt werden müsse, das hat er vor zehn Jahren schon gesagt, mindestens.
Dem Michel wird beredt erklärt, wie kompliziert die Lage sei. Der Finanzminister wirft alle naselang aus, dass eine Neuordnung des Finanzsystems unverzichtbar sei und endlich, endlich die Finanztransaktionssteuer eingeführt werden müsse, das hat er vor zehn Jahren schon gesagt, mindestens.
Ausgehebelte Demokratie
Er redet und redet – es geschieht null. »Something is rotten in the state of Denmark«. Aber auch: »Germans are honest men«. Dieser Satz spräche vielleicht sogar für den Finanzminister, es handelt sich jedoch um eine Zeile aus ›The Merry Wives of Windsor‹, da müssen wir vorsichtig sein.
Harald Welzer sieht uns in einem Prozess befindlich, der des Finanzministers Tatenlosigkeit einleuchtend begründet. Wir befänden uns, sagt Welzer, längst in einer Entwicklung, in deren Verlauf sich der Kapitalismus der Demokratie entledige, traditionelle integrative Formen gesellschaftlicher Organisation, staatliche Macht inbegriffen, würden aufgelöst, an ihre Stelle träten private, weltweit operierende Unternehmen sowie staatlich-private Assoziationen.
Wurzellos
Bereits Margaret Thatcher, wir erinnern uns, erklärte, da sei »no such thing like society«, und tatsächlich, je mehr Jahre ins Land ziehen, desto klarer sehen wir, dass sie den Nagel auf den Kopf trifft. Und auch der Mensch verändert sich: Bei einem Popkonzert hält »mindestens ein Viertel der Besucher Smartphones in die Höhe, die das Konzert aufzeichnen, man selbst unterhält sich derweil«.
Bäume schlagen Wurzeln, richtig, doch auch der Mensch soll sich verwurzelt fühlen, und das scheint verloren zu gehen. Man darf diesen Verlust nicht kleinreden, und Harald Welzer bringt Beispiele und erklärt Zusammenhänge, dass es gruselt.
Begriffsverwirrungen
Das Leben läuft uns aus dem Ruder. Gar nicht lange ist es her, da wurde von ›Konsumterror‹ geredet; dieses Wort kam uns im Gefolge der politischen Säuberung der Sprache abhanden. Die Zustände selbst allerdings – Konsumentenkontrolle per Facebook, Google, Amazon etc. p.p. – sind Welzer zufolge weit schlimmer als zuvor; der Konsument werde überwacht wie nie, ohne dass er das Geschehen als Überwachung wahrnähme. Es bilden sich totalitäre Strukturen heraus, doch auch das Wort ›totalitär‹ scheint aus der öffentlichen Rede beseitigt worden zu sein.
Welzer arbeitet daran, geläufige Begrifflichkeiten auf ihren Gehalt abzuklopfen, und unversehens zeigen sich die Dinge in einem anderen Licht. Globalisierung sei real keineswegs ein Gewinn, sondern eine Reduktion von natürlicher Komplexität, ein »Absteigen auf eine niedrigere Stufe der Organisation«, und er illustriert dies u.a. am Zusammenhang zwischen spezifisch moderner Wirtschaft und dem Artensterben.
Totalitäre Phantasien
Er verfasst seine Ausführungen mit erheblichem Bauchgrimmen, und der Leser wird angenehm berührt von diesem gerechtfertigten Zorn. Kann man höflich bleiben angesichts eines Prozesses, der längst zielsicher auf die Wand zusteuert und dennoch, teils aus kaltblütigem Eigennutz, teils aus grenzenloser Dussligkeit, nicht aufgehalten wird? Angesichts von Medien, die Artigkeiten an ihresgleichen austeilen? Die Fakten sind ja bekannt, auch der erwähnte Finanzminister weiß um die Notlage und äußert starke Worte, mehr ereignet sich nicht.
Beinharter, kaltblütiger Eigennutz sind Maßstab für die radikal antidemokratische und staatsfeindliche Haltung eines Peter Thiel, PayPal-Mitbegründer, oder eines Nicolas Berggrün, Hedgefonds-Milliardär, oder eines Eric Schmidt, Google, und man wundert sich sehr, wie viel Ehrerbietung derartigem Personal nebst den Zuckerbergs und Kurzweils seitens Politik und Medien entgegengebracht wird. Welzer zitiert Kostproben aus dem hirnverbrannten Unsinn, den »totalitären Phantasien« dieser Leute, deren Machwerke, wieso eigentlich, von renommierten Verlagen publiziert werden.
Ausgebufft abgezockt
Hinzufügen ließe sich, dass bereits deren Geschäftsmodell beispiellos ist. Erwerben wir einen PKW oder einen Kühlschrank, bei dem der Hersteller kontinuierlich Teile ergänzen, nachbessern, ›updaten‹ muss, ohne dass wir überhaupt ahnen, was sich abspielt? Der ›Virus‹-anfällig ist, zeitweilig ›abstürzt‹, dessen Funktionsfähigkeit mittels ›Firewall‹ abgesichert werden muss und dessen Weichteile periodisch zu erneuern sind?
Die systemisch verankerte Störanfälligkeit garantiert, dass der Rubel für diverse Geschäftsbereiche heftig rollt. Das erfreut die Bilanzen der beteiligten Unternehmen und liefert eine unerschöpfliche Grundlage für die weltweit aufwendig betriebene Inszenierung einer technologischen ›Innovation‹.
Von der Katze und dem Computer
Man wundert sich, wie kritiklos öffentliche Repräsentanten jenen selbsterklärten Feinden staatlicher Ordnung begegnen. Mittlerweile, so Welzer, hätten sich diverse global mächtige Unternehmen etabliert, die von staatlichen Institutionen nicht mehr kontrollierbar seien und Steuerzahlungsverpflichtungen locker ignorieren können. Da wartet viel Arbeit, Herr Finanzminister, seit Jahren schon.
Und folgt man unvoreingenommen den Gedanken Welzers, ist es letztlich völlig unstrittig, dass der Mensch sich in eine jämmerliche Verirrung begeben hat. Wie kann er Computer mit ›Intelligenz‹ in Verbindung bringen? In einem amüsanten Hinweis auf seine Katze Cooper zeigt Harald Welzer, wie absurd und lächerlich es ist, diese Geräte ›intelligent‹ zu nennen.
Lass mal drei Tage vergehen
Aber irgendjemand hat uns daran gewöhnt. Computer können angeblich ja auch ›lesen‹, sie heißen uns ›willkommen‹ usw. usf., und offensichtlich liegt dem eine immanente Tendenz zugrunde, die Unterschiede zwischen Automaten und Menschen zu verwischen bzw. den lebendigen Menschen auf das Niveau geistloser Automaten herunterzuziehen.
Außerdem weist er auf die generelle Anfälligkeit digital vernetzter Systeme hin. Drei Tage Stromausfall, und man könne von NSA bis Krankenhaus so ziemlich alles vergessen. Bei dem sich rasant und unkalkulierbar verändernden Klima wird man nicht lange darauf warten müssen, die Reaktion wird Heulen und Zähneklappern sein, ein Katzenjammer. Vorsorge zu treffen, das ist teuer und bringt keinen Ertrag. Der immense Energieverbrauch der NSA, die deshalb in 2014 gar Gelder zum Bau neuer Atomkraftwerke beantragt habe, werde kommentarlos hingenommen.
Ein Kartenhaus
Wunderschön befreiend eine Passage, in der er sich über »Google und all die anderen« lustigmacht; sie »lösen ausschließlich Probleme, die wir nie gehabt haben«. Oder, fragt er, war es »jemals ein Problem, die Heizung hochzudrehen, wenn Sie fröstelten« oder das »Haus eines Freundes anzusteuern, den man besuchen wollte«.
Er dekonstruiert, und plopp! bricht die so wichtigtuerisch aufgeblasene Internet-Chose wie ein Kartenhaus ein. Allenfalls »triviale Probleme« würden durch Google & Konsorten gelöst, wir lesen eine Philippika.
Neu justiert
Es wird Zeit, dass wir diese Produkte der Spaßgesellschaft und ihrer binären Traumtänzer dorthin legen, wohin sie gehören: in die unteren Schubladen. Harald Welzer rückt verloren gegangene Maßstäbe zurecht. Die realen Probleme seien nach wie vor Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Ausnutzung von Macht etc., moderne Gesellschaften begegnen ihnen mit Recht und Gesetz, mit Gewaltenteilung, Demokratie, Lebenssicherheit und garantieren diese mittels staatlicher Institutionen und eben nicht durch Märkte oder Algorithmen – »Also glauben Sie den ganzen Quatsch nicht«.
Damit sind zwar die realen Probleme, die er beschrieben hat, nicht gelöst, aber offensichtlich stimmt zunächst einmal seine Neujustierung der Wirklichkeit, und die komplette IT-Welt entpuppt sich als eine gigantische Nebelkerze, die ihren Schleier vor die anstehenden, drängenden politischen Probleme legt.
Er hat ja recht
Insofern ist die Konsequenz, die er zieht, folgerichtig: Unsere Zukunftsentwürfe dürften nicht länger an die »öden Phantasien technologischer Machbarkeit« angehängt werden, denn diese »Utopie der smarten Diktatoren« sei armselig, weil sie aufgrund ihrer radikal monopolistischen Zielsetzung die Handlungsalternativen systematisch reduziere: »was diese Welt bietet, ist ein multioptionales Konsumuniversum«.
Das Leben in einer demokratisch organisierten Gemeinschaft orientiere sich am Gegenteil: an einer Vielzahl von Möglichkeiten und einem selbst gestalteten sozialen Lebensumfeld. Was kann man dagegen vorbringen. Er hat ja recht.
Er hat ja recht
Und er verweist auf Beispiele, wie man die smarten demokratiefeindlichen Hohlköpfe, die sich mit der Aura von Diktatoren umgeben, aufs Glatteis führt – mit »paradoxen Interventionen«, viel Phantasie und künstlerisch inspirierten Aktionen wie etwa denen von Rimini-Protokoll, Yes-Men, Peng!, die eine situationistische Ästhetik des Protests herausbilden.
»Die schöneren Menschen, die lustigeren Ideen, die stärkere Gemeinschaft ist dort, wo der Protest ist, die Ödnis dort, wo die Macht ist.« Was kann man dagegen vorbringen. Er hat ja recht. Lesen Sie’s.
Titelangaben
Harald Welzer: Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit
Frankfurt/Main: S. Fischer 2016
320 Seiten, 19,99 Euro
Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe