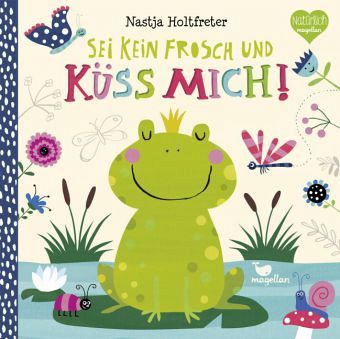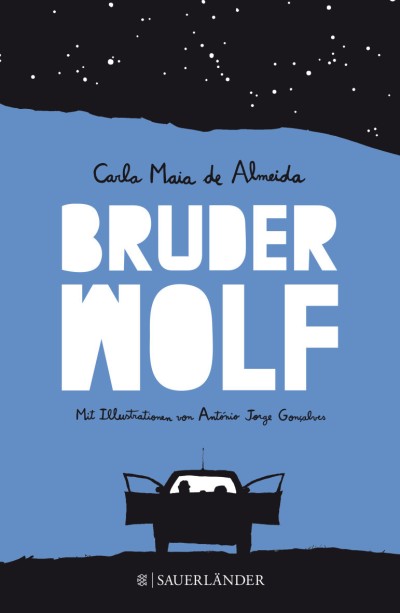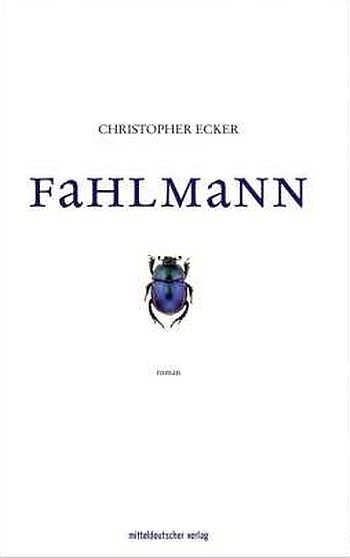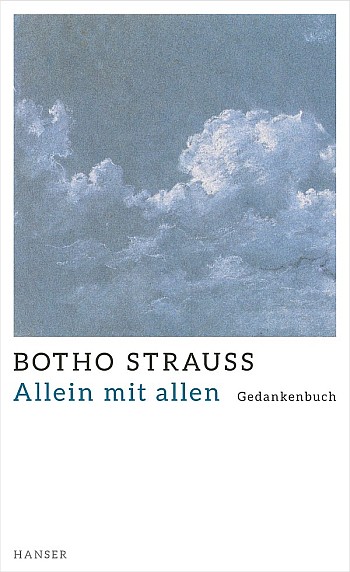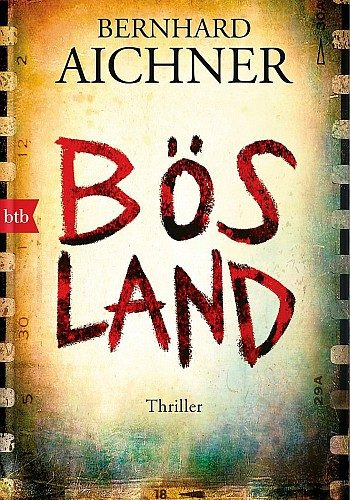Roman | Abbas Khider: Ohrfeige
Es gibt Romane, die erscheinen exakt zur richtigen Zeit, um Diskussionen zu befeuern: Ohrfeige von Abbas Khider ist so einer. Es geht darin um einen jungen Mann aus dem Irak, der in Europa studieren und sich medizinisch behandeln lassen möchte. In Deutschland erwarten ihn allerdings nur unüberwindbare bürokratische Hürden und Fremdfeindlichkeit. Der Roman kann als Debattenbeitrag zur sogenannten Flüchtlingsfrage gelesen – und als literarische Ohrfeige für den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland. Von VALERIE HERBERG
 Der Roman beginnt damit, dass dem jungen Iraker, Karim Mensey heißt er, die Sicherungen durchbrennen. Er hat als Asylsuchender seit Jahren in Deutschland gelebt und ist schließlich doch ausgewiesen wurden. Also sucht er seine Sachbearbeiterin Frau Schulz in der Ausländerbehörde ein letztes Mal auf und zwingt sie, sich seine Geschichte anzuhören.
Der Roman beginnt damit, dass dem jungen Iraker, Karim Mensey heißt er, die Sicherungen durchbrennen. Er hat als Asylsuchender seit Jahren in Deutschland gelebt und ist schließlich doch ausgewiesen wurden. Also sucht er seine Sachbearbeiterin Frau Schulz in der Ausländerbehörde ein letztes Mal auf und zwingt sie, sich seine Geschichte anzuhören.
Die Figur Karim erzählt als rückblickend von ihrer Kindheit und Jugend im Irak, von ihrer Reise nach Deutschland und ihrem Versuch, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Er berichtet, dass er direkt nach seiner Ankunft festgenommen wird, dass er hart arbeitet und ihm die Bürokratie trotzdem immer Steine in den Weg legt, und die Terroranschläge vom 11. September ihm endgültig einen Strich durch die Rechnung machen. »Die zahlreichen Paragrafen und Vorschriften, die dieses Land unter sich begraben, wenigsten einigermaßen zu begreifen wurde zu meiner wichtigsten Aufgabe, Frau Schulz. Den irakischen Behördenapparat habe ich bezeiten hassen gelernt […] Nun aber gab mir die stumpfsinnige entseelte deutsche Verwaltung wirklich den Rest.«
Lügende Flüchtlinge und deutsche Freier
Daneben tauchen andere Figuren aus dem Dunstkreis des Asylsuchenden Karim auf. Es sind unfähige Polizisten und reiche Deutsche, die Flüchtlinge für Sex bezahlen. Es sind Iraker, die sich Frauen aus ihrer Heimat kaufen, weil ihnen die deutschen Frauen nicht willig genug sind und Menschen, die sich Geschichten ausdenken, um Asyl zu bekommen. »Nach meiner Verhandlung habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, Schriftsteller zu werden. Ich bin ein großer und guter Lügner. Aber ich bin hier wirklich nicht der einzige, für den das gilt.«
Die Figuren, die Abbas Khider entwirft, sind glaubwürdig konzipiert und dynamisch. Als Leser muss man sich zwischendurch hin und wieder daran erinnern, dass die Erzählung fiktiv ist (auch wenn es sicherlich Tausende ähnliche Schicksale gibt). Karim, der aus seiner Perspektive berichtet, erzählt ist lakonisch und nüchtern. Der Erzähler bedient sich einer einfachen Sprache, es wird viel geflucht.
Debattenbeitrag: Literarische Ohrfeige für deutsches Asylsystem
Auch wenn die Zeit, in der der Roman spielt, schon einige Zeit zurückliegt – er spielt hauptsächlich in den Neunzigern und den Nullerjahren – ist es unmöglich, ihn nicht im Licht der aktuellen Ereignisse zu lesen. Wie geht Deutschland mit Asylsuchenden um? Sind die Kriterien sinnvoll, nach denen entschieden wird, wer bleiben darf und wer wieder abgeschoben wird? Khider porträtiert das deutsche Asylsystem als schwerfälliges und wirkungsloses Konstrukt, das ehrliche und hart arbeitende Menschen in die Kriminalität zwingt.
Geltende Überzeugungen stellt der Roman infrage. So ist die Figur Karim keine arme und verfolgte Kreatur, die sich schon freut, wenn sie ein Dach über den Kopf hat. Er ist wütend und verbittert, und lässt seine Gefühle an seiner Sachbearbeiterin aus. Ein Mensch, der als Lösung nur noch die Gewalt sieht, und sich gegen den erstbesten richtet, der scheinbar für seine Misere verantwortlich ist – dieses Muster erinnert an Rechtsradikale, die ihren Frust an Flüchtlingen auslassen. Spoiler Alert: Am Ende des Romans zeigt sich, dass Karim doch gar nicht so übel ist.
Klischees und Real-Life-Erfahrung für den Leser
Der Roman kann als Debattenbeitrag gelesen werden, der neue Aspekte der Diskussion um Flüchtlinge in Deutschland aufzeigt. Er kann neue Perspektiven aufzeigen und Überzeugungen überdenken lassen. Abgesehen davon hat der Roman eher wenig zu bieten. Die Sprache ist lediglich Mittel zum Zweck und die Auflösung etwas enttäuschend. Ein weiteres Manko: Der Roman bedient sich vieler Klischees, was seine Aussagekraft etwas schwächt. So die Deutschen im Roman besessen von Mülltrennung, und in Bayern darf man sich alles leisten, solange man nur eine Süddeutsche Zeitung unter dem Arm trägt.
Damit schafft Khider es allerdings, die Leser Karims Frustration hautnah miterleben zu lassen. Die Ermüdung und der Zynismus der Figuren übertragen sich irgendwann auf den Leser. Ohrfeige ist definitiv kein Gute-Laune-Roman – und will das auch gar nicht sein.
Starke Figuren und Zeitbezug machen Ohrfeige zum lesenswerten Roman
So wie Asylsuchende nicht grundsätzlich gute Menschen sind, sind Romane über sie nicht grundsätzlich gute Romane. Ohrfeige ist ohne Zweifel ein wichtiger und definitiv kein schlechter Roman – vor allem die starken Figuren und die Fähigkeit, neue Aspekte in der sogenannten Flüchtlingsdebatte aufzuzeigen, zeichnen ihn aus. Es ist allerdings fraglich, ob ihm so große Aufmerksamkeit zuteilgeworden wäre, wenn er zu einem anderen Zeitpunkt erschienen wäre. So oder so: Wer sich für die Flüchtlinge in Deutschland, das deutsche Asylsystem und überhaupt das Leben in Deutschland in all seinen Facetten interessiert, wird Ohrfeige mit Gewinn lesen.
| VALERIE HERBERG
Titelangaben
Abbas Khider: Ohrfeige
München: Hanser 2016
224 Seiten. 19,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe