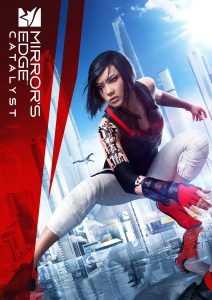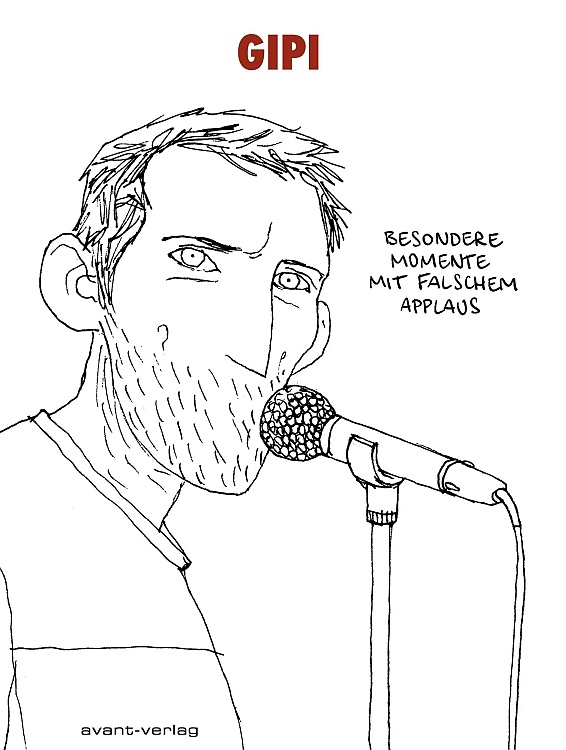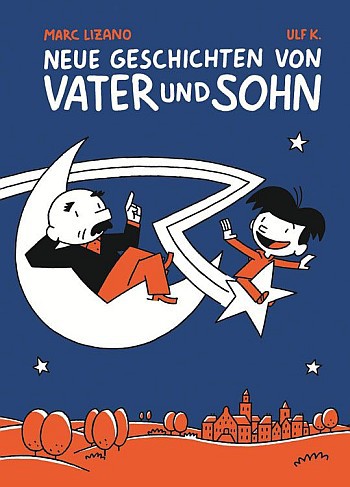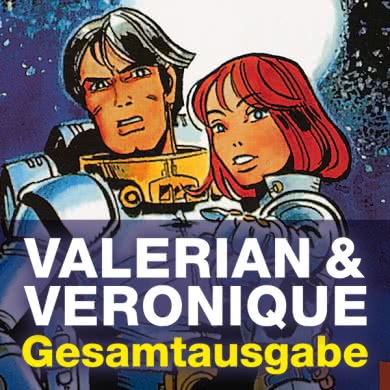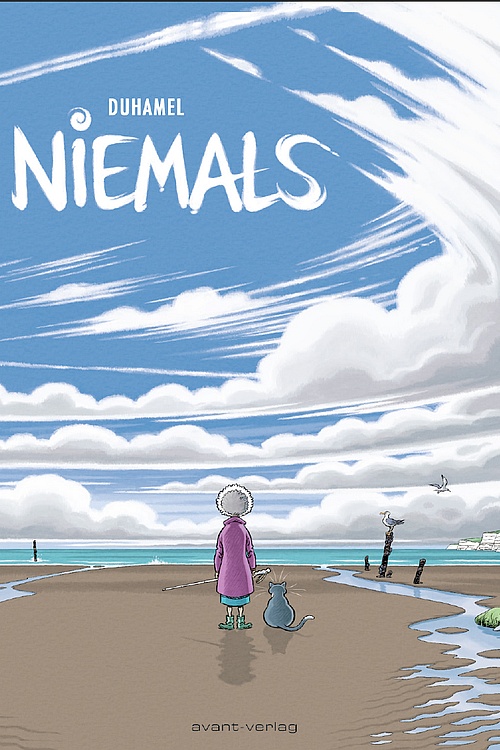Comic | Yi Luo: Running Girl / Aisha Franz: Shit is real
Unter den deutschen Comic-Zeichnerinnen mit Migrationshintergrund scheint es derzeit einen Trend zu gehen: Den, Geschichten zu kreieren, die die Probleme des Alltags von Frauen behandeln, die in irgendeiner Weise – sei es soziokulturell oder -ökonomisch – von der Gesellschaft exkludiert werden oder die es sogar präferieren, sich selbst von der Gesellschaft zu distanzieren. Dies kann auf mannigfaltige Weise geschehen, melancholisch, depressiv, verzweifelt, aggressiv oder sarkastisch. PHILIP J. DINGELDEY hat sich zwei dieser Graphic Novels angesehen, nämlich ›Running Girl‹ von Yi Luo und ›Shit is real‹ von Aisha Franz.
 Yis Debüt ist eine autobiographische Kurzgeschichte. Sie selbst stammt aus China und lebt seit 2007 in Augsburg, wo sie Illustration studiert hat. Die Protagonistin in ›Running Girl‹ ist ihr nachempfunden und trägt sogar den Namen der Künstlerin. Yi verbringt ihre gesamte Zeit damit, entweder Kunstgeschichte zu studieren oder in einem asiatischen Restaurant zu arbeiten. Freunde in Deutschland hat sie keine. Sie ist schon zu Beginn der Geschichte eine weitgehend isolierte junge Frau, die nur geschäftliche, obgleich freundliche Beziehungen zu ihren Mitmenschen hat.
Yis Debüt ist eine autobiographische Kurzgeschichte. Sie selbst stammt aus China und lebt seit 2007 in Augsburg, wo sie Illustration studiert hat. Die Protagonistin in ›Running Girl‹ ist ihr nachempfunden und trägt sogar den Namen der Künstlerin. Yi verbringt ihre gesamte Zeit damit, entweder Kunstgeschichte zu studieren oder in einem asiatischen Restaurant zu arbeiten. Freunde in Deutschland hat sie keine. Sie ist schon zu Beginn der Geschichte eine weitgehend isolierte junge Frau, die nur geschäftliche, obgleich freundliche Beziehungen zu ihren Mitmenschen hat.
Denn obgleich sie in China die beste Studentin im Deutschkurs war, zeigt sich in ihrem Alltag in Bayern eine große Sprachbarriere. Im Studium versteht sie kaum ein Wort von dem, was ihr die Dozenten sagen, und sie zieht es vor, nicht viel Kontakt zu Kommilitoninnen zu haben, da ihr die Kommunikation sehr schwer fällt. Daneben gerät ihr Leben aus dem Ruder, weil durch die Arbeit ständig ihre Zeitpläne durcheinanderlaufen und sie hin und wieder auch noch mit xenophoben Ressentiments konfrontiert wird. Alles geht schief, als selbst diese gehetzte Regelmäßigkeit erschüttert wird, da ihr Freund in China, der kaum Zeit für sie hat, ankündigt, sie sexuell zu betrügen.
In der Kurzgeschichte passiert nicht viel, es ist eher ein Dahinplätschern im Alltag, der sukzessive destruiert wird, und in großer Trauer und Melancholie eines ohnehin schon verschlossenen und schüchternen Mädchens endet. Der Inhalt ist ergo simpel und nur wenig subtil, aber mit vielen kulturellen Implikationen aufgeladen, die sich jedem, der schon einmal irgendwo isoliert war, nahezu von selbst erschließen.
Affektiertheit und Erfolg
 Spezieller sind da schon die Aquarelle des Comics. Adäquat schafft es die Zeichnerin, ihrer Protagonisten eine eingeschüchterte Mimik zu verpassen. Ansonsten wirken die Bilder jedoch recht kindlich und grob, aber liebevoll gemalt, mit einer sehr reduzierten, aber eindrucksvollen Metaphorik, die sich vor allem beim offenen Ende wirkungsvoll entfaltet.
Spezieller sind da schon die Aquarelle des Comics. Adäquat schafft es die Zeichnerin, ihrer Protagonisten eine eingeschüchterte Mimik zu verpassen. Ansonsten wirken die Bilder jedoch recht kindlich und grob, aber liebevoll gemalt, mit einer sehr reduzierten, aber eindrucksvollen Metaphorik, die sich vor allem beim offenen Ende wirkungsvoll entfaltet.
Differenzierter und wesentlich unterhaltsamer, mit ordentlich Fantasie und Biss ist die Graphic Novel von Aisha Franz. Auch wenn die Zeichnerin von südamerikanischen Immigranten abstammt, spielt hier der Migrationsfaktor keine Rolle, während er bei Yi Luo die dominante Determinante der Geschichte war. Bei Franz geht es eher um den Status von Frauen, sprich um Geld, Job und Partnerschaft, bei vielen Protagonisten inklusive affektierter Attitüde. Dabei ist ›Shit is real‹ eine Schience Fiction Graphic Novel, die in einer nahen Zukunft spielt, welche sich vor allem durch eine weitgehende Digitalisierung der Lebensformen und einer bizarren Festmode definiert. Mit dieser leichten zeitlichen Verschiebung gelingt es Franz, gegenwärtige Tendenzen des sozialen und kulturellen Lebens zuzuspitzen und mal sarkastisch, mal zynisch zu karikieren.

Dabei trifft sie Anders, jemand der ebenso exkludiert wird, da er solo ist – eine Beziehung mit Selmas Nachbarin Penelope hat nicht funktioniert – und sein Geschäft für Aquarienfische schließen muss. Die beiden nähern sich an, und für Selma verwischen sexuellen Fantasien und ernüchternde Realität. Von der Hauskatze eben jener häufig verreisten Nachbarin fühlt sich Selma animiert, in deren Designwohnung einzudringen, dort zu leben und das Apartment als das Ihrige zu präsentieren. Denn Penelope hat ihren Schlüssel verloren, den die Katze schließlich Selma präsentiert. Es ist halt, wie es immer ist: Durch eine Katze wird das Leben wieder lebenswert! Doch nach und nach drohen die Fantasien und Lügen der Protagonistin über den Kopf zu wachsen und alles zu zerstören.
Metaphern der Verzweiflung
An sich wirkt der Inhalt bereits spannend und amüsant, manchmal aber auch sprunghaft. Stilistisch wird das getoppt, indem zu Anfang jedes Kapitals eine Traumsequenz in der Wüste geliefert wird, in der alle Männer Echsen sind und Yumi eine futuristische Kämpferin auf einem Motorrad, die sie anpeitscht, sich den Weg zurück in die Gesellschaft zu erarbeiten, später auch mit Hilfe von Anders. An unsere Realität erinnert diese Zukunftsversion vor allem durch kleine popkulturelle Reminiszenzen und Übertreibungen des gegenwärtigen Lebens, wo man sich nur noch fragt: Was ist das für 1 Life? Abrupt und unbefriedigend wirkt dafür der Schluss, als auch Yumi von ihrem Freund verlassen wird, bei Selma einzieht und bei einem abermaligen zufälligen Treffen mit Anders nicht komplett aufgelöst wird, was nun alles ihre Einbildung und was die Wirklichkeit war.

Unterschiedlicher in der Ausfertigung könnten diese beiden Graphic Novels von aufsteigenden jungen deutschen Zeichnerinnen kaum sein, doch der Topos der Exklusion ist faktisch identisch. Beide zu lesen und zu vergleichen lohnt sich ergo nicht nur wegen den unterschiedlichen Stilrichtungen in unterschiedlichen Qualitäten, sondern auch um die verschiedenen Lösungsversuche der Protagonistinnen zu zeigen – von der totalen Isolation bis zum Kampf zurück in den Kreis einer pervertierten Gesellschaft. Beide sorgen dafür, trotz des Humors von Franz, dass sich der Leser sowohl mit der selbst gewählten Isolation als auch mit der Dialektik, die sich im Kampf zurück in die Gesellschaft offenbart, unwohl zu fühlen, was vor allem durch das Aufgehen in Fantasie und Metaphorik unterstrichen wird. Daher stellt sich die Frage, inwiefern die beschriebenen und rekonstruierten Lebens- und Gesellschaftsformen der fundamentalen Kritik bedürfen – egal, ob man bei der Bekämpfung der Isolation bei der Gesellschaft ansetzt, wie Aisha Franz, oder beim Individuum, wie Yi Luo, und egal, ob der Fokus der Ungleichheit auf der Migration oder dem sozialen Prestige liegt.
Titelangaben
Yi Luo (Texte und Zeichnungen): Running Girl
Berlin: Reprodukt 2016
32 Seiten, 10,00 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Aisha Franz (Texte und Zeichnungen): Shit is real
Berlin: Reprodukt 2016
288 Seiten, 24,00 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander