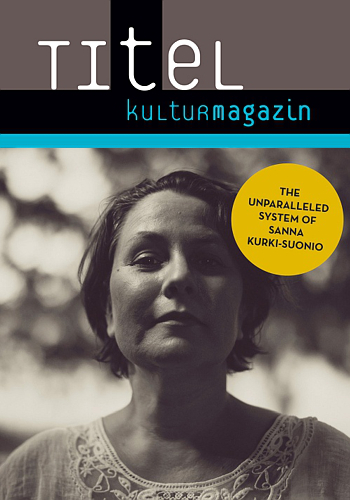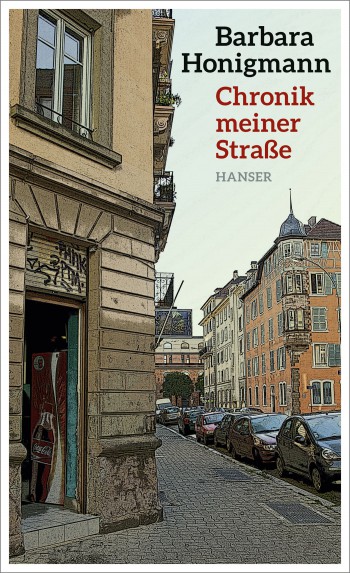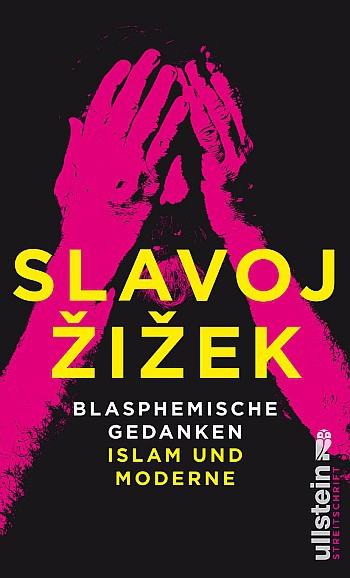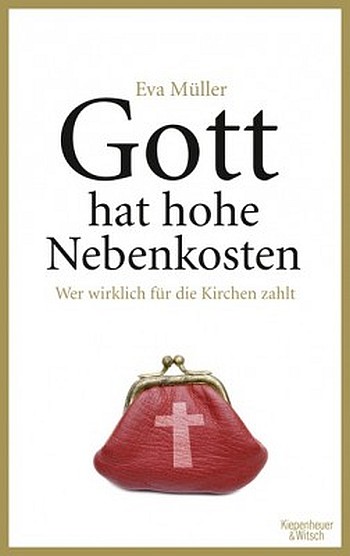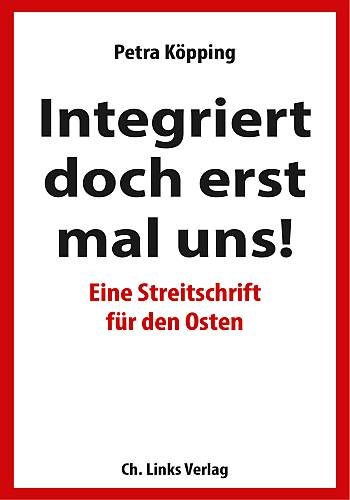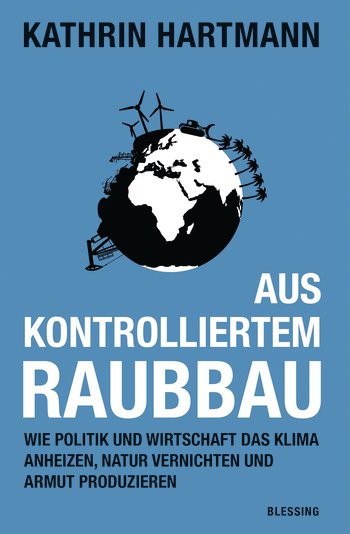Gesellschaft | Didier Eribon: Rückkehr nach Reims
»Um mich selbst neu zu erfinden, musste ich mich zuallererst abgrenzen.« Aha. Da weiß jemand genau, was er will. Da hat jemand sein Leben voll im Griff. Nehmen wir ihm das ab? Von WOLF SENFF
 Nein, er nimmt sich das selbst nicht ab, wie wir der Lektüre im späteren Verlauf entnehmen. Didier Eribon geht aus von seiner Autobiographie, deren zentrales Thema die Überwindung gesellschaftlich klassenbezogener wie sexueller Schranken ist, die Abgrenzung gegen seine proletarische Herkunft, das angestrebte Ziel eines bürgerlichen Lebens.
Nein, er nimmt sich das selbst nicht ab, wie wir der Lektüre im späteren Verlauf entnehmen. Didier Eribon geht aus von seiner Autobiographie, deren zentrales Thema die Überwindung gesellschaftlich klassenbezogener wie sexueller Schranken ist, die Abgrenzung gegen seine proletarische Herkunft, das angestrebte Ziel eines bürgerlichen Lebens.
Anpassung an die Normen
Eribon lehrt heute Soziologie an der Universität von Amiens, er hat das also, wenn man so will, geschafft, er wird als einer der führenden Intellektuellen Frankreichs gelobt und ist gegenwärtig Lieblingsgast in den hiesigen Feuilletons. »Rückkehr nach Reims« erschien in Frankreich im Jahr 2009 und markiert dort eine Etappe in der Auseinandersetzung mit dem Front National, die in unserem Land als Konflikt mit der AfD zurzeit geführt wird. Woher stammt diese rechtsorientierte Bewegung und wie gehen wir mit ihr um?
Eribon beschreibt uns die gespannte Beziehung zu seinen Eltern und seine innere Distanz zum Milieu der Arbeiterklasse. Er besucht während der sechziger Jahre das Gymnasium und studiert. Die Jahre am Gymnasium seien für ihn Jahre einer intensiven Anpassung an Normen und Verhaltensweisen des Bürgertums gewesen.
Portalfiguren
Der Leser wird sich übrigens fragen, was für ein Charakter sich hinter einem Sohn verbirgt, der bezüglich seiner Mutter sagt, dass »ihre enttäuschten Träume […] sich durch mich verwirklichen« konnten. Eribon erwähnt auch den eigenen Hass auf den Vater, und wir nehmen zur Kenntnis, dass sich später, aus der Distanz des erwachsenen Sohnes, das eigene Verhältnis zu seinem Elternhaus und seiner Familie neu sortiert. Die eigenen Eltern beschäftigen uns bekanntlich ein Leben lang, sie sind »Portalfiguren« (Peter Weiss) unseres Lebens.
Es ist nicht leicht zu verstehen, dass er sich als Heranwachsender von ihnen, von ihrer Welt längst losgesagt hat und dennoch zugleich vom »unauslöschlichen Abdruck meiner sozialen Herkunft« spricht.
Transformation der Sozialdemokratie
Das macht ihm zu schaffen, und er weitet diese Erfahrung seines Elternhauses auf die Dimension der Politik aus. Er erinnert an die Herausbildung eines Subproletariats der Immigranten algerischer oder maghrebinischer Herkunft und an den Rassismus der Sechziger Jahre, der im kommunistischen Milieu seines Elternhauses ebenso alltäglich war, wie er heute die Politik des Front National prägt. Er konstatiert eine Reihe gemeinsamer Inhalte rechter und linker Politik.
Linke Politik habe sich korrumpiert, und zwar sowohl was ihre Inhalte betreffe als auch ihre Repräsentanten, in Frankreich war dies seit 1981 Francois Mitterand, der, einmal im Amt, auf die Durchsetzung sozialistischer Inhalte verzichtet habe. Tony Blair und Gerhard Schröder stehen für die europäische Transformation der Sozialdemokratie.
Was also sind die Probleme?
Dessen ungeachtet schreibt Eribon den kritischen Intellektuellen und den sozialen Bewegungen die Aufgabe zu, neue Perspektiven zu erschließen und linker Politik einen Weg in die Zukunft zu weisen, bleibt aber wenig konkret. Was beeindruckt, ist die Beschreibung seiner eigenen Sozialisation, die Überwindung zweier Ausgrenzungen, der sozialen und der sexuellen.
Die Überhöhung in die politische Dimension ist folgerichtig, sie erweitert den Blick auf bevorstehende Auseinandersetzungen, sie schafft, traditionell formuliert, ein Problembewusstsein, und das ist mehr bzw. etwas anderes, als uns üblicherweise geboten wird. Patentlösungen sind weder in Sichtweite noch darf man sie vernünftigerweise erwarten.
Titelangaben
Didier Eribon: Rückkehr nach Reims
(Retour à Reims, Paris 2009) aus dem Französischen von Tobias Haberkorn
Frankfurt/Main: Suhrkamp 2016
238 Seiten, 18 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe