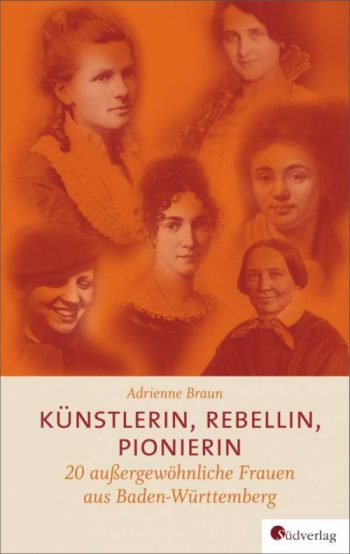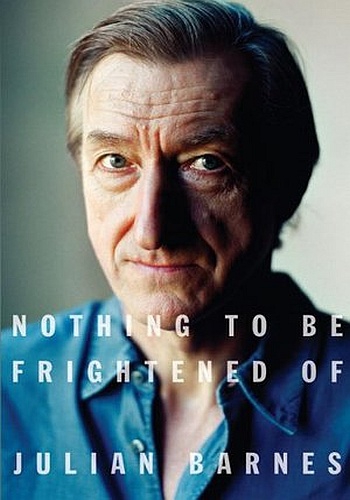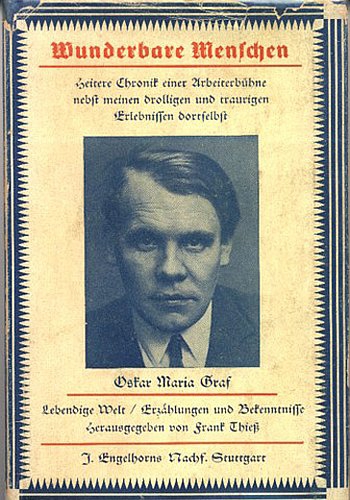Menschen | Zum 85. Geburtstag des Schriftstellers Günter Herburger am 6. April
»Man offen sein muss für Erschöpfung. Ich bin in diese Erschöpfung hineingelaufen, es kam der zweite Wind, und ich dachte: Was ist das?«, erklärte der Schriftsteller Günter Herburger einst seine ersten Leidenserfahrungen beim Marathonlauf. Von PETER MOHR

Foto: Catherina Hess
Nach eigenem Bekunden hat er nur einmal in Berlin die »klassische Strecke« auf Zeit gelaufen, um seinem Sohn zu imponieren: »Der will doch den tollen Papa sehen, da habe ich alle vor mir aufgerollt und hetzte den Kudamm hinauf… Es hat nichts genützt. Geschämt hat er sich, weil ich so erschöpft war im Ziel. Ich schwitzte und fror und hab mich auf dem Kudamm nackt ausgezogen, was einem ja wurscht ist, wenn man völlig von Sinnen ist.«
Günter Herburger, der heute* vor 85 Jahren in Isny im Allgäu als Sohn eines Tierarztes geboren wurde, ist ein Mann, der die Herausforderungen förmlich sucht, der literarisch wie körperlich als unermüdlicher Grenzerforscher tätig ist. Die Affinität zum Außergewöhnlichen zeigte sich schon in den 1950er Jahren, als er in Paris Sanskrit studierte. Seit einem kurzen Zwischenspiel Anfang der 1960er Jahre als Fernsehredakteur für Kindersendungen in Stuttgart arbeitet er als freier Schriftsteller.
Doch ganz ohne Folgen blieb das TV-Intermezzo nicht, denn Herburger, der viele Jahre in München lebte und nun seit einiger Zeit Berlin ansässig ist, trat später noch wiederholt als Autor der »Birne«-Kinderbücher in Erscheinung. Seine ersten künstlerischen Meriten erwarb er als Hörspielautor, es folgte ein kurzes Gastspiel als Filmemacher, ehe sich Herburger in den 1970er Jahren ganz der Erzählliteratur zuwandte und sich als Vorreiter der postmodernen Literatur entpuppte. Ein erstes Beispiel dafür lieferte die von Bernhard Wicki verfilmte Erzählung ›Die Eroberung der Zitadelle‹ (1972).
Eines der gelungensten Bücher ist noch heute die 1984 erschienene Erzählung ›Capri‹, in der die Phantasie und Technik eines Diebes der Arbeitsweise eines Schriftstellers gegenübergestellt wird.
Für Freunde bekenntnishaft-selbstzerfleischender Literatur sind Herburgers stark autobiografisch gefärbte Marathon-Bücher ›Lauf und Wahn‹ (1988), ›Traum und Bahn‹ (1995) und ›Schlaf und Strecke‹ (2005) Pflichtlektüre. Zuletzt hat Herburger vor einem Jahr den skurril-märchenhaften Heimatroman ›Wildnis, singend‹ vorgelegt, in dem es von sprechenden Tieren wimmelt.
Seit mehr als 50 Jahren hat Herburger darüber hinaus dem Gedicht die Treue gehalten. Seit dem Band ›Ventile‹ (1966) hat er sich kontinuierlich auch mit Lyrikbänden zu Wort gemeldet – zuletzt vor sieben Jahren mit ›Ein Loch in der Landschaft‹. Im Vorwort zu seinem Gedichtband ›Orchidee‹ (1977) hat er seinen Lesern geraten, »Gedichte wie Luftschiffe zu benützen, denn wer nicht zu fliegen wage, verzichte auf Übersicht und Mut«.
Zwischen Luftschiffen und Marathonläufen hat sich Günter Herburger in unserer schnelllebigen Zeit eine gehörige Portion Individualität bewahrt.
| PETER MOHR
| Titelbild: Catherina Hess / A1-Verlag
Lesetipp
Günter Herburger: Wildnis, singend
Berlin: Hanani Verlag 2016
250 Seiten, 19,50 Euro