Gesellschaft | Sebastian Friedrich: Lexikon der Leistungsgesellschaft
Sie verwechseln da etwas, liebe Frau Merkel. Die Atmosphäre von behäbigem Wohlgefühl und gesättigter Gemächlichkeit ist nicht das, was politisch erstrebenswert wäre. Politik soll mutig sein, unbequem sein, sie will miserable Zustände verändern, sie will die Dinge beim Namen nennen. Von WOLF SENFF
So gesehen, Frau Merkel, sind Sie durchgefallen – was dem Fernsehzuschauer bereits am vergangenen Sonntag nicht verborgen blieb.
 Was zu tun wäre? Ein Sprung in kaltes Wasser? Wer nicht gleich so rigide Methoden anwenden möchte, dem wäre mit subtileren Ansätzen zu helfen, vielleicht dass er die Blickrichtung ändert – das wäre ein vorzüglicher Anfang. Das vorliegende Bändchen ›Lexikon der Leistungsgesellschaft‹ gibt dafür unterhaltsame Anstöße.
Was zu tun wäre? Ein Sprung in kaltes Wasser? Wer nicht gleich so rigide Methoden anwenden möchte, dem wäre mit subtileren Ansätzen zu helfen, vielleicht dass er die Blickrichtung ändert – das wäre ein vorzüglicher Anfang. Das vorliegende Bändchen ›Lexikon der Leistungsgesellschaft‹ gibt dafür unterhaltsame Anstöße.
Kaffee zum Frühstück
Sechsundzwanzig Stichworte. Nein, wir erfahren nicht, nach welchen Kriterien sie ausgewählt wurden, und das ist auch reichlich gleichgültig. Der Bezug zum Thema Leistungsgesellschaft ist jedoch unbestreitbar. Im Rennrad zum Beispiel, einem dynamischen Statussymbol idealiter mit der deregulierten, besonders coolen Ausführung ohne Bremsen und ohne Schaltung, spiegele sich das selbstbestimmte, autonome Individuum – viel beschworenes Menschenbild neoliberaler Politik.
Sebastian Friedrich liefert dem Leser eine unterhaltsame Auswahl, nicht frei von Ironie und leichtem Spott. Ein ›Quantified Self‹ ist das Ziel der ›Self-Tracker‹; sie sammeln diverse Daten über sich selbst, um die eigene Persönlichkeit zu »optimieren«. Softwareprofis bieten Apps zwecks Erhebung diverser Daten an, und die ›Self-Tracker‹ posten ihre Messergebnisse und Entdeckungen in den Netzwerken.
Letzter Schrei ist ein mit Butter versetzter Morgenkaffee, der Konzentrations- wie Leistungsfähigkeit fördere – messbar fördere. An der korrekten Dosierung der Butter werde gearbeitet.
Alles läuft prächtig
Wir werden daran erinnert, dass der Marathonlauf sich frappierend parallel zu Globalisierung und Neoliberalismus ausbreitete. Während zu Beginn der siebziger Jahre an den ersten Marathonläufen in Berlin und New York etwa hundert Personen teilnahmen, seien es heute weit über vierzigtausend. Jeder Läufer trainiere seine Leistungs- und Leidensfähigkeit, die Laufapp-Zwischenresultate würden in den sozialen Netzwerken gepostet.
Mittlerweile werden Firmenläufe veranstaltet mit in Frankfurt/Main unlängst siebzigtausend Läufern. Hier verbinde sich das eigene Erfolgserlebnis mit der Zugehörigkeit zum Unternehmen, der öffentliche Charakter werde durch eine firmenbezogene Kultur substituiert. Seit neuestem wird eine deutsche Firmenmeisterschaft veranstaltet, und wir erfahren endgültig, wo das private Leistungsdenken sich zu Hause fühlt: Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Das Nackenhaar
Während der Lektüre, so unterhaltsam und charmant sie ankommt, sträubt sich mehr und mehr das Nackenhaar. Eine so simple Erscheinung wie ›Coffee to go‹ ist problemlos rückführbar auf neoliberale Grundwerte: Zeitgewinn, Mobilität, Dynamik. Nein, das gemütliche Kaffeehaus mit Polstersesseln, in die man sich zurücklehnte, um bei einem Tässchen Kaffee in aller Ruhe die geschäftige Welt zu studieren – dieses Kaffeehaus gibt es nicht mehr.
Wie gesagt, sechsundzwanzig Stichworte, die, liest man sie in einem Durchgang, uns erschrecken und unser Entsetzen auslösen darüber, wie unser Alltag kaum merklich verändert wird. Die sonst so umtriebige mediale Öffentlichkeit befindet sich in ihrer Wahrnehmung dieser Zustände leider in einem anhaltenden Dämmerzustand.
Titelangaben
Sebastian Friedrich: Lexikon der Leistungsgesellschaft
Wie der Neoliberalismus unseren Alltag prägt
Münster: edition assemblage 2016
96 Seiten, 7,80 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander



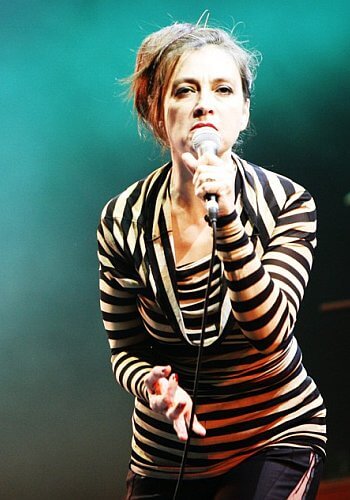

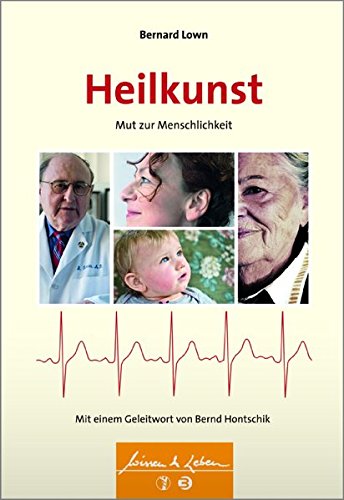

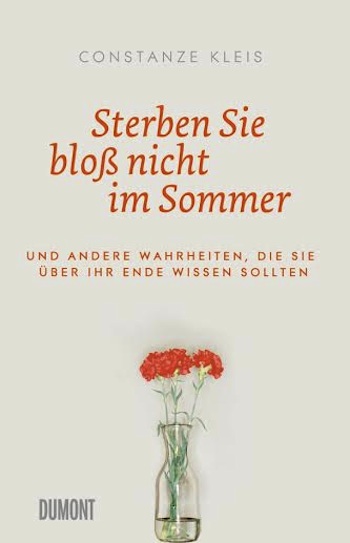
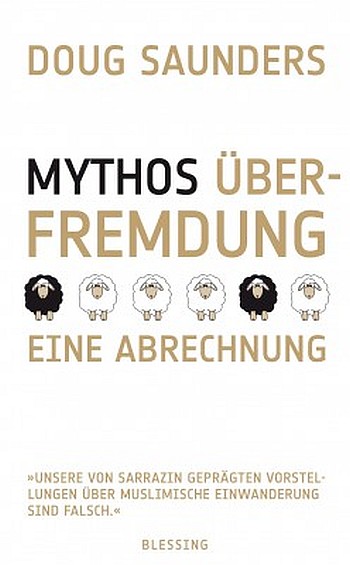
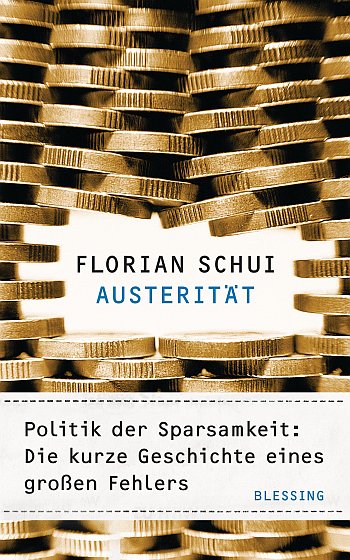
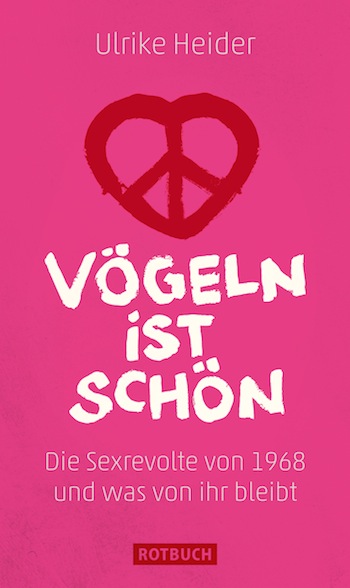
[…] „Sebastian Friedrich liefert dem Leser eine unterhaltsame Auswahl, nicht frei von Ironie und leichtem Spott.“ (Wolf Senff in Titel-Kulturmagazin, 8. September 2017) […]