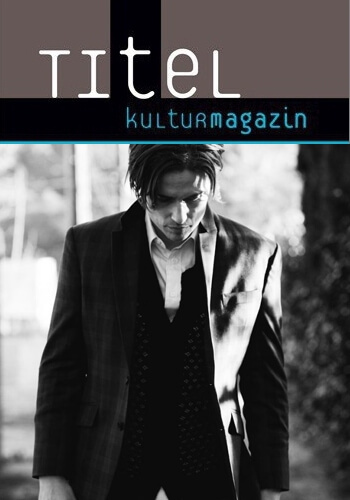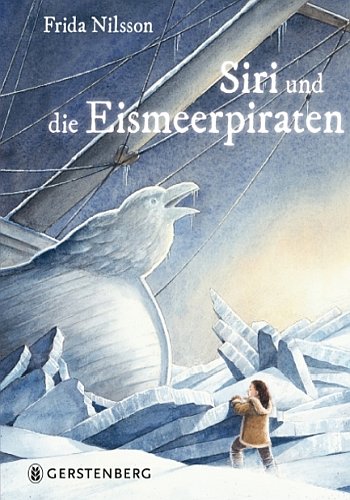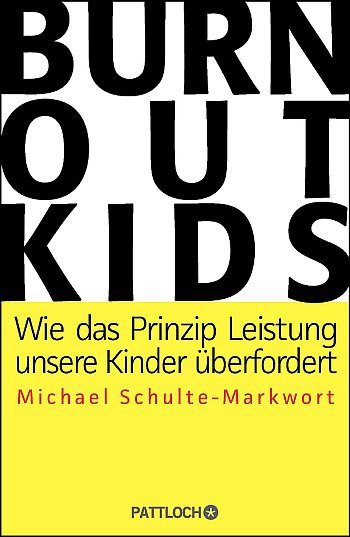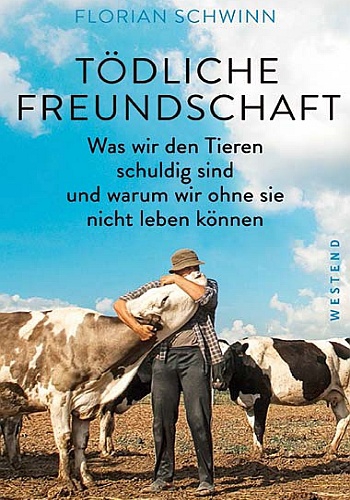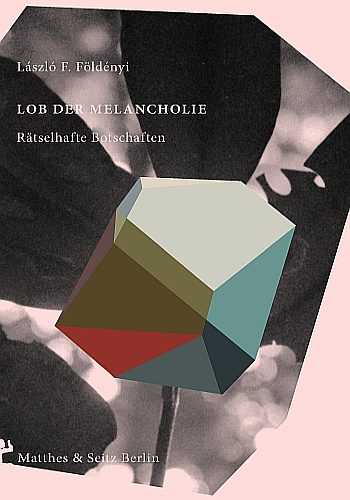Gesellschaft | Nils B. Schulz: Gedanken zur Dequalifizierung des Lehrers
Wie schön, sind ›wir‹ mal wieder Weltmeister. Das hörst du gern, da steigt Begeisterung hinauf bis in die Ohren und färbt sie glühend rot. Mit siebenunddreißig Prozent, so sagt die Nachrichtenseite, hat Deutschland weltweit den höchsten Anteil Hochschulabsolventen in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – na bitte. Von WOLF SENFF
 Läuft alles paletti, die Schulen liefern exakt, was Wirtschaft verlangt, was soll das permanente Gemecker. Könntest du sagen – doch so simpel sind die Dinge nicht. Zur Situation des Lernens und der Schulen publiziert die Zeitschrift ›Scheidewege‹ einen aufschlussreichen Text, der das Thema erfreulich praxisorientiert beleuchtet.
Läuft alles paletti, die Schulen liefern exakt, was Wirtschaft verlangt, was soll das permanente Gemecker. Könntest du sagen – doch so simpel sind die Dinge nicht. Zur Situation des Lernens und der Schulen publiziert die Zeitschrift ›Scheidewege‹ einen aufschlussreichen Text, der das Thema erfreulich praxisorientiert beleuchtet.
Sprachliche Schönfärberei
Nils Björn Schulz arbeitet als Lehrer an einem Berliner Gymnasium und fährt nicht mit auf dem global verkehrenden Hochleistungswaggon, sondern er sucht herauszufinden, welche Rolle den heranwachsenden Persönlichkeiten der Schüler zugeschrieben ist bzw. in seinen Worten: welches Menschenbild die Schule festigen will, d. h. er nähert sich Schule aus einer komplett anderen Richtung.
Schule befinde sich in einem Umbauprozess, das erwartete Resultat sei eine »neue Lernkultur«, begleitet von reichlich sprachlicher Schönfärberei – ›Lernlandschaften‹, ›Lernbegleiter‹, ›Kompetenzentwicklung‹, ›Qualitätssicherung‹ etc. –, die dazu diene, dem Umbau einen gefälligen Wellness-Touch zu verleihen. Ein kurzes Nachblättern bei Wikipedia firmiere flugs als »digitale Recherche«. Oh wenn sie anfangen, dich zu streicheln, ist es Zeit, misstrauisch zu werden.
Korrektur von Deutscharbeiten
Schulz konstatiert im Kontext der Digitalisierung einen neoliberalen Umbau des Bildungswesens, seine Argumentation sticht schmerzhaft in den schulischen Alltag und in die üblicherweise lauthals gepriesene Praxis am Computer.
Ausführlich geht er auf die Korrekturpraktiken ein. Für den korrigierenden Deutschlehrer werde ein Zwölf-Punkte-Kriterienraster als Service angeboten, als »Hilfe«, die den Lehrer, der sich auf diesen Online-Service einlässt, in ein standardisiertes Vokabular mitsamt standardisierten, prozentual fixierten Bewertungsbereichen so hineinzieht, dass ihm eine subjektiv verantwortete Entscheidung entzogen ist.
Standardfloskeln und Allgemeinplätze
Die seitens der Behörde angebotenen Standardslogans erfassen, so Schulz, oft die Charakteristika von Schülerarbeiten nicht hinreichend; sie stünden einer angemessenen Bewertung im Wege, und generell sieht er in dieser »neuen Lernkultur« die Absicht, Ansprüche zu nivellieren – durch Online-Raster werde wertvolle jahrelange Beurteilungserfahrung diskreditiert.
Zumal die Sinnfälligkeit der standardisierten Klausur-Gutachten zweifelhaft sei und den Lehrer in eine Position dränge, jede einzelne Notenpunktvergabe rechtfertigen zu müssen – ein wahrhaft gemeinschafts- und vertrauensbildendes Moment.
Plastiksprech
Manche der standardisiert formulierten Bewertungskriterien, etwa im Fach Politik, seien für einzelne Schüler nicht transparent, da sie auf fachspezifischen Kenntnissen aufbauen würden. Geradezu lächerlich seien die behördlicherseits vorfabrizierten Bewertungstexte für das Fach Philosophie. Zurecht spricht Nils Schulz von einer Entmündigung des Lehrers, und man staunt, auf welches Niveau sich eine Behörde begibt, die ihren Gymnasien derartige Texte liefert. Plastiksprech.
Aus dem fachlich kompetenten Lehrer werde Schulz zufolge letztlich ein Anhängsel des Computers, und diese bereits zu beobachtende Transformation der Lehrerpersönlichkeit drohe als zusätzliche Gefährdung.
Die gewollte Verwahrlosung
Dazu passt das Detail, dass die Berliner Senatsbehörde davon ausgeht, eine Oberstufenklausur könne in zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten korrigiert werden. Schulz fühlt sich zurecht an den Terminus ›Gestell‹ des späten Heidegger erinnert.
Die Verwahrlosung schulischer Bildung, man muss das so sehen, ist knallharter Teil des politischen Konzepts, und jegliche anderslautende Äußerung von Politikern ist allein dem Wahlkampf geschuldet – nach dem 24. September wird alles weiterlaufen wie gehabt. Man fragt sich lediglich, weshalb sich Politiker und andere selbsternannte Eliten über den wachsenden Ärger der Bevölkerung wundern.
Titelangaben
Nils B. Schulz: Digitale Bewertungsraster als Form der Entmündigung – Gedanken zur Dequalifizierung des Lehrers
In: Scheidewege, Jahresschrift für skeptisches Denken, hg. von der Max Himmelheber-Stiftung, S. 288-306
Stuttgart: S. Hirzel 2017
411 Seiten, 37,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe