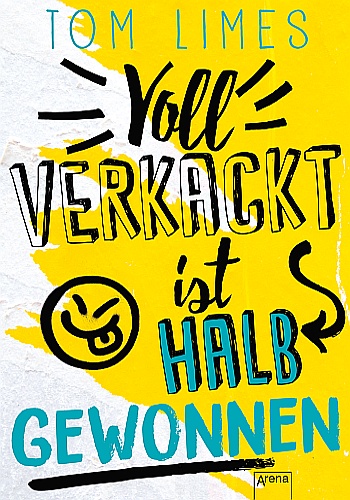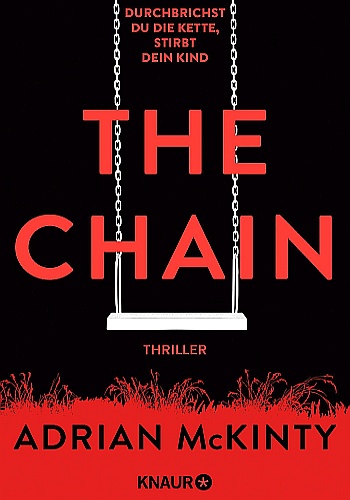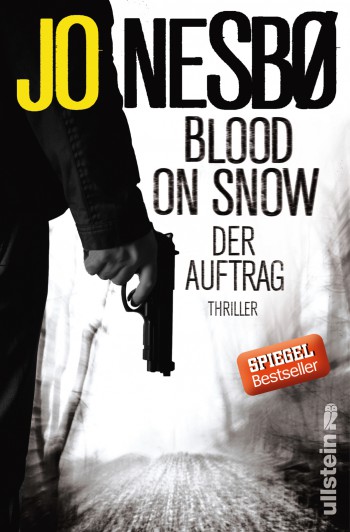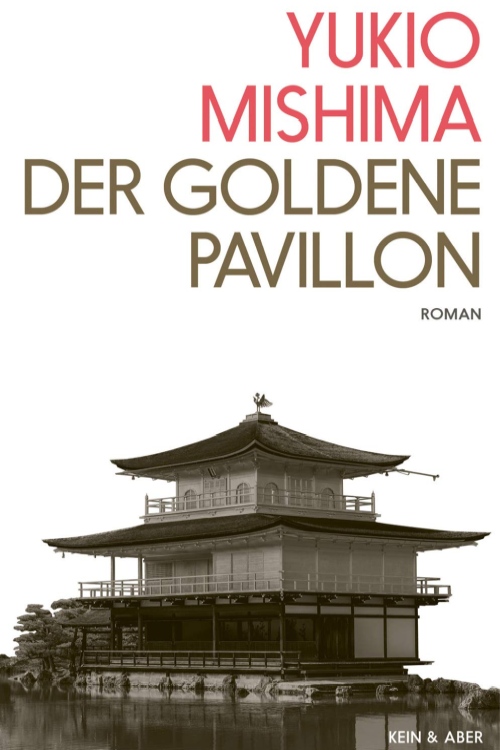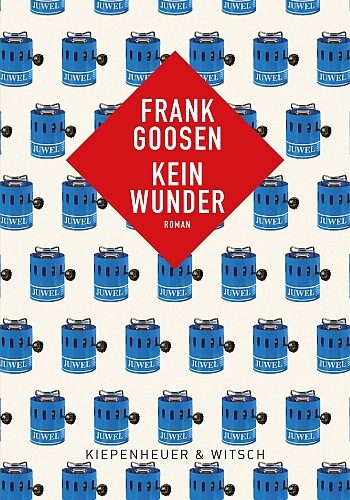Roman | Kenah Cusanit: Babel
Wer im Berliner Pergamonmuseum schon einmal staunend vor dem babylonischen Ischtar-Tor stand, mag sich gefragt haben, wie diese Unmengen an Tonziegeln eigentlich nach Deutschland kamen. So auch die Autorin Kenah Cusanit. Nach Jahren der Recherchen und Quellenstudien ist nun ihr Debüt Babel als ein faszinierender, zwischen Fakten und Fiktion mäandernder Roman erschienen. Von INGEBORG JAISER
 Archäologie kann spannend wie ein Krimi sein. Vor allem, wenn man es mit findigen, zähen und beharrlichen Protagonisten zu tun hat. Ohne den unumwundenen Glauben an das schriftlich Fixierte, an die Erzählungen Homers, hätte Heinrich Schliemann niemals Troja und Mykene ausgegraben. Vom gleichen Forschergeist und ähnlicher Schriftbesessenheit (gepaart mit photographischem Gedächtnis und aquarellierendem Blick) muss Robert Koldewey geprägt gewesen sein.
Archäologie kann spannend wie ein Krimi sein. Vor allem, wenn man es mit findigen, zähen und beharrlichen Protagonisten zu tun hat. Ohne den unumwundenen Glauben an das schriftlich Fixierte, an die Erzählungen Homers, hätte Heinrich Schliemann niemals Troja und Mykene ausgegraben. Vom gleichen Forschergeist und ähnlicher Schriftbesessenheit (gepaart mit photographischem Gedächtnis und aquarellierendem Blick) muss Robert Koldewey geprägt gewesen sein.
Sein Ziel war Babylon, der legendäre Ort im Zweistromland, beschrieben in der Bibel, verankert in den Historien des Herodot. Wer könnte sonst 18 Jahre in einer unwirtlichen Wüstenregion zubringen, wenn er nicht an den Turmbau zu Babel glaubte?
Mesopotamisches Gelb
Einen Roman über die Ausgrabungsgeschichte der legendären Metropole am Euphrat mag man sich entweder schwülstig-historisierend oder verkopft-intellektuell vorstellen. Doch nichts davon trifft auf Kenah Cusanits Prosadebüt Babel zu. Keine üppigen Orientalismus-Tableaus, auch keine staubtrockenen Diskurse für gelehrte Insider. Genau genommen dampft der Roman das ganze Geschehen auf einen einzigen Tag im Leben des Grabungsleiters Dr. Robert Koldewey ein, einen Tag im Jahre 1913, mit der Aura des nahenden Krieges. Ein Kammerspiel (im besten Wortsinn) ist es über weite Strecken zudem.
Denn Robert Koldewey, geschwächt durch körperliche Malaisen und klimatische Zumutungen, zerrieben zwischen dem fordernden Ansinnen der Deutschen Orientgesellschaft und der arabischen Trägheits-Mentalität vor Ort, wird durch eine akute Blinddarmentzündung zum Nichtstun verdammt. Von Schmerzen geplagt, verharrt er in Schonhaltung auf der Liegestatt seiner winzigen Kammer, die unerreichbare Fliegengittertür kaum drei Meter entfernt, doch das Ausguckfenster direkt in seiner Bettnische, mit weitem Blick auf den »palmengesäumten Fluss bis hinauf zu den nördlichsten Ausläufern des Grabungsareals«. Er sieht: »Schwimmende Schwemmböden. Alluviale Ruhe. Die Vögel jetzt am Wasser. In Lehm pickend, der aus Sand bestand, Schluff und Ton.
Funde und Befunde
Und mitten in diese erzwungen kontemplative Ruhe, in das »mesopotamische Gelb«, platzen wir als Leser hinein. Haben teil an Koldeweys Gedanken und inneren Monologen, an Ausblicken und Rückblenden, an weitreichenden Exkursen und philosophischen Betrachtungen (wie über das Wesen der Photographie oder die Elektrifizierung Berlins). Ganz en passant erfahren wir vom Stand der Dinge. Seit 15 Jahren gräbt der Architekt Koldewey unermüdlich am Euphrat, doch nicht als kühner Trophäenjäger, eher als Universalgelehrter alter Schule. Mehr an Erkenntnissen, denn an Schätzen interessiert, wenngleich im stetigen Wettrennen mit anderen europäischen Staaten, die ebenfalls im Vorderen Orient graben. »Die Engländer dachten in Funden, die Deutschen in Befunden«.
Eher lästig sind Koldewey die Berge von Schutt, die zu Tage befördert wurden und nun nach Berlin verfrachtet werden sollen, »20.000 nummerierte und 100.000 unnummerierte Fragmente in 500 Kisten.« Noch lästiger sind ihm die Begehrlichkeiten seiner Arbeit- und Finanzgeber, die am liebsten jede neue Tontafel einzeln erhalten hätten, um sie zu dechiffrieren, darüber zu publizieren und zu referieren. Allen voran der Berliner Philologe Friedrich Delitzsch, der den sogenannten Bibel-Babel-Streit anzettelt – und das zu einer Zeit, in der gerade der „darwinistische Schock“ verarbeitet und scheinbar alle bisherigen Gewissheiten in Frage gestellt werden. Der Schrecken darüber, »dass man ausgraben und erkennen würde, dass etwas, woran man glauben konnte, Tatsache war, und das, was man zu wissen glaubte, allenfalls Aberglaube.«
Dichtung, Wahrheit, Mythen
Ein unsichtbares Band schwingt zwischen Kenah Cusanit und Robert Koldewey: beide sind in Blankenburg im Harz geboren. Über fünf Jahre lang hat Cusanit – studierte Altorientalistin und Ethnologin – an diesem Roman gearbeitet, sich quer durch Bibliotheken und Archive gelesen, Unmengen von Briefen und Notizen verinnerlicht. Ein skurriler Sonderling muss dieser Koldewey gewesen sein, sarkastisch, eigensinnig, streng zu sich selbst und unerbittlich zu anderen. Und doch ist sein Porträt (samt den zeitgeschichtlichen Schilderungen) hochgradig amüsant geraten. Gekonnt blättert Babel ein ganzes Universum auf, einen vielschichtigen Kosmos zwischen Dichtung und Wahrheit, eine schillernde Legende zwischen »orientalischen und okzidentalen Mythengeschichten«.
Obwohl selbst Wissenschaftlerin, bewegt sich Cusanit mit erstaunlicher Lässigkeit durch die Fakten. Vermengt Genres, Stile, Sichtweisen. Mixt philosophische Textstellen mal mit gekonnten Bonmots (»Ärzte waren letzten Endes Handwerker, die reparierten, was sie selbst nicht konstruiert hatten«), mal mit seitenlangen Aufzählungen der an den Grabungen Beteiligten – eine ungeordnete Liste arabischer Namen, die man entweder desinteressiert überschlagen oder silbenweise auf der Zunge zergehen lassen kann oder (falls es einmal eine Hörbuchfassung geben sollte) fasziniert vom Klang erlauschen mag.
Mit Babel ist Kenah Cusanit nicht nur ein archäologisch inspiriertes Meisterstück gelungen, sondern auch eine klug reflektierte Wissenschafts- und Kulturgeschichte, ein Sittenbild der deutschen Gesellschaft vor hundert Jahren, möglicherweise sogar ein erfrischend neuer Beitrag zur aktuellen Restitutionsdebatte. Der Robert Koldewey im Roman konstatiert angesichts der als Steinbruch benutzten Stadt Babylon recht pragmatisch: »Es gab Kulturen, die ihre Vergangenheit wiederverwendeten, und es gab Kulturen, die ihre Vergangenheit ausstellten.«
Titelangaben
Kenah Cusanit: Babel
München: Carl Hanser Verlag, 2019
266 Seiten, 23.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe