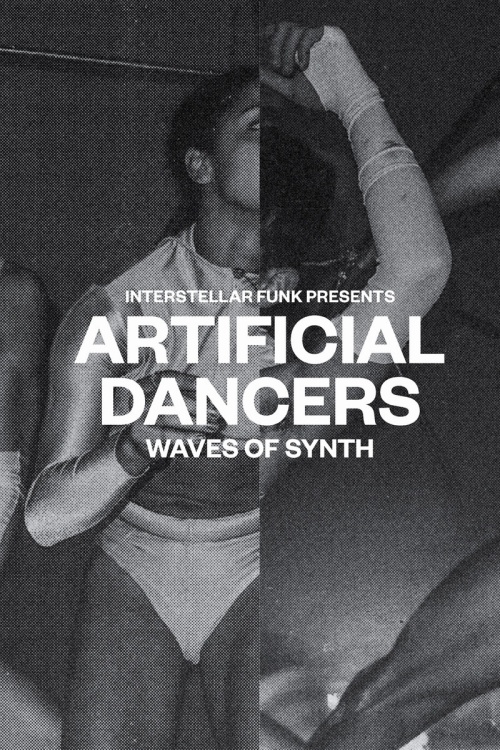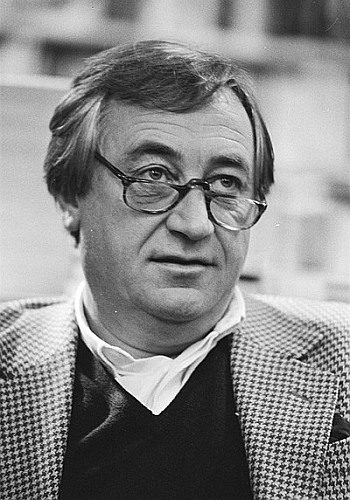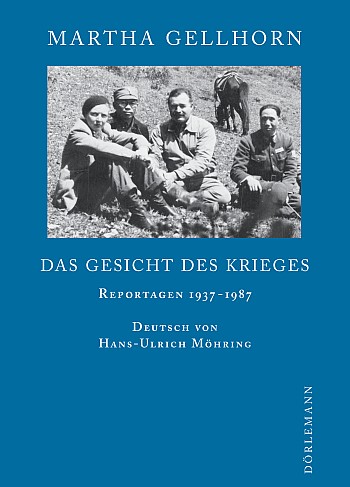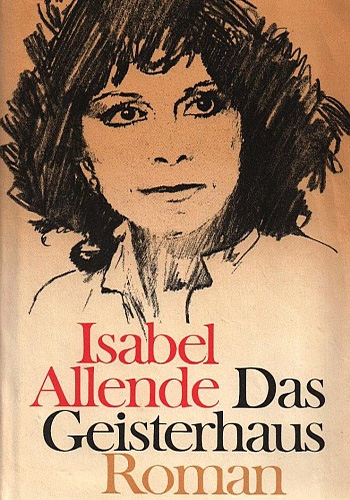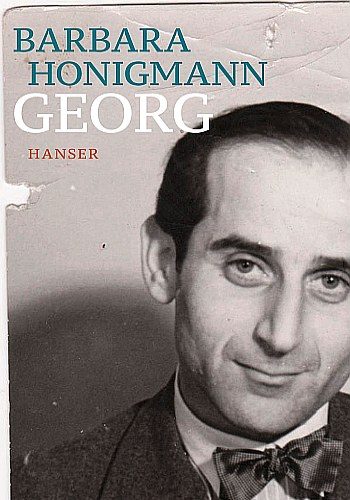›These Girls‹ ist ein Musiklexikon der besonderen Art – und doch so viel mehr. Ein Buch, das Pflichtlektüre sein sollte: für alle, die grundsätzlich an guter Musik interessiert sind. Für musikbegeisterte Feminist*innen, und solche, die es werden wollen. Von JALEH OJAN
Von Aretha bis Anohni
»Ein Streifzug durch die feministische Musikgeschichte«, so lautet der Untertitel von ›These Girls‹. Streifzug – das klingt nach gemütlichen Spaziergängen durch Wälder, nach Sich-den-Wind-um-die-Nase-wehen-Lassen. Das klingt so gar nicht nach einem Buch, das auf über 330 Seiten nichts Geringeres als die Geschichte der Popmusik anhand der Biographien und Diskographien seiner weiblichen Protagonisten erzählen will. Sollte man es dann nicht eher einen »Gewaltmarsch durch die feministische Musikgeschichte« nennen?
Die Fülle an »Lebensläufen« in der neuen Publikation des Ventil Verlags ist tatsächlich erst mal erschlagend. Umso mehr Spaß macht es dann aber, über Aretha Franklin, Annie Lennox oder Rihanna aus frischen Blickwinkeln und in ungewohnt radikal kurzer Essayform zu lesen. Und noch spannender ist es, in den nach Jahrzehnten sortierten Kapiteln auf DJanes und Riots Grrrls zu treffen, deren Platten zu Unrecht ein Nischendasein fristen. Das Ganze ist dann noch mit so viel Begeisterung und Know-how geschrieben, dabei aber so unprätentiös, dass von einem Gewaltmarsch nicht wirklich die Rede sein kann.
Soundtüftlerinnen, ins Rampenlicht!
 Zu verdanken ist das der Herausgeberin Juliane Streich, die drei eigene Texte beisteuert, und in ihrem Band Musikjournalist*innen, Laien- und Profi-Musiker*innen, Fans und Freund*innen zu Wort kommen lässt. So vielfältig wie die persönlichen und beruflichen Hintergründe der Autor*innen sind dann auch ihre Zugänge zu Werk und Leben der Person, die sie vorstellen: Von eher sachlichen Lexikoneinträgen über Liebeserklärungen an Platten aus Jugendtagen und poetischen Essays bis hin zu schwärmerischen Konzertberichten ist alles dabei.
Zu verdanken ist das der Herausgeberin Juliane Streich, die drei eigene Texte beisteuert, und in ihrem Band Musikjournalist*innen, Laien- und Profi-Musiker*innen, Fans und Freund*innen zu Wort kommen lässt. So vielfältig wie die persönlichen und beruflichen Hintergründe der Autor*innen sind dann auch ihre Zugänge zu Werk und Leben der Person, die sie vorstellen: Von eher sachlichen Lexikoneinträgen über Liebeserklärungen an Platten aus Jugendtagen und poetischen Essays bis hin zu schwärmerischen Konzertberichten ist alles dabei.
Vera Kropf beispielsweise sucht mit mäßigem Erfolg nach weiblichen Vertretern der Surfmusik; Jan-Niklas Jäger schreibt eine Hymne auf den feministischen Sixties-Song ›You Don’t Own Me‹ von Leslie Gore; während Hannah Zipfel sich der Jazz- und R&B-Sängerin Jackie Shane widmet. Die kam zu sehr spätem Ruhm, obwohl sie zu Lebzeiten allein schon durch ihr selbstbewusstes Auftreten als afroamerikanische Trans-Frau für viele Queers of Colour eine Bresche schlug. Wer kennt heute noch ihren Namen? Und wer hat gewusst, dass es eine Frau war, die für die elektronische Realisierung der Titelmelodie von Doctor Who verantwortlich zeichnete? Delia Derbyshire hieß diese Pionierin der elektronischen Musik.
Bis wir aber so weit sind, dass solcherlei Wissen im Pub-Quiz abgefragt wird, mag es noch etwas dauern. Juliane Streich hat mit ihrer Publikation aber schon einmal viel dafür getan, dass da etwas in Bewegung kommt. Dass auch der Blick des Feuilletons nicht nur auf die Beyoncés und Madonnas, sondern auch auf die Akkordeon-Spielerinnen und Bassistinnen gelenkt wird, auf die Rapperinnen und Songwriterinnen. Die Soundtüftlerinnen, die normalerweise eben nicht im Rampenlicht stehen.
Definiere: »feministisch«
Was genau nun aber einen feministischen Musik-Act oder eine Künstler*innen-Biografie ausmacht, das bleibt im Vagen, zumal alle Autor*innen den Begriff ein wenig anders interpretiert. So stehen hier Essays über Queercore-Heldinnen wie Team Dresch oder Protestsong-Königin Joan Baez gleichberechtigt neben Texten über dezidierte Nicht-Feministinnen wie Lana del Rey. Anderen Musiker*innen wiederum – so mutmaßen gleich mehrere Autor*innen – würde es wohl nicht passen, in diesem »Frauen-Musiklexikon« aufzutauchen, weil ihrer Meinung nach das Geschlecht überhaupt keine Rolle spielen sollte. So wehrt sich die Drummerin der Metal-Band Kittie gegen das Label »Frauenband« und fragt: »Warum nicht auf die Musik fokussieren?«
Auch Vorreiter*innen auf ihrem Gebiet sind die Porträtierten natürlich nicht alle, wie es z. B. The Slits als Pionierinnen des »female angry punk« waren. Wenn es eine Sache gibt, die wirklich alle hier vorgestellten Musiker*innen gemein haben, dann ist es der unbeirrte Glauben an das eigene Können und das eigene kreative Potenzial. Und den braucht es unbedingt, um sich seinen Platz auf den Bühnen und in den Tonstudios einer männerdominierten Domäne erkämpfen zu können.
Bei einem solchen Ritt durch die Musikgeschichte ist natürlich nicht nur das Spektrum der (a)politischen Haltungen unter den Musiker*innen groß, auch die stilistische Bandbreite ist es. Aber es wäre falsch, nach den Berührungspunkten zwischen Joni Mitchell-, PJ Harvey- und Sookee-Fans zu fragen (die es ja durchaus geben mag). Einen extrem eklektischen Musikgeschmack muss man als Leser*in auch gar nicht haben, denn das Buch lässt sich ebenso gut chronologisch lesen wie auch kreuz und quer. Da kann man auch mal ein Kapitel – oder gleich mehrere – überspringen.
Musikalische Herstory aus intersektionaler Perspektive
Leichte Lektüre ist Herstory ja nie, auch wenn sie – wie hier – in der Welt des Pop und Rock spielt. Es ist aufwühlend, von den Mehrfachdiskriminierungen zu lesen, denen aufstrebende Musiker*innen von Etta James bis hin zu Ebow allerorten ausgesetzt waren und sind. Die »strukturelle Blödheit der Musikindustrie«, wie es Benjamin Moldenhauer in seinem Text über Carla Bozulich so schön ausdrückt, kann einen bei der Lektüre schon mal in Rage versetzen.
Umso beglückender ist die Tatsache, dass ›These Girls‹ den Geschichten und den Sounds von Frauen und Queers endlich den ihnen gebührenden Raum gibt und die (Cis-)Herren des Musikbusiness zur Abwechslung mal nur die Fußnoten darstellen. Und, auch das ist Juliane Streich wichtig, hier richtet sich der Blick nicht immer nur auf Musiker*innen aus dem anglo-amerikanischen Raum, sondern auch auf den nicht totzukriegenden Androzentrismus im deutschen Popgeschäft, wo Formationen wie Half Girl oder Doctorella eben nicht dieselben Start- und Arbeitsbedingungen haben wie ihre männlichen Kollegen. Zumal sie sich die feministische Grundhaltung auf die Fahne schreiben.
Auch wenn die Qualität der Texte wie bei den meisten Sammelwerken von passabel bis großartig reicht: Der Ventil-Verlag behält absolut recht, wenn er ›These Girls‹ als »vergnügliche Lektüre« ankündigt. Doch das würde viel zu kurz greifen, denn dieses Buch ist so viel mehr: Der intersektionale und trans-inklusive Ansatz, aber auch der Blick vor die eigene Haustür, machen es zu einem unverzichtbaren »Lexikon« für Musikfans jeden Alters, die sich nach mehr Sichtbarkeit von Künstler*innen sehnen. Frauen*, die ihr eigenes Ding machen.
Meine eigene Spotify-Bibliothek ist seit der Lektüre jedenfalls um einige Alben reicher. Aber wenn ich mir die offizielle Playlist zum Buch (Spotify: ›these girls. der soundtrack zum buch‹) angucke, merke ich: da geht noch was.
Titelangaben
Juliane Streich (Hg.): These Girls
Ein Streifzug durch die feministische Musikgeschichte
Mainz: Ventil Verlag 2019
344 Seiten, 20 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe