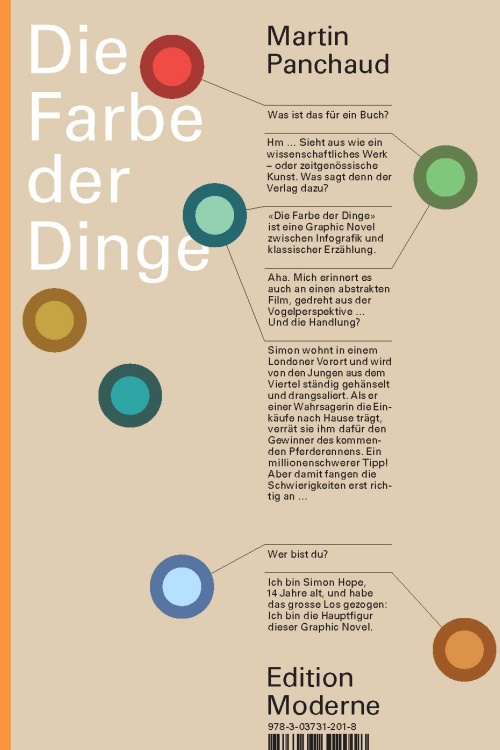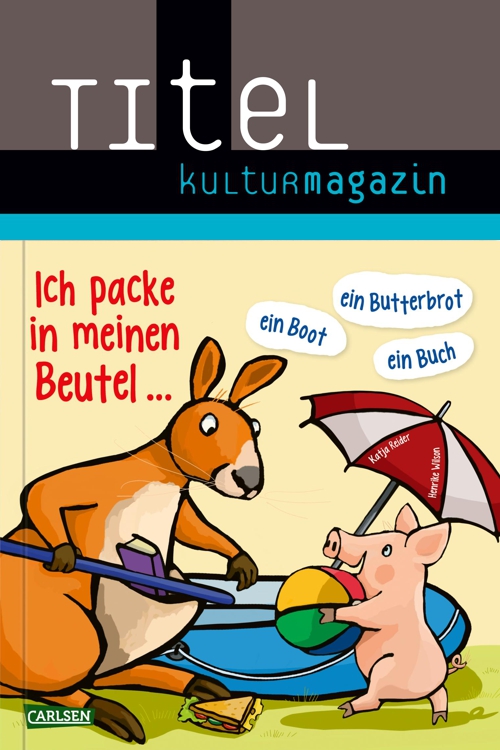Der Begriff Utopie hat in seiner Karriere zahlreiche Wandlungen erlebt, viele verschiedene Erwartungen wurden an ihn gerichtet. Vom Kampfbegriff bis zum futuristischen Ideal reicht dabei seine Spannbreite. RUDOLF INDERST hat sich mit Vorstellungen von Utopien auseinandergesetzt.
Schriftsteller wie Comte de Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1856), Robert Owen (1771-1858), Étienne Cabet (1788-1856) oder Edward Bellamy (1850-1889) waren es, welche im 19. Jahrhundert die Prozesse der Industrialisierung als globalhistorische Herausforderung deuteten. Die teils vor und teils zeitlich parallel zu Marx Wirken entstandenen sozialistischen und sozialreformerischen Ideen sind unter der Bezeichnung »Frühsozialismus« (in der marxistischen Forschungsliteratur/Terminologie: »vorwissenschaftlicher« bzw. »utopischer Sozialismus«) in die wissenschaftliche Diskussion eingegangen. Sie bilden ein Konglomerat an philosophischen, religiös-schwärmerischen und ökonomisch-politischen Vorstellungen und Visionen. Hauptsächlich tritt dieser Frühsozialismus – beeinflusst von aufklärerischen Ideen einer allgemeinen Weltverbesserung – in Frankreich auf.
Der Begriff »Utopie« wird zu diesem Zeitpunkt ein politischer Kampfbegriff. Liberale und Sozialisten beziehungsweise deren Programme werden von konservativer Seite als utopisch, sprich unrealisierbar und träumerisch verdächtigt. Umgekehrt bezichtigen linksgerichtete Kräfte den Konservatismus einer restaurativ-utopischen Diskriminierung.
Der frühsozialistische oder bolschewistische, oft auch uneinheitliche Utopiediskurs wurde von Marx und Engels heftig kritisiert. Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit stand im Raum: Angeblich verstünden die frühsozialistischen Utopisten nicht die Rolle des industriellen Proletariats bei der gesellschaftlichen Umwälzung, außerdem durchschauten die Schriftsteller nicht die kapitalistische Gesellschaft, was zu verzerrten Gegenentwürfen in Form von literarischen Utopien führe. Grundlage für den marxistischen, »wissenschaftlichen« Sozialismus, der den utopischen ablösen sollte, war die materialistische Geschichtsauffassung und die dialektische Analyse der Gesellschaft.
Tatsächlich versuchten Owen sowie Fourier und Cabet, utopische Gemeinden zu installieren. Die Umsetzungsversuche der theoretischen Ideale in Form von verschiedenen Siedlungen und Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika scheiterten allerdings.
Neben geschilderten frühsozialistischen Visionen bestimmte noch ein anderes Sujet parallel, sich manchmal verzahnend und überscheidend die utopische Literaturlandschaft: Das 19. Jahrhundert war gekennzeichnet von einem enormen Handels-, Industrie- und Verkehrswachstum.
Aber auch die technischen sowie wissenschaftlichen Neuerungen und Möglichkeiten erfuhren diesen Innovationsschub. Damit eng verknüpft waren Hoffnungen von Autoren wie H. G. Wells oder Alexander Bogdanov auf eine allgemeine Verbesserung bzw. Erleichterung des menschlichen Daseins.
Das Grundmotiv H.G. Wells‘ Denkens war stets die Frage »Wozu wird das führen?« Sein gesamtes literarisches Werk, von theoretischen Schriften zu Biologie, Zeitgeschichte, Politik und Philosophie bis hin zu den Romanen und Erzählungen, unterstreicht die bedeutsame Rolle, die die Prognostik in der modernen Utopie künftig spielen sollte.
Leistungen von Naturwissenschaft und Technik sollten von nun an Ver- beziehungsweise Misstrauen bezüglich zukünftiger Entwicklungen prägen.
Der Wells’sche Umbruch bewirkt eine Art Entpolitisierung der alten Staatsromane. Interessanterweise gaben Samjatin, Orwell und Huxley, die drei großen Dystopiker des 20. Jahrhunderts, an, mit ihren Werken in gewisser Weise auf Wells‘ Schriften zu antworten.
H.G. Wells sah die einzige Überlebenschance der Menschheit in der Gründung eines Weltstaates. Er war ein Verfechter der Idee der Vereinten Nationen, war deren erster Generalsekretär und unterstützte zuvor die Idee des Völkerbundes. Zu seinen bekanntesten Werken zählen: ›The Time Machine‹ (1895), ›The Island of Dr. Moreau‹ (1896) und ›The War of the Worlds‹ (1889). Besonders bedeutsam erscheint ›The Shape of Things to Come‹. Die pessimistische Zukunftsvision vom Rückfall in die Barbarei erscheint im Jahr der Machtergreifung Hitlers 1933.
Zusammengefasst nimmt das 19. Jahrhundert in der Utopien-Betrachtung einen besonderen Platz ein: Während sich bereits im 18. Jahrhundert ein zarter, funktionaler Paradigmenwechsel durch den Sprung von der »Raum«- zur »Zeit«-Utopie (U-Chronie bzw. Zeitreiseromane) und den damit verbundenen Verwirklichungs-Imaginationen der AutorInnen literarischer Entwürfe abzeichnete, ist es im 19. Jahrhundert der frühsozialistische Utopiediskurs, der eine zentrale Rolle einnimmt.
Industrie, Technik und Wissenschaft nehmen Schlüsselpositionen in diesen Schriften ein und eine frühe – mitunter abenteuerlustige – Science Fiction nimmt Fahrt auf, wenngleich am Ende dieser Periode bereits ein finsteres 20. Jahrhundert seine dystopischen Schatten mit den großen Drei – Jewgenij Samjatin, George Orwell und Aldous Huxley – vorauswirft.
| RUDOLF INDERST
| Titelfoto: PxHere
Lesetipp
Thomas Schölderle: Geschichte der Utopie
Eine Einführung (2. Auflage, Neuausg.)
Böhlau/Köln: utb 2017
211 Seiten, 17,99 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander