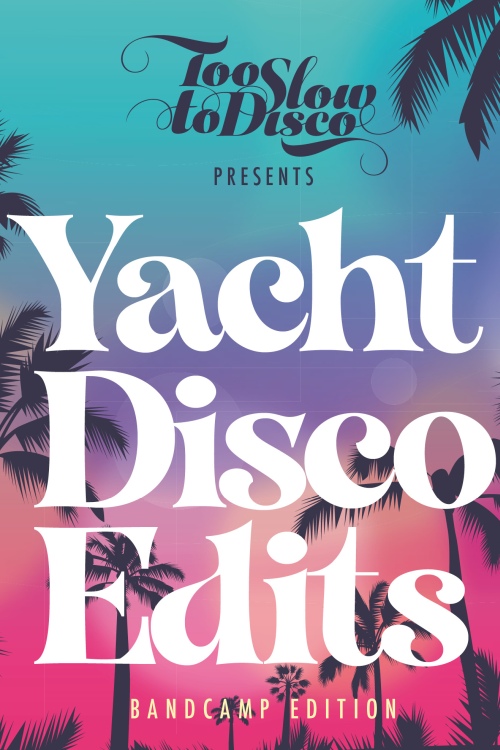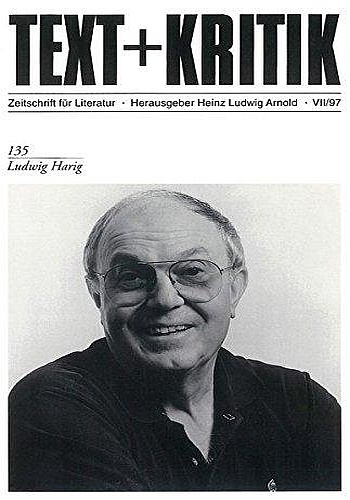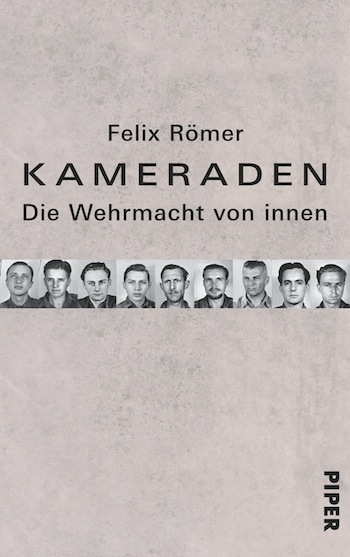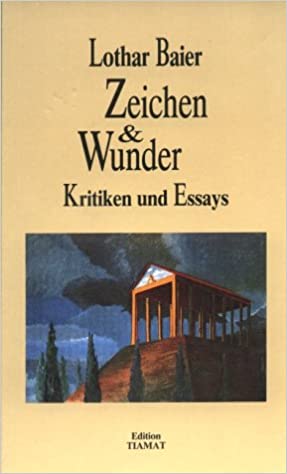Brendel Mendelssohn, die später Dorothea Schlegel hieß, zählte zu den bekanntesten Schriftstellerinnen und Literaturkritikerinnen der deutschen Romantik. Aber nicht nur ihr Werk, sondern auch ihr Leben und ihre Verbindung zu Friedrich Schlegel sorgten damals für Aufsehen. Der Historiker, Publizist und Vorsitzende der Moses Mendelssohn Stiftung Julius H. Schoeps hat eine feine, kleine Biographie über diese besondere und bemerkenswerte Persönlichkeit geschrieben. BETTINA GUTIERREZ hat ihn hierzu befragt.
 TITEL: Brendel Mendelssohn, die älteste Tochter des Philosophen und Aufklärers Moses Mendelssohn, heiratete auf Bitten ihres Vaters den Kaufmann Simon Veit. Es gibt viele Mutmaßungen über diese Ehe.
TITEL: Brendel Mendelssohn, die älteste Tochter des Philosophen und Aufklärers Moses Mendelssohn, heiratete auf Bitten ihres Vaters den Kaufmann Simon Veit. Es gibt viele Mutmaßungen über diese Ehe.
Julius Schoeps: Die von Moses Mendelssohn eingefädelte Ehe war nicht so glücklich, wie das der Berliner Philosoph sich vorgestellt hatte. Es war, wie sich alsbald zeigen sollte, eine eher problematische Ehe. Es war eine Verbindung, die unter keinem guten Stern stand. Brendel, die gerade einmal 18 Jahre alt war, als sie mit Simon verheiratet wurde, fand im Zusammenleben mit diesem ganz offensichtlich nicht die Erfüllung, die sich ihr Vater wohl erhofft hatte. Henriette Herz, Brendels Jugendfreundin bezeugt, dass sie in dieser Ehe keine »innere Befriedigung« gefunden habe.
Gemeinsam mit ihren Freundinnen Henriette Herz und Rahel Levin gründete sie in Berlin die literarische Salonkultur. Welche kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung hatten diese Salons?
Das vielgerühmte Dreigestirn Brendel Veit, Henriette Herz und Rahel Levin, die spätere Frau des Diplomaten August von Varnhagen von Ense, gilt als der Anbeginn der Salonkultur in Berlin. Von den drei Frauen soll, so kolportierte man, Henriette die schönste, Rahel die intelligenteste und Brendel die romantischste gewesen sein. Frauenrechtlerinnen in dem Sinne, wie wir sie uns heute vorstellen, waren Henriette Herz, Rahel Levin und Brendel Veit allerdings nicht, aber sie waren doch, das ist unbestritten, Frauen, die sich ihrer selbst bewusst geworden waren und in ihren Salons den freieren Umgang mit- und untereinander probten Brendel und ihr Freundeskreis kommunizierten und parlierten in höchst kapriziöser Weise miteinander und waren bemüht bei ihren Treffen, beim Nachmittagstee, beim »Damentee« oder beim Abendessen, sich gegenseitig zu belehren und die neueste Literatur vorzustellen. Man sprach sich mit dem informellen »Du« an, umarmte sich, küsste einander und gab sich gegenseitige Versprechen, füreinander und für andere da zu sein.
Mit dem Schriftsteller Friedrich Schlegel ging Brendel, die sich später Dorothea nannte, erneut eine Verbindung und Ehe ein. Damals war dies ein Skandal. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
Der junge Mann, in den Dorothea sich im Salon ihrer Freundin Henriette Hals über Kopf verliebte, war in der Tat kein Geringerer als Friedrich Schlegel, ein Intellektueller, der jüngere von zwei Brüdern. Spötter behaupteten damals, der ältere Bruder, Wilhelm August Schlegel, ein Shakespeare-Übersetzer, habe Talent, sei aber kein Genie, Friedrich Schlegel hingegen, der Geliebte Dorotheas, sei ein Genie, besäße aber kein Talent. Die Affäre erregte einiges Aufsehen. In den Berliner Salons wurde getratscht und hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Liebesverhältnisse waren zwar nichts Ungewöhnliches, in diesem Fall aber doch. Brendel war nicht irgendjemand, sondern eine Jüdin und zudem noch die Tochter des berühmten Moses Mendelssohn. Dass der Ehebruch von ihr in aller Öffentlichkeit begangen wurde, erregte Bewunderung, zumal wegen des Mutes, den sie dabei an den Tag legte.
Sie betätigte sich ebenfalls als Schriftstellerin. Ihr bekanntester Roman ist Florentin. Welche Rolle spielte das Schreiben für sie?
Von dem ursprünglich auf zwei Bände angelegten Florentin ist nur ein Band erschienen. Das Werk war seitens Dorotheas ganz offensichtlich als ironisches Gegenstück zu Friedrich Schlegels Lucinde gedacht. Der Leser konnte gar nicht anders, als in dem auf Suche nach Glück durch das Land streifenden aristokratischen Vagabunden Florentin Friedrich Schlegel zu erkennen und in der Frau, der sich Florentin-Friedrich schließlich zuwendet, die nachempfundene Dorothea Veit erblicken. Die Ähnlichkeit mit den lebenden Personen ist offensichtlich und war von Dorothea beabsichtigt.
Dass Dorothea sich mit dem Schreiben beschäftigte, geschah nicht aus Profilierungssucht, sondern, wie manche ihrer Äußerungen erkennen lassen, aus Gründen materieller Not; sie glaubte, mit den zu erzielenden Erlösen zum häuslichen Budget beitragen zu können. Ihren Florentin ließ sie 1801 allerdings nicht unter ihrem Namen erscheinen, sondern anonym und mit dem erläuternden Zusatz versehen: »Ein Roman, herausgegeben von Friedrich Schlegel«.
Wie in Friedrich Schlegels Lucinde ging es auch in Dorotheas Florentin um das Durchbrechen und Überwinden der traditionellen Geschlechterrollen. Warum sie zur Feder greife, um etwas zu Papier zu bringen, versuchte Dorothea in einem ihrer Tagebucheinträge zu erläutern. »Oft habe ich«, so Dorothea in der für sie typischen Art zu formulieren, »einen wahren Widerwillen gegen alles Schreiben, dann fliegt mir plötzlich ein wahrer Appetit dazu an. Es ist doch oft weiter nichts, als dass man gern schwatzen möchte.«
Zusammen mit ihrem Ehemann Friedrich trat sie zum Katholizismus über. Der Untertitel Ihrer Biographie lautet »Ein Leben zwischen Judentum und Christentum«.
Die Miniatur trägt in der Tat den Untertitel »Ein Leben zwischen Judentum und Christentum«. Dorothea, ursprünglich Jüdin, trat zunächst zum Protestantismus, dann 1808 zusammen mit ihrem Ehemann zum Katholizismus über. Einstige Vorbehalte gegenüber der römischen Kirche galten nicht mehr. Der Katholizismus gewann für das Ehepaar zunehmend an Attraktivität. Dazu beigetragen haben dürfte die frühromantische Lebens- und Weltanschauung. Im Verlauf der Jahre entwickelten sich die Schlegels zunehmend zu Propagandisten des Katholizismus, den sie dem Protestantismus als überlegen ansahen. Dessen ungeachtet hat Dorothea sich Zeit ihres Lebens zu ihrer jüdischen Herkunft bekannt und war stolz darauf die Tochter Moses Mendelssohn zu sein.
Vielfältig waren die Stationen ihres Lebens; sie lebte zum Teil mit Friedrich Schlegel in Jena, Paris, Köln, Wien und Rom. Welches war die für sie prägendste oder wichtigste Station?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Glücklich war Dorothea auch in Jena, wo sie in einer »Wohngemeinschaft«, in einer »Communität«, wie diese genannt wurde, mit ihrem Lebensgefährten und dessen Bruder August Wilhelm Schlegel und seiner Ehefrau Caroline zusammenlebte. Durch Friedrich, ihren Lebensgefährten, fand sie Anschluss an den Kreis der Frühromantiker, die sich um die Zeitschrift »Athenäum« geschart hatten. Dieser Gruppierung gehörten neben den beiden Schlegels, die auch Herausgeber der Zeitschrift waren, u.a. Ludwig Tieck, Novalis und der junge Philosoph Friedrich Wilhelm Schelling an. In den Zusammenkünften diskutierte man über das Wesen der Natur und zerbrach sich den Kopf, ob es so etwas wie eine Weltenseele gäbe.
Paris, Köln, und Wien waren Stationen in Dorotheas Leben. Wirklich glücklich war sie in den Jahren, die sie in Rom verbrachte: Dorothea lebte dort in einer Art »Frauenkommune«, zusammen mit ihren Freundinnen Henriette Herz, Karoline Klein und der Malerin Louise Seidler.
Die Briefe Dorotheas an Friedrich Schlegel belegen dies; Dorothea besuchte ihre beiden Söhne, beide Maler, in Rom. Mit ihnen, die dort zum Kreis der Nazarener gehörten, die auf der Suche nach einem neuen Kunstverständnis waren, war sie bemüht, den Fesseln und Bedrängnissen ihrer Existenz in Deutschland zu entfliehen. Sie genoss das Leben in der Stadt am Tiber in vollen Zügen. Sie schwelgte in Beschreibungen der Schönheit der italienischen Landschaft, der Farben des Himmels, des Lichts, der Sonnenuntergänge, der Abende und des Mondscheins.
Welche Bedeutung haben Dorothea Schlegel und ihr Werk in der heutigen Zeit?
Es gilt heute Dorothea Schlegel wieder zu entdecken. Sie war eine sehr starke, gebildete und interessante Persönlichkeit und verdient es, dass man sich ihrer erinnert.
| Das Interview mit Julis H. Schoeps führte BETTINA GUTIERRÈZ
Titelangaben
Julius H. Schoeps: Dorothea Veit/Schlegel. Ein Leben zwischen Judentum und Christentum
Jüdische Miniaturen Band 250
Berlin: Hentrich & Hentrich 2020
72 Seiten, 8,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander