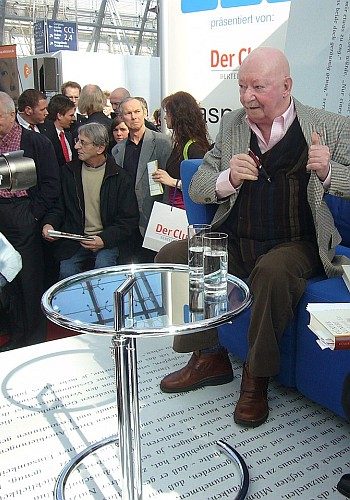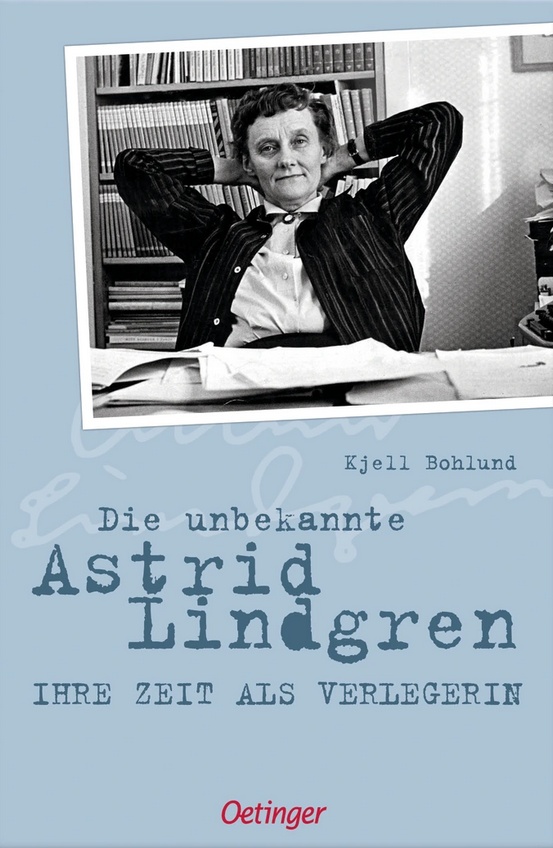»Dank meinem Vater, einem Hochstapler und Betrüger, war ich schon in meiner Kindheit mit dem verführerischen Charme der kriminellen Welt vertraut und genötigt, mir für mein Leben ein moralisches Konzept zurecht zu schnitzen«, bekannte David John Moore Cornwell 2011 in einem Interview mit der ›Neuen Zürcher Zeitung‹. Von PETER MOHR
Nur absolute Insider wissen etwas mit diesem Namen anzufangen. Aus jener Person war nach dem Germanistikstudium, einer kurzen Etappe als Lehrer an der Nobelschule in Eton und einigen Jahren als Diplomat (u.a. in Bonn und Hamburg) und Geheimdienstmitarbeiter der englischen Regierung Anfang der 60er Jahre der erfolgreiche Schriftsteller John le Carré geworden. Das Pseudonym war unumgänglich geworden, denn als der erste Roman aus seiner Feder erschien, stand er noch als Staatsbeamter in Lohn und Brot.
Mit jenem Erstling ›Der Spion, der aus der Kälte kam‹ (dt. 1964) – später mit Richard Burton in der Hauptrolle erfolgreich verfilmt – hatte le Carré bereits das Thema gefunden, das ihn viele Jahre fesselte: der Ost-West-Konflikt und die damit verbundenen Spionageaffären.
In all seinen späteren Romanen hat sich der Autor allerdings immer eine kritisch-ironische Distanz zur Spionage bewahrt. Vom »Hokuspokus der Spionagetechnik« schrieb er selbst im Zusammenhang mit seinem Debütwerk. Und seinen lange gehegten Protagonisten George Smiley, der zuletzt 1991 in ›Der heimliche Gefährte‹ auftrat, charakterisierte le Carré mit den Worten: »Der arme alte George war auch in seinen besten Zeiten niemals ein glücklicher kalter Krieger.«
Le Carré traf über viele Jahre mit seinen Werken mitten ins Herz des westlichen Zeitgeistes. Der auserkorene Feind saß in Moskau und musste dementsprechend nach allen Regeln der Spionage-»kunst« bekämpft werden. So glichen sich auch häufig die Strickmuster seiner Romane, denn am Ende triumphierten – trotz der künstlich aufgebauten Spannung – stets die westlichen Geheimdienste, so auch in seinem letzten ganz großen »Wurf«, den mit Sean Connery in der Hauptrolle verfilmten Roman ›Das Rußland-Haus‹ (1989).
Le Carrés spektakulärster Roman gehört nicht zu seinen erfolgreichen Titeln. Kurz nach dem Erscheinen von ›Dame, König, As, Spion‹ (1974), in dem es um einen östlichen »Maulwurf« ging, der in exponierter Stellung in einer westlichen Regierung saß, war in Deutschland die Guillaume-Affäre aufgeflogen, die zum Rücktritt des damaligen Kanzlers Willy Brandt führte.
Viele Skeptiker hatten befürchtet, dass le Carré nach Glasnost und Perestroika, nach dem Mauerfall und den politischen Reformen im ehemaligen Ostblock die Themen ausgehen würden. Doch davon konnte keine Rede sein, denn noch ehe in Grosny die ersten Schüsse fielen, war le Carré bereits vor Ort gewesen und hatte für ›Unser Spiel‹ (dt. 1995) recherchiert. Es ging um den Unabhängigkeitskampf der kaukasischen Volksstämme – und immer noch saß der Feind in Moskau.
Mit seinen Romanen ›Der Schneider von Panama‹ und ›Der ewige Gärtner‹ hat sich John le Carré vom Ost-West-Thema verabschiedet. »Mein Instinkt sagte mir, dass ich den Machenschaften der Multis in Afrika nachspüren müsse. In der Theorie ist zwar die kolonialistische Ausbeutung schon lange überwunden, aber mich interessierte, wie heute die Armen von den Reichen ausgebeutet werden«, legte der Autor in einem Interview seine Beweggründe dar.
In ›Marionetten‹ (2008) hatte sich der Brite mit der seit dem 11. September 2001 in der westlichen Welt grassierenden Angst vor islamistischen Terroranschlägen gewidmet. Le Carrés letzte Geschichte ›Agent Running in the Field‹ war im Oktober 2019 erschienen.
John le Carré verstand es in seinen besten, oftmals hochpolitischen Romanen, überaus spannend zu erzählen, zudem verfügte er über ein ausgeprägtes Gespür für brisante Themen. Manchmal war der Brite gar dem politischen Zeitgeist einige Schritte voraus. Am Samstag ist John le Carré im Alter von 89 Jahren in Cornwall an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.