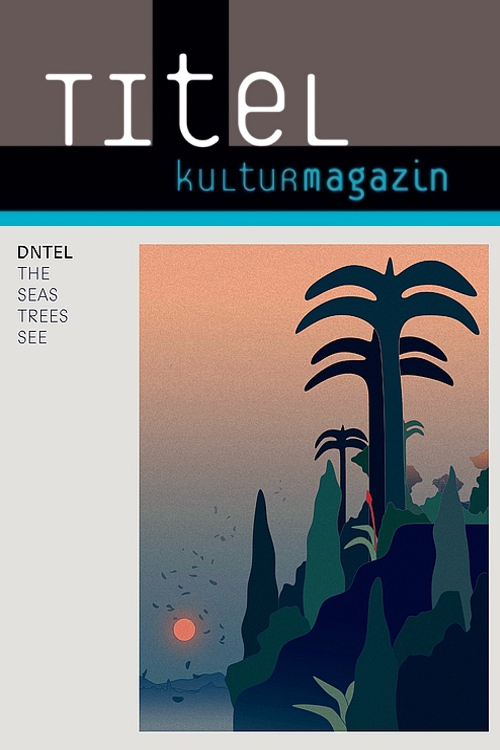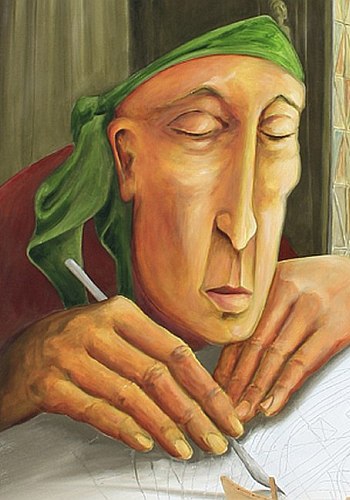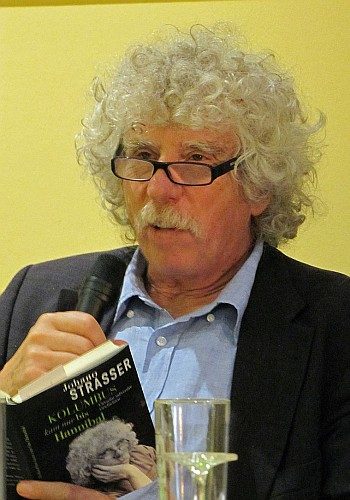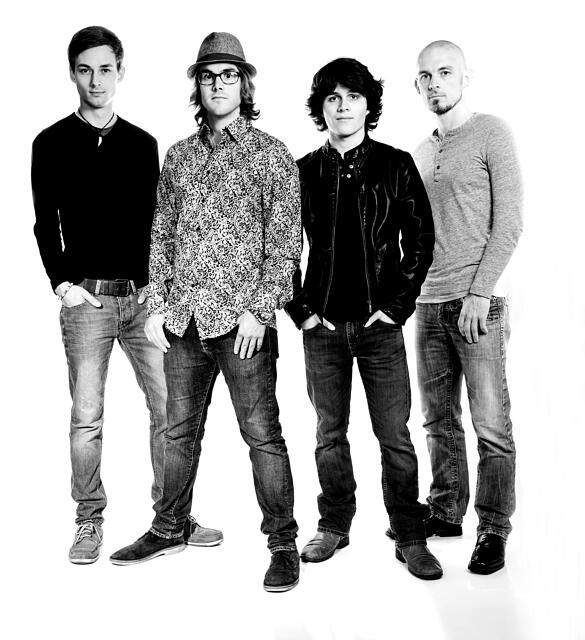Vier empfehlenswerte Bücher zum 100. Geburtstag des amerikanischen Philosophen John Rawls und zum 50. Jahrestag des Erscheinens seiner ›Theorie der Gerechtigkeit‹ . Von DIETER KALTWASSER
 Die Geschichte der politischen Philosophie lässt sich durch zwei Denker markieren: Der Anfang mit Platon und das allerdings nur vorläufige Ende mit John Rawls, dessen Geburtstag sich am 21. Februar 2021 zum 100. Mal jährte. Sein Hauptwerk ›Eine Theorie der Gerechtigkeit‹, 1971 erschienen, ist für den Philosophen Otfried Höffe der bedeutendste englischsprachige Beitrag, vermutlich sogar die wichtigste Schrift des 20. Jahrhunderts zur philosophischen Ethik und politischen Philosophie. Rawls betont in ihr, »dass Zufälligkeiten der natürlichen Begabung und der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht zu politischen und wirtschaftlichen Vorteilen führen dürfen.« Der amerikanische Philosoph lehnte eine Meritokratie ab, die akademischen Eliten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft anzunehmen erlaubt, ihr finanzieller Verdienst sei auch moralisch verdient.
Die Geschichte der politischen Philosophie lässt sich durch zwei Denker markieren: Der Anfang mit Platon und das allerdings nur vorläufige Ende mit John Rawls, dessen Geburtstag sich am 21. Februar 2021 zum 100. Mal jährte. Sein Hauptwerk ›Eine Theorie der Gerechtigkeit‹, 1971 erschienen, ist für den Philosophen Otfried Höffe der bedeutendste englischsprachige Beitrag, vermutlich sogar die wichtigste Schrift des 20. Jahrhunderts zur philosophischen Ethik und politischen Philosophie. Rawls betont in ihr, »dass Zufälligkeiten der natürlichen Begabung und der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht zu politischen und wirtschaftlichen Vorteilen führen dürfen.« Der amerikanische Philosoph lehnte eine Meritokratie ab, die akademischen Eliten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft anzunehmen erlaubt, ihr finanzieller Verdienst sei auch moralisch verdient.
Rawls Grundgedanke, von Immanuel Kants Idee der Autonomie inspiriert, besteht in einer vertragstheoretischen Auffassung der Gerechtigkeit als Fairness, heißt es in Höffes kongenialem neuen Buch ›Gerechtigkeit denken – John Rawls epochales Werk der politischen Philosophie‹. Dieser Auffassung zufolge besitzt »jeder Mensch eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit, die auch im Namen des Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann. Daher lässt es die Gerechtigkeit nicht zu, dass der Verlust der Freiheit bei einigen durch ein größeres Wohl für andere wettgemacht wird.«
Bei der Beantwortung der Frage, welche Grundregeln eine gerechte Gesellschaft braucht, bediente sich Rawls eines Gedankenexperimentes. Die Vertragspartner befinden sich in einem hypothetischen »Urzustand«, der durch den »Schleier des Nichtwissens« gekennzeichnet ist und den Zustand der Menschen in einer fiktiven Entscheidungssituation bezeichnet, in dem sie zwar über die zukünftige Gesellschaftsordnung entscheiden können, aber selbst nicht wissen, an welcher Stelle dieser Ordnung sie sich später befinden werden. In dieser angenommenen Situation wird über die Gerechtigkeitsprinzipien entschieden, die der realen Gesellschaftsordnung zugrunde liegen sollen. »Einerseits größte gleiche Freiheit für alle und zum anderen, vorausgesetzt, es gibt eine Chancengerechtigkeit, dann soll es den Schlechtestgestellten möglichst gut ergehen«, so Höffe.
Rawls geht davon aus, dass Personen sich in einem Zustand des Nichtwissens unter fairen Bedingungen auf zwei Gerechtigkeitsprinzipien einigen, welche alle Beteiligten anerkennen können. Seine zwei Gerechtigkeitsgrundsätze lauten:
2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offenstehen.«
In seinem zweiten Hauptwerk ›Politischer Liberalismus‹ entwirft Rawls seine vertragstheoretische Auffassung der Gerechtigkeit als Fairness für die moderne rechts- und verfassungsstaatliche Demokratie und ihren religiösen und weltanschaulichen Pluralismus; in seinem Werk »Das Recht der Völker« weitet Rawls sie auf die internationalen Beziehungen aus.
 Mit ihrem neuen Buch ›Politische Gleichheit‹ will die amerikanische Politologin Danielle Allen das »egalitäre Kernversprechen der Demokratie« erneuern. Die 1971 geborene Harvard-Professorin, die an der gleichen Universität politische Wissenschaft lehrt wie einst John Rawls, plädiert in ihrem instruktiven Buch dafür, »die egalitäre Ermächtigung aller Mitglieder des politischen Gemeinwesens sicherzustellen.« Theoretikern eines abstrakten liberalen Gleichheitsideals setzt sie entgegen: »Wenn menschliches Wohlergehen Autonomie erfordert, dann erfordert es auch eine Erfahrung politischer Gleichheit.« Ihr Buch basiert auf den Adorno-Vorlesungen, die sie 2017 auf Einladung der Goethe-Universität in Frankfurt hielt.
Mit ihrem neuen Buch ›Politische Gleichheit‹ will die amerikanische Politologin Danielle Allen das »egalitäre Kernversprechen der Demokratie« erneuern. Die 1971 geborene Harvard-Professorin, die an der gleichen Universität politische Wissenschaft lehrt wie einst John Rawls, plädiert in ihrem instruktiven Buch dafür, »die egalitäre Ermächtigung aller Mitglieder des politischen Gemeinwesens sicherzustellen.« Theoretikern eines abstrakten liberalen Gleichheitsideals setzt sie entgegen: »Wenn menschliches Wohlergehen Autonomie erfordert, dann erfordert es auch eine Erfahrung politischer Gleichheit.« Ihr Buch basiert auf den Adorno-Vorlesungen, die sie 2017 auf Einladung der Goethe-Universität in Frankfurt hielt.
Anstelle von (oder in Ergänzung zu) Rawls »Differenzprinzip« setzt Allen auf die »Differenz ohne Herrschaft«. Ihrer Ansicht nach »besteht politische Gleichheit aus fünf Phänomenen: aus Herrschaftsfreiheit, gleichberechtigtem Zugang zum Regierungsapparat, epistemischem Egalitarismus, gleicher, sich auf Praktiken der Gegenseitigkeit stützender Handlungsmacht (agency) sowie Mitgestaltung von und Miteigentümerschaft an unseren politischen Institutionen [z.B. Verbot der Privatisierung von Gefängnissen] und deren weiteren Auswirkungen.«
Ihre Kritik an Rawls Gerechtigkeitskonzeption bezieht sich vor allem auf einen »Hauptfehler« Rawls: Er räume »negativen Freiheiten« einen anderen Stellenwert ein »als positiven Freiheiten«. So komme für ihn dem Recht auf Eigentum eine höhere Gewichtung zu als dem Streben nach »öffentlicher Autonomie«. Entsprechend wenig Platz räume Rawls der Gleichheit in politischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht ein. Danielle Allen plädiert vehement für eine größere Chancengleichheit in sozialen und wirtschaftlichen Belangen, denn »zu viel Ungleichheit bedroht die Demokratie.« Danielle Allens neue Gerechtigkeitstheorie beruht auf der Idee, positiven und negativen Freiheitsrechten den gleichen Rang einzuräumen mit dem Ziel, in diversen Gesellschaften politische Gleichheit zu garantieren. Sie darf als eine kritische Ergänzung zu Rawls ›Theorie der Gerechtigkeit‹ gelesen werden.
Der Frankfurter Philosoph Rainer Forst hat anlässlich des 100. Geburtstags von John Rawls und des 50. Jahrestags des Erscheinens von »Eine Theorie der Gerechtigkeit« in einem luziden Beitrag für die ›Zeit‹ unter dem Titel »Gerechtigkeit. Was sonst?« betont, dass »die Radikalität der Rawlsschen Theorie im Differenzprinzip begründet« liege, das oft verkürzt werde. Es besage nicht, dass die Regelung gerecht sei, die den Schlechtestgestellten »auch etwas« bringe, es fordere vielmehr, »dass eine jede Ungleichverteilung von Gütern die extrem hohe Rechtfertigungsschwelle überqueren muss, nach der zu zeigen ist, dass eine Ungleichverteilung den Schlechtestgestellten mehr an Gütern einbringt als eine Gleichverteilung.« Rawls drückt nach Ansicht von Forst hier etwas aus, das in der Geschichte des politischen Denkens äußerst selten sei, »nämlich die Grundidee des Liberalismus (die Würde der Einzelnen als autonome, durch Rechte geschützte Individuen) mit der Grundidee des Sozialismus (die Würde der Einzelnen als frei von Ausbeutung und Marginalisierung) zusammenzudenken.« Rawls’ Theorie lasse »nur die Alternative zwischen einem liberalen Sozialismus und einer Demokratie mit breit gestreutem Eigentum (property-owning democracy) zu.« Es ist Rawls bleibendes Verdienst, betont der Frankfurter Philosoph, dass er den Blick der Gerechtigkeit radikal gewendet habe, weg von individualistischen Verdienstvorstellungen hin zu Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit.
Doch zwischen der politischen Philosophie und ihrer »idealen Theorie« einer wohlgeordneten Gesellschaft und den strukturellen Ungerechtigkeiten der Gesellschaft tut sich eine Lücke auf, gegen die sich emanzipatorische Kämpfe richten. Es müsse zu den Prinzipien Rawls, so Forst, eine kritische Theorie hinzugenommen werden, die »die vielfältigen Strukturen der Beherrschung erklärt und Ansatzpunkte für Veränderungen liefert. Eine solche, normative und empirisch-analytische Elemente verbindende Theorie ist eine Aufgabe, die über Rawls’ Prämissen hinausreicht.«
In fünfzehn Jahren interdisziplinärer Zusammenarbeit, von der Philosophie, den Geschichtswissenschaften, der Politikwissenschaft und der Rechtswissenschaft über die Ethnologie und die Ökonomie bis zur Soziologie und Theologie, haben die Wissenschaftler*innen des Exzellenzclusters »Normativer Ordnungen« der Goethe-Universität Frankfurt untersucht, was diese normativen Ordnungen sind, wie sie sich herausbilden, stabilisieren und umgestalten.
 Herausgegeben von den Clustersprechern Prof. Dr. Rainer Forst und Prof. Dr. Klaus Günther, ist im April 2021 der Sammelband ›Normative Ordnungen‹ erschienen. Das Werk versammelt nach einer Einleitung der Herausgeber zum Forschungsprogramm 26 Beiträge von Wissenschaftler*innen des Forschungsverbunds. In diesem Buch findet sich auch ein Aufsatz von Jürgen Habermas, den er anlässlich seines 90. Geburtstag auf Einladung des Forschungsverbunds vortrug. Der Band ist inhaltlich an den Leitfragen des Forschungsprogramms orientiert und stellt die Pluralität der Fragen und Ansätze dar, welcher die Erforschung komplexer normativer Ordnungen bedarf.
Herausgegeben von den Clustersprechern Prof. Dr. Rainer Forst und Prof. Dr. Klaus Günther, ist im April 2021 der Sammelband ›Normative Ordnungen‹ erschienen. Das Werk versammelt nach einer Einleitung der Herausgeber zum Forschungsprogramm 26 Beiträge von Wissenschaftler*innen des Forschungsverbunds. In diesem Buch findet sich auch ein Aufsatz von Jürgen Habermas, den er anlässlich seines 90. Geburtstag auf Einladung des Forschungsverbunds vortrug. Der Band ist inhaltlich an den Leitfragen des Forschungsprogramms orientiert und stellt die Pluralität der Fragen und Ansätze dar, welcher die Erforschung komplexer normativer Ordnungen bedarf.
Solche Ordnungen sind Rechtfertigungsordnungen und entstehen und vergehen in dem Maße, in dem historische Narrative, Normen der Moral, des Rechts, Konventionen, religiöse Überzeugungen und politische Legitimation sich zusammenfügen oder auseinandertreten. Einer der Schlüsselbegriffe ist dabei das »Rechtfertigungsnarrativ«, diese Narrative sind so charakterisiert, »dass sie Rechtfertigungen normativer Ordnungen mit den individuellen und kollektiven Erfahrungsräumen und Erfahrungshorizonten« verweben. Sie finden ihren Ausdruck in Erzählungen über vergangene Ereignisse, Konflikte, Revolutionen, »Gründungsmomente eines Neuanfangs oder erneuerte Kontinuität mit ihren jeweiligen Hoffnungen, vergangenen Zukünften und Fortschrittsperspektiven«, schreiben Rainer Forst und Klaus Günther; nur eine Verbindung aus normativer und empirischer Forschung vermag die Dynamiken dieser Ordnungen zu entschlüsseln.
 In keinem seiner publizierten Werke hat sich John Rawls systematisch mit Fragen der Religion auseinandergesetzt und auch darüber, wie er es persönlich mit dem Glauben hält, stets Diskretion bewahrt. John Rawls galt zeitlebens als »religiös unmusikalisch«, darin Jürgen Habermas nicht unähnlich. Nach seinem Tod im Jahr 2002 wurden jedoch zwei Texte entdeckt und 2010 erstmals in deutscher Übersetzung unter dem Titel ›Über Sünde, Glaube und Religion‹ mit einem Nachwort von Habermas veröffentlicht, die zu einer Revision dieses Bildes zwingen: seine »Senior Thesis«, die er 1942 im Alter von 21 Jahren an der Philosophischen Fakultät der Universität Princeton einreichte, sowie ein kurzer, sehr persönlicher später Text aus den neunziger Jahren. In ›Eine Theorie der Gerechtigkeit‹ heißt es zum Ende hin: »Der Blickwinkel der Ewigkeit ist nicht der eines bestimmten Ortes außerhalb der Welt, auch nicht der eines transzendenten Wesens; vielmehr ist er eine bestimmte Form des Denkens und Empfindens, die sich vernunftgeleitete Wesen in der Welt zu eigen machen können.«
In keinem seiner publizierten Werke hat sich John Rawls systematisch mit Fragen der Religion auseinandergesetzt und auch darüber, wie er es persönlich mit dem Glauben hält, stets Diskretion bewahrt. John Rawls galt zeitlebens als »religiös unmusikalisch«, darin Jürgen Habermas nicht unähnlich. Nach seinem Tod im Jahr 2002 wurden jedoch zwei Texte entdeckt und 2010 erstmals in deutscher Übersetzung unter dem Titel ›Über Sünde, Glaube und Religion‹ mit einem Nachwort von Habermas veröffentlicht, die zu einer Revision dieses Bildes zwingen: seine »Senior Thesis«, die er 1942 im Alter von 21 Jahren an der Philosophischen Fakultät der Universität Princeton einreichte, sowie ein kurzer, sehr persönlicher später Text aus den neunziger Jahren. In ›Eine Theorie der Gerechtigkeit‹ heißt es zum Ende hin: »Der Blickwinkel der Ewigkeit ist nicht der eines bestimmten Ortes außerhalb der Welt, auch nicht der eines transzendenten Wesens; vielmehr ist er eine bestimmte Form des Denkens und Empfindens, die sich vernunftgeleitete Wesen in der Welt zu eigen machen können.«
Titelangaben
Ottfried Höffe: Gerechtigkeit denken
John Rawls‘ epochales Werk der politischen Philosophie
Verlag Karl Alber, Freiburg / München 2021
192 Seiten, 28 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Leseprobe
Danielle Allen: Politische Gleichheit
Aus dem Englischen von Christine Pries
Berlin: Suhrkamp Verlag 2020
200 Seiten, 26 EUR
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Leseprobe
John Rawls: Über Sünde, Glaube und Religion
Mit Kommentaren von Joshua Cohen, Thomas Nagel und Robert Merrihew Adams
Mit einem Nachwort von Jürgen Habermas
Aus dem Amerikanischen von Sebastian Schwark.
Berlin: Suhrkamp Verlag 2021
343 Seiten, 26,90 EUR
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Leseprobe
Rainer Forst und Klaus Günther (Hgg.): Normative Ordnungen
Berlin: Suhrkamp Verlag 2021
683 Seiten, 25 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Leseprobe