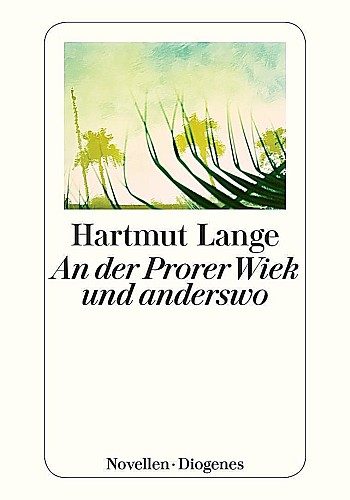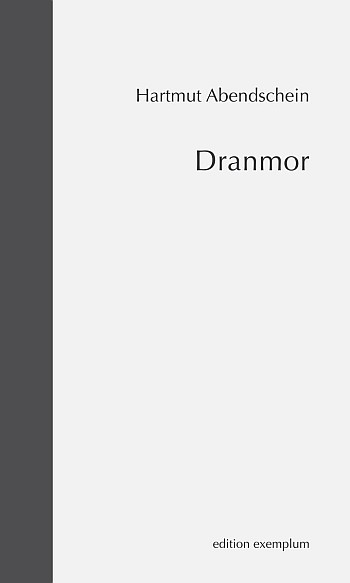Helga Schubert ist eine deutsche Schriftstellerin und Psychologin. In den 29 autobiographischen Erzählungen des Bandes Vom Aufstehen zieht sie ein breit angelegtes Fazit ihres 80-jährigen Lebens: Sie berichtet darin persönliche Erinnerungen an ihre Großeltern und Eltern ebenso wie Erlebnisse aus ihrer Zeit als Schriftstellerin in der DDR oder aus der Zeit der Wende, in der sie sich in der Kirche engagierte. Von FLORIAN BIRNMEYER
 Für die titelgebende Erzählung »Vom Aufstehen« wurde Helga Schubert, die mit bürgerlichem Namen Helga Helm heißt, als älteste Preisträgerin bislang mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2020 ausgezeichnet. Es handelt sich um eine Hommage an Ingeborg Bachmanns Erzählung »Das dreißigste Jahr«, die ebenfalls das Thema Aufstehen behandelt. Bereits im Jahr 1980 war Schubert auf Vorschlag nach Klagenfurt eingeladen worden, allerdings durfte die Schriftstellerin damals nicht aus der DDR nach Österreich ausreisen – mit der Begründung, dass es keine einheitliche »deutsche« Literatur gebe.
Für die titelgebende Erzählung »Vom Aufstehen« wurde Helga Schubert, die mit bürgerlichem Namen Helga Helm heißt, als älteste Preisträgerin bislang mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2020 ausgezeichnet. Es handelt sich um eine Hommage an Ingeborg Bachmanns Erzählung »Das dreißigste Jahr«, die ebenfalls das Thema Aufstehen behandelt. Bereits im Jahr 1980 war Schubert auf Vorschlag nach Klagenfurt eingeladen worden, allerdings durfte die Schriftstellerin damals nicht aus der DDR nach Österreich ausreisen – mit der Begründung, dass es keine einheitliche »deutsche« Literatur gebe.
Helga Schubert wuchs in Ost-Berlin auf und studierte in der DDR nach der Reifeprüfung Psychologie an der Humboldt-Universität. Nach dem Studium arbeitete sie als Psychotherapeutin und Beraterin. Ab den 1960er Jahren begann Schubert mit dem Schreiben von Kinderbüchern, Prosatexten, aber auch Theaterstücken und Hörspielen. Bekannt wurde sie etwa durch den Erzählband Lauter Leben mit 31 Texten über unterschiedliche Frauenschicksale oder das dokumentarische Werk Judasfrauen, das vom weiblichen Denunziantentum im Dritten Reich handelt. Während der Zeit der Wende betätigte sich Schubert zwischen 1989 und 1990 politisch als parteilose Pressesprecherin des Zentralen Runden Tisches und bereitete damit die ersten freien Wahlen vor.
Ihr jüngstes Buch Vom Aufstehen beginnt mit einer Kindheitserinnerung an die Sommerferien im Greifswalder Obstgarten ihrer Großeltern, wo sich die Schriftstellerin im Nachhinein ihren idealen Ort vorstellt: in die Hängematte gelegt, mit Streuselkuchen versorgt, den sie im Liegen essen darf. So idyllisch bleibt es nicht immer in diesen Erzählungen. Denn der Vater der Erzählerin ist im Alter von 28 Jahren im Krieg gestorben, wie man sehr bald erfährt, sodass die Mutter ihre Tochter allein großziehen musste:
»Mein Vater ist am 5. Dezember 1941 abends um neunzehn Uhr auf einem vereisten, toten Arm der Wolga von einer Handgranate zerrissen worden und war sofort tot. Es ist ein Trauma meines Lebens: Dieser zerrissene, mir doch unbekannte Mann, ich bin sein einziges Kind, und ich kenne ihn nur aus Erzählungen seiner Mutter […] und aus den Erinnerungen seiner Witwe, meiner Mutter […].«
Das Leben sollte, als der Vater in den Krieg einberufen wurde, eigentlich losgehen: Er war gerade Jura-Referendar geworden, seine Frau hatte ebenfalls ihre erste Stelle angetreten. Es ist gut, dass Helga Schubert in ihren Erzählungen solchen familiären Tragödien ein Denkmal setzt, da es sie infolge der Kriege in großer Zahl gegeben hat, nicht ohne zu vergessen, dass im Osten traditionell nur der Gefallenen des Ersten Weltkriegs gedacht wurde.
»Ich bin ein Kriegskind, ein Flüchtlingskind, ein Kind der deutschen Teilung«, sagt Schubert von sich selbst in einer Knappheit, die die vielfachen Schicksale für einen Nachgeborenen wie mich, den 1990 geborenen Rezensenten, noch verdeutlicht. Mindestens 15 Jahre Distanz bräuchte man zum Geschehen, um vernünftig darüber zu schreiben, zitiert die Schriftstellerin Anna Seghers. Diese 15 Jahre sind längst vergangen, seit sich die gläubige Erzählerin in der evangelischen (oppositionellen) Bewegung der DDR engagiert hat, seit sie Bücher in der DDR und im Westen veröffentlicht hat und seit sie bei den Demonstrationen für den Mauerfall mitlief.
Nicht immer hatte man es als Schriftstellerin oder Schriftsteller in der DDR leicht: Man musste sich für nicht linientreue Äußerungen oder Handlungen rechtfertigen, es kam mitunter wahrscheinlich aus diesem Grund zu vorauseilender Selbstzensur. Lesungen und Preise im Ausland musste man sich von den staatlichen Sicherheitsorganen genehmigen lassen. Oppositionelle Schriftsteller und Künstler wie Wolf Biermann wurden in die BRD ausgebürgert. Da dies so weit weg von den heutigen Verhältnissen ist und man es sich als Nichtbeteiligter nur schwer vorstellen kann, sind autobiographische Zeugnisse wie die von Helga Schubert umso wichtiger.
Auch vom 3. Oktober 1990 erzählt die Autorin, von ihren Erinnerungen an die deutsche Wiedervereinigung und was Daten der deutschen Geschichte wie der 9. November und eben dieser 3. Oktober für sie persönlich bedeuten. Neben der großen Geschichte kommt auch das Private nicht zu kurz: ihr Großvater, ihre Großmutter, die Beziehung zu ihrer Mutter, um die sie sich an deren Lebensende kümmern musste, da diese nicht mit Geld umgehen konnte. Die Wohnung ihrer Mutter, die sie nach ihrem Tod ausräumen musste, vollgestellt mit 10.000 Büchern. Und nicht zuletzt wird es persönlich, wenn die 80-jährige Helga Schubert über ihre Tätigkeit als Schriftstellerin oder politisch engagierte Person, ihren Glauben oder ihr eigenes Älterwerden schreibt:
»Ich komme beim Älterwerden auch langsam aus der Zukunft an, ich nehme Abschied von den Aussichtstürmen, die ich nie besteigen, den warmen Meeren, in denen ich nie baden werde, den Opernhäusern, den Museen in fernen Hauptstädten, der Transsibirischen Eisenbahn, in der ich nicht schlafen werde. Denn ich habe mir in meinem langen Leben alles einverleibt, was ich wollte an Liebe, Wärme, Bildern, Erinnerungen, Fantasien, Sonaten. Es ist alles in diesem Moment in mir. […] Das ist nämlich mein Schatz. Mein unveräußerlicher.«
In der letzten Geschichte, »Vom Aufstehen«, für die der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen wurde, erfahren wir mehr über die nicht immer leichte Beziehung zwischen der Erzählerin bzw. Autorin und ihrer Mutter. Sie macht sich Sorgen, sie könnte gegen das vierte der zehn Gebote verstoßen, demzufolge man Vater und Mutter ehren soll. Sogar eine Pfarrerin muss sie dazu ermutigen, nicht zu streng mit sich selbst zu sein, denn: »Gott verlangt von uns nicht, dass wir unsere Eltern lieben. Wir brauchen sie nur zu ehren.«
Der Leserin und dem Leser wird dieses schwierige Verhältnis verständlich, wenn etwa berichtet wird, dass die Mutter ihre kindliche Tochter verwünschend fragte, warum sie auf der Flucht aus dem Osten nicht gestorben sei. Als die Mutter im Alter von 101 auf der Intensivstation lag, erzählte sie ihrer Tochter von drei Heldentaten, die sie im Laufe ihres Lebens begangen habe und die ihre Tochter betrafen:
»Erstens: Ich habe dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch unerwünscht. Wir haben deinetwegen im fünften Monat geheiratet. Zweitens: Ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung […] bis Greifswald geschoben, und drittens: Ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten. Dein Großvater verlangte nämlich von mir, dass ich mich vergifte oder erschieße. […] Dann muss ich ja mein Kind vorher töten, habe ich zu ihm gesagt, das kann ich nicht.«
Eine zentrale Rolle in den Erzählungen Helga Schuberts spielt die Religion: Kirchliche Feiertage wie Ostern erhalten ein eigenes Kapitel, denn auf Ostern und die damit verbundene Botschaft der Hoffnung bereitet sich die Erzählerin eine ganze Woche vor:
»Heute weiß ich: In dieser Woche vor Ostersonntag passiert alles, was ich inzwischen vom Leben verstanden habe: Wie schnell sich das Schicksal für einen Menschen ändert,
dass man verraten werden kann. Dass es immer unvermuteten Beistand gibt und einen Ausweg. An diese Hoffnung will ich erinnert werden. Einmal im Jahr.«
Es stand für die autobiographische Autorin außer Frage, dass sie sich selbst in der religionsfeindlichen DDR, in der die Konfessionslosigkeit die Regel war, nicht von ihrer Religion abwandte. Auch die sich wiederholenden Termine des Jahreskalenders wie Altweibersommer, Wintersonnenwende, der Winter allgemein oder Neujahr, aber auch (christliche) Lieder, Reime und Verse und Märchen nehmen im Leben und Schreiben der Schriftstellerin als wiederkehrende Möglichkeiten der Erinnerung, des Innehaltens und Maßnehmens sowie als Kategorien, an denen man sich festhalten kann, einen bedeutsamen Platz ein.
Ihre eigene Philosophie des Schreibens resümiert die Autorin in ihrer Geschichte »Warum schreiben«. Das Menschenbild in ihren Erzählungen sei weder böse noch gut, weder hasserfüllt noch liebend, weder das Eine ganz noch ganz das Andere: »Geschichten als Mikrokosmos. Geschichten als Spiegel. Die guten Geschichten sind wie das Leben tragikomisch, plötzlich reißt mich die Geschichte aus dem Mitleid in die Ironie, aus der Ironie in die Verachtung, aus der Verachtung ins Verständnis. Und alles in dem Moment, in dem ich mich auf eine Sicht eingelassen hatte. Nichts ist klar so oder so, erfahre ich beim Schreiben oder spätestens beim Lesen.«
Tatsächlich oszillieren Schuberts Erzählungen häufig zwischen Tragik und Komik, sind eine Mischung aus Vergangenheits- oder Alltagsbewältigung, aus Erinnerungen und sanfter, sehr wohldosierter Ironie. Die Sprache ist klar, treffend und prägnant, so wie es zu Geschichten aus dem Leben einer älteren Dame passt. Nicht alle Erzählungen erreichen das gleiche Niveau: Ein paar leiden ein wenig darunter, dass der rote Faden auf der Strecke verloren geht, sodass es sich eher um eine Aneinanderreihung kurzer Eindrücke handelt. Andere sind in ihrer Gesamtheit nur wenige Seiten lang, was ebenfalls für manche Leserinnen und Leser enttäuschend sein kann. Die Geschichte, bei der die Erzählerin eine Pfarrerin um Rat fragt, ob sie eventuell das vierte Gebot vernachlässige, wird zweimal innerhalb des Erzählbandes aufgegriffen, allerdings in zwei voneinander abweichenden Versionen.
Am besten gefallen haben mir meistens die mittellangen und längeren Erzählungen bzw. die Erzählungen, die auf eine Pointe hinausliefen. Denn Pointen zu setzen ist tatsächlich eine Sache, die Helga Schuberts Erzählkunst immer wieder auszeichnet: Zum Beispiel in der Geschichte »Alles gut« geht es um eine Schwester, die unbedingt in einem Hospiz arbeiten wollte, aber dort wegen der psychischen Belastung nach dem Tod einer ihr ans Herz gewachsenen jungen Frau nicht mehr länger arbeiten konnte. Die Schwester musste die Arbeitsstelle wechseln und sagte seitdem regelmäßig den Satz »Alles gut«. Diese Erzählung namens »Alles gut« endet auch mit diesem kurzen, der Seele schmeichelnden Satz »Alles gut« – und auch die Erzählung »Vom Aufstehen« schließt mit dem Satz »Alles gut« ab, so als wollte Helga Schubert ihren Leserinnen und Lesern signalisieren, dass sich am Ende des Schreibens oder vielleicht sogar des Lebens alles zum Guten fügen kann.
Titelangaben
Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten
München dtv 2021
224 Seiten. 22.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe