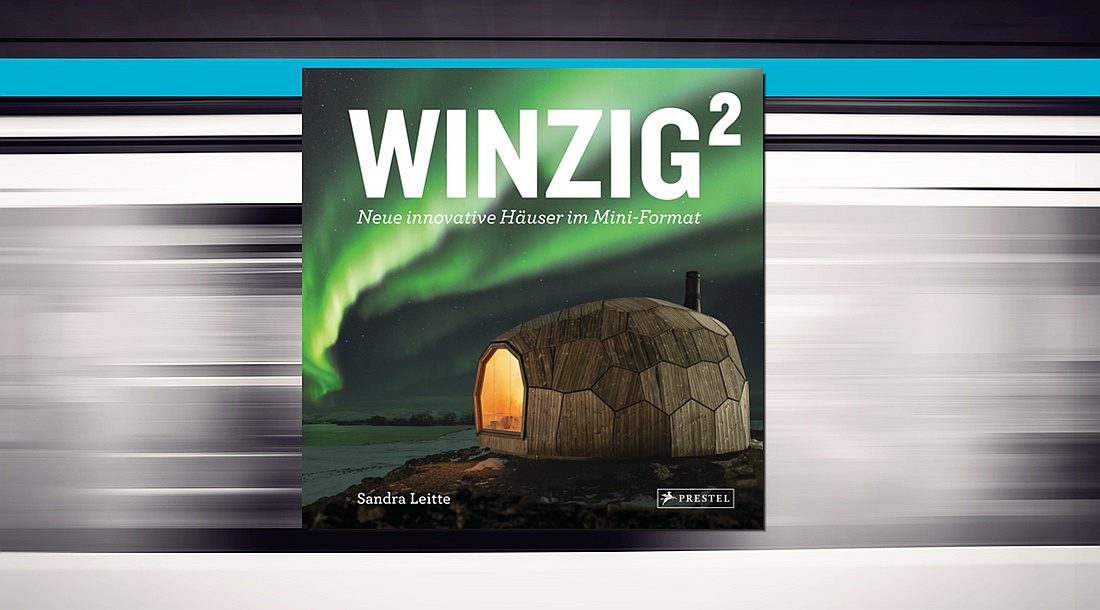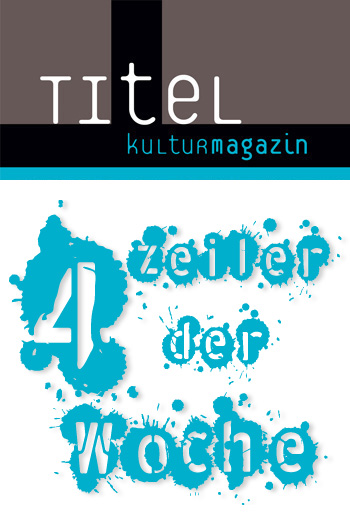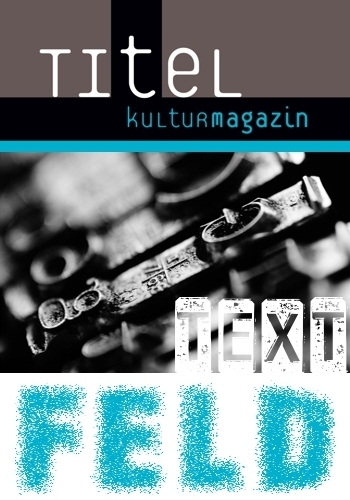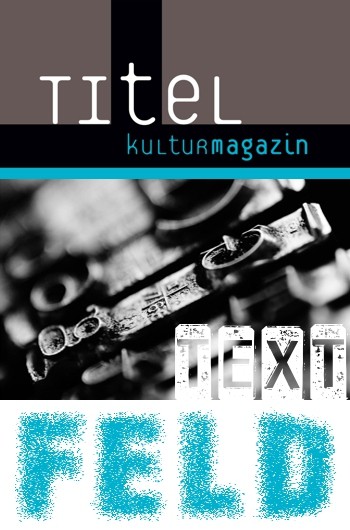»Kein Dichter in diesem mit ihm zu Ende gehenden Jahrhundert hat so bedingungslos wie H. C. Artmann die Existenz und die Würde des Dichtens noch einmal vorgelebt. In keinem Dichter des Jahrhunderts kamen wie bei ihm noch einmal die Möglichkeiten des Dichtens in einer über tausendjährigen Tradition zusammen und zeigten sich wie gerade erst erschaffen, herrlich wie am ersten Tag«, hatte Klaus Reichert auf der Beerdigung des Georg-Büchner-Preisträgers des Jahres 1997 erklärt. Von PETER MOHR
Der urwüchsige Artmann, der seine Wiener Volkstümlichkeit, die im Arbeiterviertel Breitensee ihre Wurzeln hatte, mit einer gehörigen Portion avantgardistischer Experimentierfreudigkeit auf absolut singuläre Weise zu vereinen wusste, war einer der Protagonisten der sogenannten »Wiener Gruppe«. »Man kann Dichter sein, ohne auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben. Vorbedingung ist nur der mehr oder minder gefühlte Wunsch, poetisch handeln zu wollen.« Dieses recht fragwürdige Programm gab sich in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die ›Wiener Gruppe‹, ein lockerer Zusammenschluss damals noch völlig unbekannter Poeten.
Hans Carl Artmann, Sohn eines Wiener Schumachermeisters, der nur eine mäßige Schulbildung genoss, stieß als Vierzehnjähriger zufällig auf ein Handbuch der walisischen Sprache. Fortan war die Beschäftigung mit der Literatur für Artmann eine Art Lebenselexier. Im Alter von 19 Jahren wurde er zur Wehrmacht eingezogen, nach einer Kriegsverletzung geriet er 1945 in Gefangenschaft, wo er zu schreiben begann. Er lernte fremde Sprachen (etwas Japanisch und Malayisch), um sein ausgeprägtes Fernweh zu stillen, reiste kreuz und quer durch Europa, wohnte abwechselnd in Berlin, Malmö und Bern, ehe es ihn wieder zurück ins heimische Wien trieb.
Vor allem hat Artmann aber stets eifrig geschrieben: Lyrik, Prosa und Theaterstücke – so den 500 Seiten umfassenden Lyrik-Sammelband ›ein lilienweißer Brief aus Lincolnshire‹ oder das dreibändige Prosawerk ›Grammatik der Rosen‹.
War Artmann in seinen Anfangsjahren ein besessener, surrealistisch inspirierter Avantgardist, der seine Vorlieben für Villon und Marivaux in seine Gedichte einfließen ließ, so hatte er seinen größten Verkaufserfolg 1958 ausgerechnet mit den Dialektgedichten ›Med ana schwoazzn dintn‹.
»Wien hatte wieder einen Volksbarden«, schrieb darauf hin sein Weggefährte Gerhard Rühm. Als eine »Poetik des Zufalls« hat der Büchner-Preisträger des Jahres 1997 einmal sein eigenes dichterisches Credo beschrieben. »Wer dichten kann / ist dichtersmann, / hat hosen an / und knöpfe dran, / mit denen tut er dichten, / er knöpfelt geschichten / vom hosenlatz / und schenkt sie seinem jeweiligen schatz«, heißt es in einem von Artmanns volkstümlichen Gedichten, die seit 1998 auch die Fassade des Donaucity-Wohnparks schmücken.
Übersehen wurden zuweilen Artmanns große Verdienste als Übersetzer. Er übertrug Theaterstücke von Alfred de Musset, Carlo Goldoni, Lope de Vega und August Strindberg, und er unternahm den schwierigen Versuch, die komplizierten Verse von Francois Villon in den Wiener Dialekt zu übersetzen. Artmann ging es dabei nicht um eine subtile wortgetreue Übersetzung, sondern für ihn stand die poetische Annäherung an den Dichter im Zentrum. Der unkonventionelle Dichter machte auch keinen Hehl aus seiner Vorliebe für Comics und Gruselromane. Ein Jahr vor seinem Tod hatte er ein Asterix-Abenteuer unter dem Titel›Da Leigionäa Asterix‹ in die Wiener Mundart übertragen und veröffentlicht.
Dem kommerziellen Literaturbetrieb stand er stets mit großer Skepsis gegenüber, obwohl er mit vielen renommierten Auszeichnungen (Großer österreichischer Staatspreis, 1974; Literaturpreis der Stadt Wien, 1977; Stadtschreiber von Mainz, 1985/86) reich dekoriert wurde.
Ebenso distanziert war Artmanns Verhältnis zur Politik, »weil ich weiß, dass aus der ganzen Politik nichts herauskommt. Das mag sehr biertischhaft klingen, aber was man am Biertisch sagt, stimmt meistens.« Zwar stand er der EU, der Nato und den politischen Entwicklungen in Österreich kritisch gegenüber. Trotzdem beharrte Artmann immer darauf, ein unpolitischer Zeitgenosse zu sein: »Ich mag einfach keine Obrigkeit haben über mir – also bin ich völlig unpolitisch.« »Und anarchisch«, fügte er hinzu, als er 1997 auf seine geistige Verwandtschaft zu Georg Büchner angesprochen wurde.
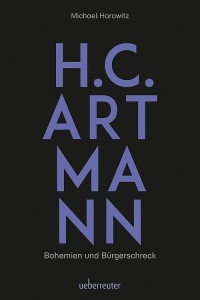 Als Artmann von der FPÖ als »Sozialschmarotzer« beschimpft wurde, erfuhr der Dichter eine selten erlebte Solidarität unter den schreibenden Kollegen, die ihm zu Ehren ein großes Poetenfest veranstalteten. Zum 100. Geburtstag ist nun eine überarbeitete Neuauflage der Biografie von Michael Horowitz erschienen. Dem Buch vorangestellt ist ein Interview mit der Witwe des Dichters, der fast 30 Jahre jüngeren Rosa Pock-Artmann. Auf die Frage, wie HC Artmann seinen 100. Geburtstag feiern würde, antwortete sie: »Wie immer. Man sitzt, spricht und trinkt. Er wäre froh und traurig zugleich, weil er das Leben sehr schätzte, auch wenn er immer wieder betont hat, wie schwer es ist, zu altern.«
Als Artmann von der FPÖ als »Sozialschmarotzer« beschimpft wurde, erfuhr der Dichter eine selten erlebte Solidarität unter den schreibenden Kollegen, die ihm zu Ehren ein großes Poetenfest veranstalteten. Zum 100. Geburtstag ist nun eine überarbeitete Neuauflage der Biografie von Michael Horowitz erschienen. Dem Buch vorangestellt ist ein Interview mit der Witwe des Dichters, der fast 30 Jahre jüngeren Rosa Pock-Artmann. Auf die Frage, wie HC Artmann seinen 100. Geburtstag feiern würde, antwortete sie: »Wie immer. Man sitzt, spricht und trinkt. Er wäre froh und traurig zugleich, weil er das Leben sehr schätzte, auch wenn er immer wieder betont hat, wie schwer es ist, zu altern.«
H.C. (Hans Carl) Artmann war einer der letzten Dichter, der um des Dichtens willen lebte und dessen Kunst das Lebenszentrum war. Durchaus charakteristisch für das Lebenswerk des dichtenden Unikums ist der Titel seines 1989 erschienenen Bandes – ›gedichte von der wollust des dichtens in worte gefaßt‹. Am 4. Dezember 2000 ist HC Artmann im Alter von 79 Jahren in Wien an Herzversagen gestorben.
| PETER MOHR
| Titelfoto: Gert Chesi, H. C. Artmann, CC BY-SA 4.0
Titelangaben
Michael Horowitz: H. C. Artmann – Bohemien und Bürgerschreck
Wien: Ueberreuter Verlag 2021
208 Seiten, 22 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander