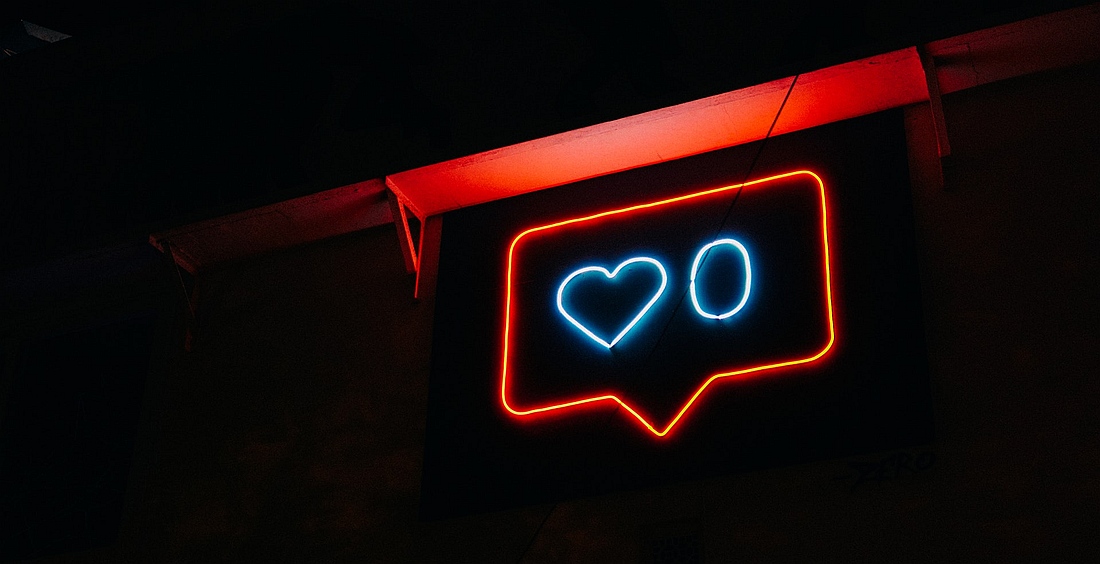Lejla Kalamujić blickt in ihrem Prosaband Nennt mich Esteban zurück auf ihre eigene Vergangenheit. Es ist eine mutige, oft schmerzhafte Rückschau auf Begebenheiten von früher. In den Geschichten erinnert sie sich an ihre Familie, ihre Mutter und die Zeit vor dem Krieg in früheren Jugoslawien. Jedoch ganz ohne nostalgische Verklärung, ohne jegliche ideologische Bewertung. Die junge bosnische Autorin vermisst vielmehr die Stationen ihres Lebens mal sehr analytisch, mal ganz lyrisch und mit großer Symbolkraft. Eine Empfehlung von HUBERT HOLZMANN
 Lejla Kalamujić lebt und arbeitet in Sarajewo, wo sie 1980 geboren wurde. In ihrem Erzählband Nennt mich Esteban stellt sich die Schriftstellerin ihrer Kindheit. Was ist ihr eigentlich von ihrer Mutter geblieben, woran kann sie sich erinnern, sie als Tochter, die mittlerweile fast 30 ist, und die ihre Mutter im Alter von zwei Jahren verloren hat. Die Mutter selbst verunglückte im Alter von 22 Jahren tödlich. Kann es in diesem Alter überhaupt schon eigene Erinnerungen geben oder beruhen alle möglichen Gedanken, Bilder, Erinnerungen an die Mutter womöglich nur auf Geschichten und Erzählungen, als Konstruktion oder Rekonstruktion? Eben als Geschichten aus zweiter Hand, die sie von ihrem Vater, den Großeltern erzählt bekommt und die sie festgemacht an Gegenständen, Bildern, Filmaufnahmen?
Lejla Kalamujić lebt und arbeitet in Sarajewo, wo sie 1980 geboren wurde. In ihrem Erzählband Nennt mich Esteban stellt sich die Schriftstellerin ihrer Kindheit. Was ist ihr eigentlich von ihrer Mutter geblieben, woran kann sie sich erinnern, sie als Tochter, die mittlerweile fast 30 ist, und die ihre Mutter im Alter von zwei Jahren verloren hat. Die Mutter selbst verunglückte im Alter von 22 Jahren tödlich. Kann es in diesem Alter überhaupt schon eigene Erinnerungen geben oder beruhen alle möglichen Gedanken, Bilder, Erinnerungen an die Mutter womöglich nur auf Geschichten und Erzählungen, als Konstruktion oder Rekonstruktion? Eben als Geschichten aus zweiter Hand, die sie von ihrem Vater, den Großeltern erzählt bekommt und die sie festgemacht an Gegenständen, Bildern, Filmaufnahmen?
Dies ist zumindest der Schreibimpuls für die Auftakterzählung des Prosabandes von Lejla Kalamujić »Was bedeutet mir die Schreibmaschine?«. Eine Zeitungsmeldung vermeldet das Ende der Epoche dieser veralteten mechanischen Gerätschaften und weckt die Erinnerung an Mutters Beruf als Stenotypistin. Die Schreibmaschine der Mutter gibt es noch, sie wird in der Familie als Erinnerungsgegenstand aufbewahrt, gelegentlich herausgeholt und bestaunt. Für die Erzählerin sind diese Geschichten über Mutter wie Anekdoten aus einer »verschwundenen Zeit«, haben etwas »Heiliges«. So wie andere Kinder »vor dem Einschlafen Märchen hören«, hat sie »den Geschichten über sie gelauscht«. Als Kind geben sie ihr Halt und sie hinterfragt die Geschichten, die von Mutter geblieben sind, nicht. Sie sind da wie die wenigen Gegenstände, Souvenirs – besser: »Reliquien« –, die an die Mutter erinnern: ein paar »Urkunden, ein Bademantel, der Ehering, das Parteibuch und eine Schreibmaschine«.
Chiffren der Angst, der Bedrohung, der Depression
Der Bruch wird später jedoch offensichtlich. Sind es wirklich eigene Erlebnisse und Erinnerungen oder doch fremde Geschichten über eine im Grunde ja auch fremde Person? Konstanten sind andere in ihrem Leben: die beiden Grundfesten Religion und Staatsideologie etwa, die im alten Jugoslawien bestimmend waren und sich ganz konkret auf das Leben der Menschen dort ausgewirkt haben. Auf das Denken und Handeln: wie »Untermieter«, die »man so schnell nicht los« wird. Wie das auch mit dem Krieg und dem Tod war, die eine zentrale Rolle spielen in den 90er Jahre im zerfallenden Staat.
Aber selbst der Frieden bringt nicht die ersehnte Entspannung. »Dann hörte das Schießen kurz auf…« Denn für die Menschen im Land hat dieser Frieden eher etwas von »Verrat«. Er bringt keine Lösung, keine Entspannung, keine Ruhe. Für die Autorin geraten die Fundamente ins Wanken: Der Großvater stirbt. Die Sicherheit schwindet, die Orte der Kindheit gehen verloren. Ebenso das Vertrauen in die Welt, in der es keine Kontinuität mehr gibt. Auch ihr Vater ist ein Trinker.
Es sind der Schmerz, die Unsicherheit, die Depression, denen sich die Autorin in ihrem Leben irgendwann stellen muss. Alles Persönliche scheint gestört oder zerstört zu sein: Der Vater gibt keinen Halt. Sie hasst ihn und sich. Eine Beziehung zur Mutter kann sie nicht wirklich aufbauen: »vergeblich, vergeblich | vergeblich wecke ich sie« – so der lyrische Vorspruch von Branko Miljković zu einem ihrer Texte »Vergeblich weckst du sie«. So fatal und absolut klingt es auch ihre Bildersprache an, hoffnungslos auch ihr persönliches Fazit: »Ich hasse dich, weil der Himmel weit und verschorft ist – und du daran so absolut gar nichts ändern kannst.« Die Erzählerin findet sich an einem Abgrund wieder und formuliert ihre eigene Wahrheit so: »Der Name der Mutter riecht nach Alkohol.«
Schneewittchen, Esteban und der Tod
In der Erzählung »Weiße Wüste« hilft sie in der Backstube des Onkels mit, formt Brote und auch eine kleine Teigfigur. In ihrer Vorstellung erwacht dabei ihre Mutter als »Snežana«, »Schneewittchen«, als ein kleines Kind, das im Schnee spielt. Fotos zeigen die Mutter in »Latzhose und matschigen Gummistiefeln. Wie Schneewittchen sieht sie da nicht aus, eher noch wie ein Schneemann.« Anekdoten und Wirklichkeit stimmen nicht überein.
Rätselhaft und bedrohlich wirkt auch die nächste Geschichte »Die Guten, die Schlechten und Kafka«, die mitten im Krieg um das geteilte Sarajewo spielt. Ein Besucher klingelt an der Wohnungstür, er wirkt schattenhaft, fast wie ein Todesbote: Es ist ein Mann mit Hut, der sich als Franz Kafka herausstellt. Fast ein wenig bizarr und gebrochen wirkt die folgende Konversation über Lejlas Familiengeschichte. Die Brücke über den roten Fluss stellt sich als nicht passierbar heraus. Ob es für die Erzählerin eine Verbindung zu Kafkas Roman Der Prozess gibt, bleibt fraglich. Dennoch fragt sie: »Wie konntest du nur so was schreiben? Dass ein unschuldiger Mensch stirbt. Einfach so. Ohne Grund.«
Das Spiel mit Chiffren und verdeckten Motiven setzt sich in der Titel gebenden Erzählung »Nennt mich Esteban« fort. Der Unfalltod von Esteban in Almodovars Film Alles über meine Mutter wird neu aufgerollt, es folgt der Hinweis auf eine Kurzgeschichte von Gabriel García Márquez, in der ein Toter am Strand gefunden wird. Es sind Spiegelungen mit dem Tod: der »dumpfe Aufprall des Jungen auf die Frontscheibe des teuren Autos«, »Manuelas schnelle Schritte«, »der Rhythmus ihrer Absätze, die auf den Asphalt knallen« – alles ganz exakte Beobachtungen des Kameramannes am Set, der auch auf Lejlas Leben blicken könnte: »Ein perfekter Tod, der ganz wunderbar zu mir passt.«
Und dann gibt es die fiktiven, aber möglichen Begegnungen mit der Mutter etwa in dem Text »Hätte ich dich getroffen«: ein inniges Zwiegespräch im Park zwischen Leija und ihrer Mutter. Es hätte auch eine Doppelgängerin der Erzählerin sein können, ein Alter Ego. Das zutiefst Menschliche bewegt: gemeinsames Schweigen, Lachen.
Der Verlust der Mutter wiegt schwer für die Erzählerin. Dieser Verlust wird motivisch variiert in »Eine Bitte an Elizabeth«. Hier vermischen sich Zeilen aus einem Gedicht von Elizabeth Bishop mit den Erlebnissen von Lejla Kalamujić. Kontrapunktisch wird der Verlust der Mutter als Verlust der Heimat im Krieg, als Verlust des Friedens, der Großeltern, des Familienhauses und der Erinnerung gezeichnet und verdeutlicht. Die Zwischentexte sind wie eine große Fuge gebaut und verknüpfen artistisch Autobiografisches mit poetischen Bildern. Trotz allem bleibt auch hier die Angst bestimmend. Die Autorin erzählt von ihren Depressionen, ihren Ängste, ihren Klinikaufenthalte.
Oft geht es in den Geschichten von Lejla Kalamujić um winzige Details, um beinahe unscheinbare Bilder. Doch darin werden Erinnerungen geweckt, werden Lebenserfahrungen sichtbar: Im Auge einer ausgestopften Eule »toste eine ganze Galaxie« (»Milchstraße«). Eine Eisenbahnfahrt zeigt die paradoxe Wirklichkeit im Land (»Von-Lokomotive-zu-Lokomotive«). Beim Fahren von A nach B müssen im heutigen Ex-Jugoslawien Grenzen passiert werden, Loks der jeweiligen Bahngesellschaft werden ab- und angekuppelt, die Fahrgäste von den Eisenbahnschaffnern jeweils aufs Neue begrüßt. Drei Ländergrenzen werden auf der kurzen Fahrt überquert – und jedes Mal werden im Grunde dieselben Begebenheiten erlebt. Was so einfach sein könnte, ist es in Realität nicht. Wirklichkeit wiederholt sich, wird repetiert, aufgefächert. Bis zur Unerträglichkeit.
Auch der Weg zum Friedhof, zum Grab der Mutter ist im Grunde nur eine bloße Rückversicherung für die Existenz der Mutter und gibt keinen wirklichen Halt für die Autorin. Der Besuch des Grabs wird zu einem im Alltag verankerten Ritual, es ist eine Aufgabe, die man regelmäßig wiederholt: die gemeinschaftliche Grabpflege, ein »Arbeitseinsatz«. Denn die »Parzelle A 13« gilt es zu putzen und zu bepflanzen. »Es ist unser kleines Samstagsritual.« Für Tränen bleibt da wenig Zeit.
Was dann noch folgt, ist eine Rückschau, nach einer Zäsur von einigen Jahren. Den Tod der Mutter hat die Autorin mittlerweile scheinbar etwas überwunden und bearbeitet: ein Buch über die Abwesenheit der Mutter ist veröffentlicht. Zu einer Begegnung mit der Mutter wird es trotz allem erst mit dem eigenen Tod kommen. Aber: Die Hoffnungslosigkeit ist überwunden. Therapie, Outing und neue Verantwortung im Leben haben die Wunden geheilt: »Und sagst: Weißt du, es ist gut so. Gut, dass ich gestorben bin.«
Der Übersetzung von Marie-Luise Alpermann haben wir es zu verdanken, dass dieser Text fünf Jahre nach der bosnischen Erstausgabe auch auf Deutsch vorliegt. Eindringlich, sehr stimmungsvoll und poetisch wird der Text übertragen. Snežanas Lied etwa erklingt leise im Hintergrund fort, die Eindrücke der Erzählerin werden dazu ganz vorsichtig eingespielt, etwas verhalten, fast wie von ferne: »Sie dachten, ich würde es nicht merken. Würde das Unbehagen in ihren erwachsenen Körpern nicht spüren. Nicht sehen, wie sie ihr Gesicht von mir abwenden. Sich traurige Blicke zuwerfen. Mit Tränen in den Augen. Denn das Lied ist unvermeidlich mit deinem Tod verknüpft. Es erinnert sie daran, wühlt sie auf. Es ist die Totenklage, untrennbar verbunden mit dem Geruch des Hauses, in dem ich aufgewachsen bin.« Eine berührende, eine bereichernde Lektüre.
Titelangaben
Lejla Kalamujić: Nennt mich Esteban
Aus dem Bosnischen von Marie-Luise Alpermann
Berlin: eta Verlag 2020
120 Seiten. 17,90 Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
reinschauen
| Leseprobe