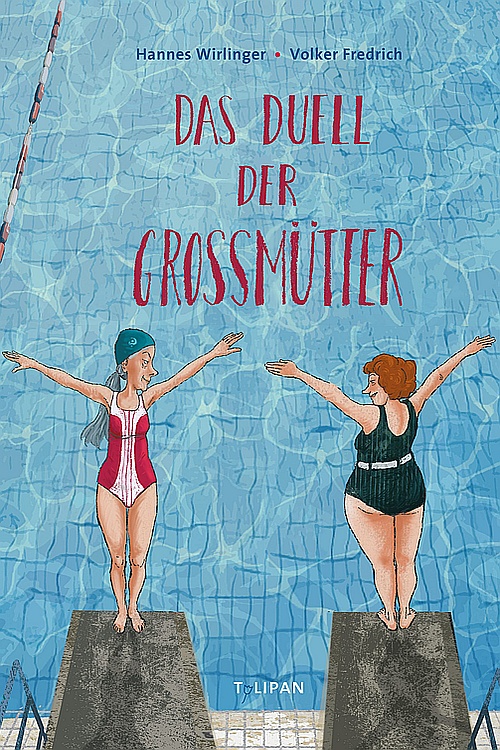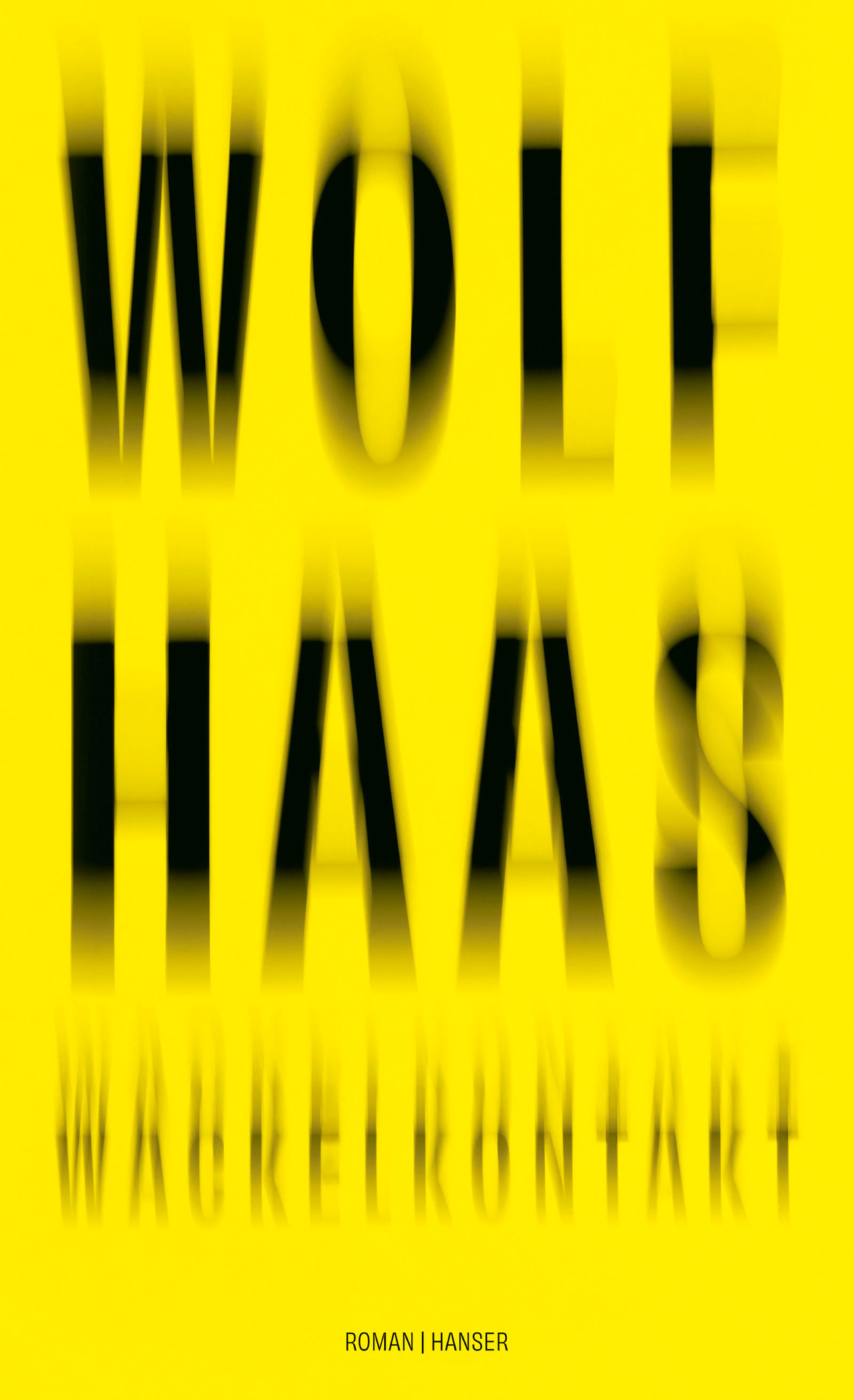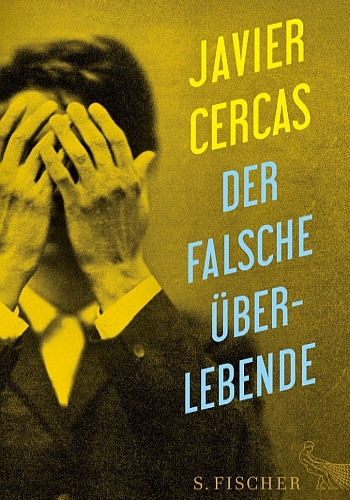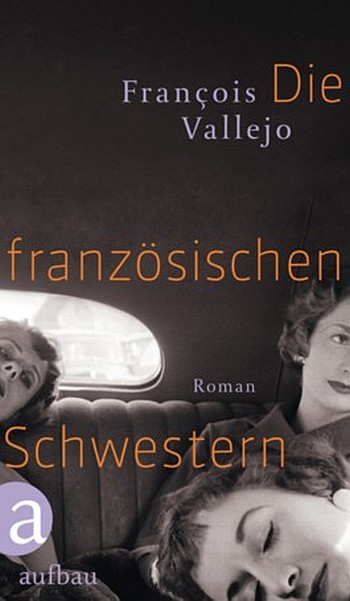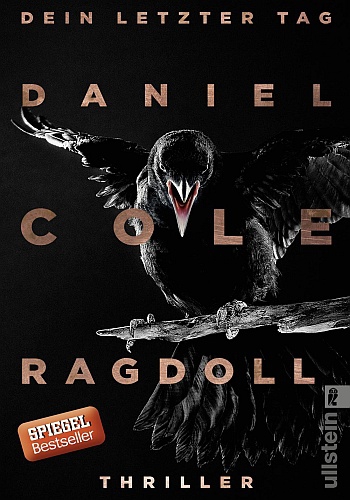Nach zwei Romanen über die Geraer Morduntersuchungskommission – Nummer 3 ist in Arbeit – nimmt der Autor seine Leser diesmal mit in die Eifel. Dort leben in einem kleinen Dorf nahe der luxemburgischen Grenze die 11-jährigen Mädchen Sanne und Ulrike. Man schreibt das Jahr 1978. Es sind Osterferien. Die Fußball-WM in Argentinien steht bevor. Aber noch sind bis dahin knapp zwei Monate Zeit. Dass es aufregende Monate werden, ahnen Annas‘ Heldinnen, als sie Zeuginnen eines Mordes werden und unversehens mitten in eine ebenso spannende wie politisch aufgeladene Geschichte geraten. Von DIETMAR JACOBSEN
 Tag für Tag fahren die beiden 11-jährigen Freundinnen Sanne und Ulrike mit ihren Fahrrädern zu einem Hochsitz am Rand des in der Nähe ihres Dorfes befindlichen Waldes. Hier befindet sich das geheime Refugium der Mädchen. Man kann aus luftiger Höhe bis hin zur Kleinstadt Körperich sehen und, wenn die Sicht gut ist, auf der anderen Seite sogar ein Stück hinein ins nahe Luxemburg.
Tag für Tag fahren die beiden 11-jährigen Freundinnen Sanne und Ulrike mit ihren Fahrrädern zu einem Hochsitz am Rand des in der Nähe ihres Dorfes befindlichen Waldes. Hier befindet sich das geheime Refugium der Mädchen. Man kann aus luftiger Höhe bis hin zur Kleinstadt Körperich sehen und, wenn die Sicht gut ist, auf der anderen Seite sogar ein Stück hinein ins nahe Luxemburg.
Aber auch über die Menschen in ihrer eigenen kleinen Welt, einem winzigen Eifel-Flecken mit alles in allem 25 Häusern, lässt sich, sitzt man hier hoch über allen Köpfen, gut diskutieren. Und diese Welt im Kleinen bietet den beiden pubertierenden Mädchen Sensationen genug, über die man sich tagelang den Kopf zerbrechen kann.
An der Schwelle zum Erwachsenwerden
Ob es ein kaltblütiger Mord ist, zu dessen unfreiwilligen Zeuginnen die beiden nächtens werden, oder die ersten Konfrontationen mit den Abgründen der Sexualität, die sich noch kaum begreifen, geschweige denn in Worte fassen lassen – die Fantasie der Kinder bekommt immer etwas zu tun, auch wenn vieles davon noch nicht verarbeitet und eingeordnet werden kann. Und auch die Menschen, mit denen Sanne und Ulrike Tag für Tag zusammenkommen – Der Hochsitz spielt in den Osterferien des Jahres 1978, Annas‘ Heldinnen haben viel Zeit und Muße, sich ihre Umgebung und die hier Lebenden ganz genau anzusehen – bieten den beiden Beobachterinnen auf der Schwelle zum Erwachsenwerden genug Merkwürdiges und Nachdenkenswertes.
Da stürzt sich etwa eine im ganzen Ort als meschugge verschrieene Frau regelmäßig kopfüber in den Dorfbach, um sich zu verletzen. Da suchen zwei bewaffnete, als RAF-Mitglieder steckbrieflich gesuchte junge Frauen die Gegend nach einem geeigneten Grenzübergang ab. Mit einem protzigen Straßenkreuzer taucht ein offensichtlich vermögender Amerikaner mal hier, mal dort auf, um Hofbesitzer mit Märchensummen zum Verkauf ihrer Anwesen zu bewegen. Banken werden überfallen, Drogen geschmuggelt, Milch verdünnt, Nazi-Devotionalien ausgegraben und verkauft. Und der für Recht und Ordnung zuständige Polizeiobermeister Rolf-Karl Reiter drückt, wenn er nicht gerade mit Verkehrsunfällen und Brandstiftungen beschäftigt ist, auch schon mal ein Auge zu, wenn es zum eigenen Vorteil gereicht.
Drüben war nicht alles besser
Mit Der Hochsitz hat Max Annas das westdeutsche Pendant zu seinen zwei preisgekrönten, in der DDR der 80er Jahre spielenden Romanen um die Geraer Morduntersuchungskommission vorgelegt. Auch in der Welt der Bundesrepublik, so merkt der Leser schnell, war beileibe nicht alles in Ordnung in jenen Tagen, die man häufig als die »gute alte Zeit« apostrophiert findet.
Prügelten Volkspolizisten im östlichen Deutschland auf der Kontrolle des Staates zu entgleiten drohende Jugendliche ein, die ihren Protest über Musik, Outfit und Frisuren ausdrückten, weiß der Bankräuber in der Eifel ganz genau, auf wen der Verdacht fallen wird, wenn er sich mit einer langmähnigen blonden Perücke tarnt. Am Abendbrottisch hört Sanne von ihrem Vater regelmäßig, dass man beim gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft endlich einmal »richtig aufräumen« sollte, ein Exhibitionist packt seinen »Maulwurf« vor den Mädchen aus und dem Dorfpolizisten fallen fast die Augen aus dem Kopf, als Ulrike einmal mit vom Regen durchnässter Bluse vor ihm steht.
Annas vertraut auch in seinem neuen Roman wieder auf schnelle Ortswechsel und einander abwechselnde, unterschiedliche Perspektiven. Noch kleinteiliger als in seinen beiden Vorgängern hat er die Komposition angelegt. Einzig Sanne lässt er als Ich-Erzählerin auftreten. Alle anderen Personen teilen sich dem Leser aus der Halbdistanz eines personalen Erzählstils mit. Die Grobgliederung ist an die erzählte Zeit, die drei Osterferienwochen 1978, angelehnt. Innerhalb der mit Überschriften von »Die ersten Tage der Osterferien« bis zu »Die letzten Tage der Osterferien« versehenen sieben Kapitel sind die einzelnen, szenenartigen Unterabschnitte durchnummeriert. Ihre Länge reicht von wenigen Zeilen bis hin zu sechs Seiten. Das letzte Kapitel fällt dann ein wenig aus diesem Muster heraus. Es präsentiert die Innenwelten von vier Figuren, die auf unterschiedlichen Seiten des gesellschaftlichen Konflikts jener Tage stehen, zweier Terroristinnen und zweier Grenzschützer. Was bei deren Konfrontation aber erst einmal stark nach »Rauchende Colts« riecht, lässt Annas dann doch ganz anders enden.
»I wer‘ narrisch!«
Übrigens handelt es sich bei Sanne und Ulrike um verbissene Sammlerinnen von Panini-Bildchen. Dabei verstehen die Mädchen von Fußball nicht eben viel. Allein im Vorfeld einer Fußball-Weltmeisterschaft gehören die kleinen Konterfeis der in Argentinien für ihre jeweiligen Nationalteams auflaufenden Kicker irgendwie dazu. Wer sie nicht sammelt, ist außen vor.
Und so lassen die Mädchen nicht locker, um ihre selbst gebastelten Alben vollzubekommen, schrecken selbst vor Hanuta-Diebstahl im Dorfladen nicht zurück und riskieren Prügel, wenn sie Sannes großen Brüdern das eine oder andere der begehrten Sammelstücke entwenden. Dass sie sich ausgerechnet bei ihrer Einschätzung des Österreichers Hans Krankl irren, den sie zwar »irgendwie nett« finden, der ihnen aber nicht so aussieht, »als könne er gut Fußball spielen«, ist dabei typisch für einen Roman, in dem nichts so harmlos ist, wie es zunächst den Anschein hat. Und bei dessen Lektüre man hier und da genauso »narrisch« werden könnte wie der legendäre österreichische Sportkommentator Edi Finger angesichts der Tatsache, dass es just jener Krankl ist, der die Deutschen drei Monate später gnadenlos Richtung Heimat schießt.
Titelangaben
Max Annas: Der Hochsitz
Hamburg: Rowohlt 2021
271 Seiten. 22.- Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe