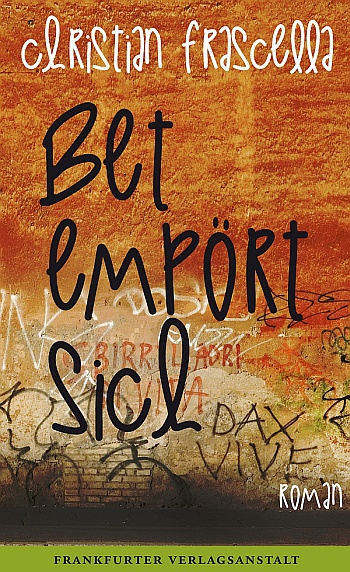Roman | Jürgen Bauer: Was wir fürchten
Wie schon in seinem Debüttext aus dem Jahr 2013 Das Fenster zur Welt stellt Jürgen Bauer in seinem neuen Roman Was wir fürchten die Frage nach dem Urgrund des Menschen. In seinem Erstling fand er die Antwort noch ganz zielgerichtet in einem anderen Menschen, einem Gegenüber, einem Mitspieler und dessen Geschichte, Erfahrungen und Vergangenheit. Diesmal jedoch verunsichert er sein Lesepublikum stark. Denn den jungen österreichischen Autor interessieren nicht die Typen, die auf der Erfolgswelle des Lebens schwimmen oder zumindest nach außen hin die Fassade des Glücks und Erfolgs aufrecht halten können. Jürgen Bauer wählt für seine Texte Protagonisten, die am Rande der Existenz stehen, als Außenseiter der Gesellschaft gelten, grundlegend gescheitert scheinen. Im neuen Roman Was wir fürchten ist es der Protagonist Georg, der sich eine eigene, merkwürdige Welt geschaffen hat und auf die wesentlichen Fragen eigene Antworten gibt. Von HUBERT HOLZMANN
 Jürgen Bauer, Jahrgang 1981, wohnhaft in Wien, wählt in seinem neuen Roman Was wir fürchten – in seinem Debüt gab es noch das Gegensatzpaar der alten Frau und des jungen, arbeitslosen Schauspielers, die zusammen eine Reise in die Vergangenheit unternehmen – wieder einen besonderen Typen, der erneut als Extremist gelten kann. Georg, so heißt der junge Mann, lebt in ständiger Angst vor seinen Mitmenschen und deutet alles in seiner Umwelt, seine Erlebnisse und Eindrücke als mögliche Bedrohung.
Jürgen Bauer, Jahrgang 1981, wohnhaft in Wien, wählt in seinem neuen Roman Was wir fürchten – in seinem Debüt gab es noch das Gegensatzpaar der alten Frau und des jungen, arbeitslosen Schauspielers, die zusammen eine Reise in die Vergangenheit unternehmen – wieder einen besonderen Typen, der erneut als Extremist gelten kann. Georg, so heißt der junge Mann, lebt in ständiger Angst vor seinen Mitmenschen und deutet alles in seiner Umwelt, seine Erlebnisse und Eindrücke als mögliche Bedrohung.
Glaubt man zu Anfang noch einen ironischen Ton herauszuhören, wird man jedoch spätestens nach den ersten Seiten eines Besseren belehrt. Georg meint es ernst. Die Kornkreise, die der Vater im Feld nebenan zieht, die Löcher, die sich plötzlich in der Hauswand finden, und die Episode am Wiener Naschmarkt, in der ein Mädchen von einem mysteriösen Autofahrer beinahe angefahren wird, machen klar, hier gibt es eine ziemliche Schräglage in der Wahrnehmung des Helden. Das Bedrohliche dabei – der Held ist ein Mensch wie du und ich.
Kontrollverlust in einer modernen Welt
Bereits die beiden Motti des Romans – eine Zeile aus dem Song Total Control der Motels und ein Zitat von William S. Burroughs – legen die virtuelle Zwangsjacke bereit, die dem Helden vielleicht mehr als einmal während eines Klinikaufenthalts angelegt wurde. Paranoia, so heißt der medizinische Terminus, mit dem man wohl Georgs Krankheit bezeichnen muss. Paranoia ist auch das Zauberwort und der Schlüssel, womit Georgs Fantasie seit seiner frühesten Kindheit angeregt und gefüttert wurde. »Ich dachte an jene Worte, die [der Vater] mir vor nicht allzu langer Zeit im Kornfeld zugeflüstert hatte: ’Zu Hause ist nur Gift.’«
Da erscheint das Bombenattentat von Bologna im Jahr 1980 nur als Hintergrund für die unzähligen Bedrohungen durch und in der Familie, in der Georg lebt. Der Konflikt zwischen Mutter und Vater, die Übertragung der Mutter auf den Sohn – all das muss der Junge aushalten und verarbeiten. »Bomben und Gift, das waren die beiden Gedanken, die jetzt durch meinen Kopf rasten. Mein Vater aber ignorierte, dass ich mir meine Nase an der Scheibe blutig schlug, und brüllte nur: ’Halt endlich den Mund, sonst explodiere ich!’«
Georgs Ausweg – ein Rückzug ins Ich, die Sicherheit in seinem Kinderzimmer, hier gibt es eine Nachttischlampe: »Es war eine Glaskugel, an deren Innenwand diverse Märchenfiguren durch eine Mechanik im Kreis bewegt wurden, die Schatten an die Wände meines Zimmers warfen.« Mit ein bisschen Proust’scher Ästhetik geht Georg also direkt den Weg in die Krankheit. Das eigenartige Spiel mit dem Nachbarjungen und der Lieblingsplatz mit dem sicheren Versteck im Kellerschrank zeigen ihn als frühen Sonderling.
Durchaus ironisch reflektiert Georg 1986 den Super-GAU von Tschernobyl: »Angst war das bestimmende Gefühl aller Menschen geworden, ich dachte sogar an das eine Wort: Paranoia. Nach all den Jahren fand ich ausgerechnet dieses Gefühl überall in der Umgebung vor. Bisher hatte es mich isoliert und in die Einsamkeit getrieben, doch nun wurde genau jene Emotion, die schon immer ihre Wellen durch meinen Körper geschickt hatte, zur vorherrschenden Stimmung aller Menschen.«
Und doch ein Gegenüber?
Trotz all dem Rückzug, der Isolierung und der Einsamkeit sucht Georg dennoch das Gespräch. Er sucht jedoch keinen Analytiker auf, sondern wählt einen anderen: Gesprächspartner wird der Agent, den Georgs verstorbene Frau einst beauftragt hat, Informationen über ihren seltsamen Mann herauszubekommen. »Meine Überwachung war nie zu Ende gegangen, sie war als Band zwischen mir und meiner Frau all die Zeit erhalten geblieben.« Diesem Privatermittler erzählt Georg bei einer Partie Schach sein gesamtes Leben – vielleicht mehr als nur eine Anspielung auf Stefan Zweig. Jürgen Bauer und sein Held Georg drehen jedoch am Schluss den Spieß um. Jetzt wollen sie zuhören.
Titelangaben
Jürgen Bauer: Was wir fürchten
Wien: Septime Verlag 2015
264 Seiten. 21,90 Euro