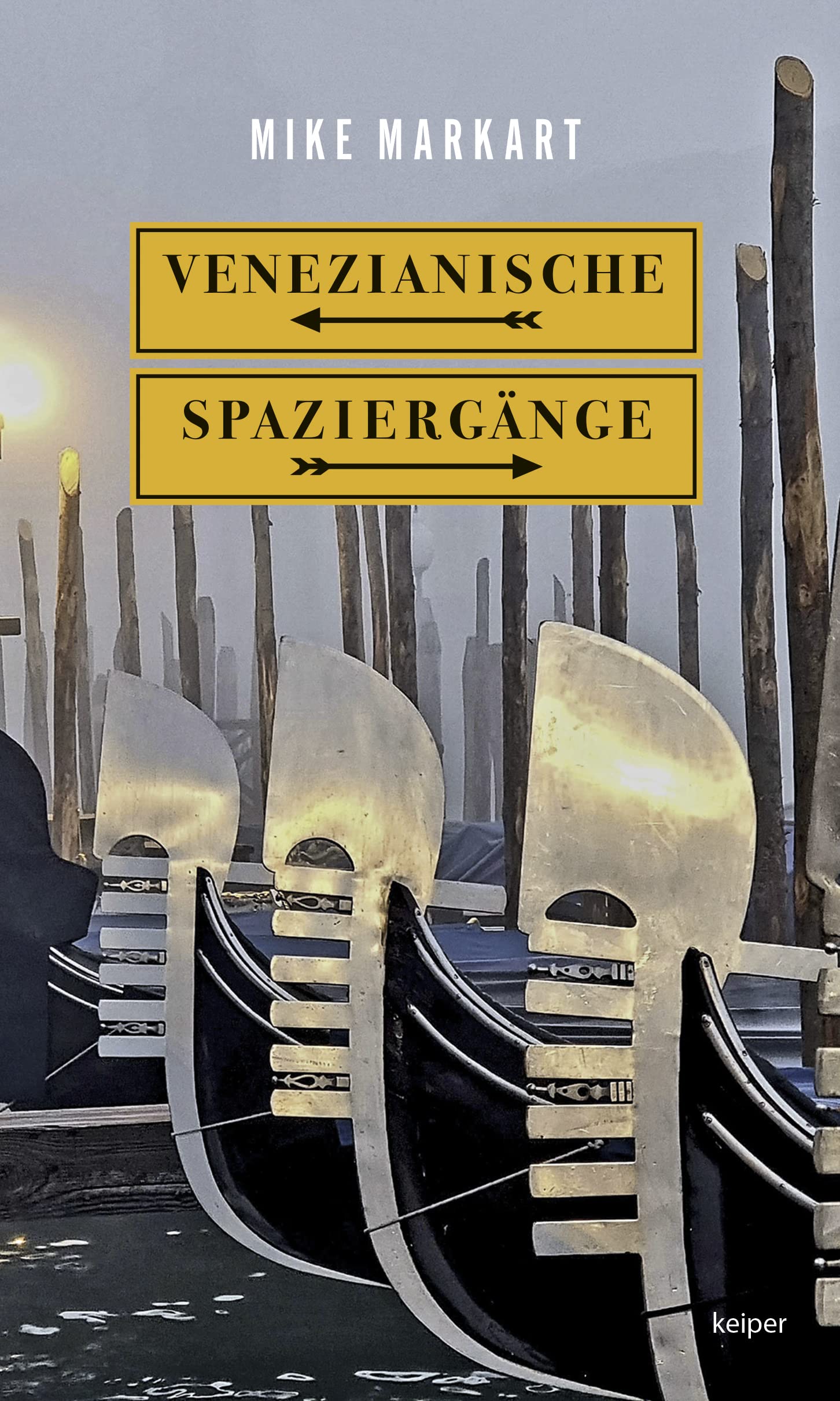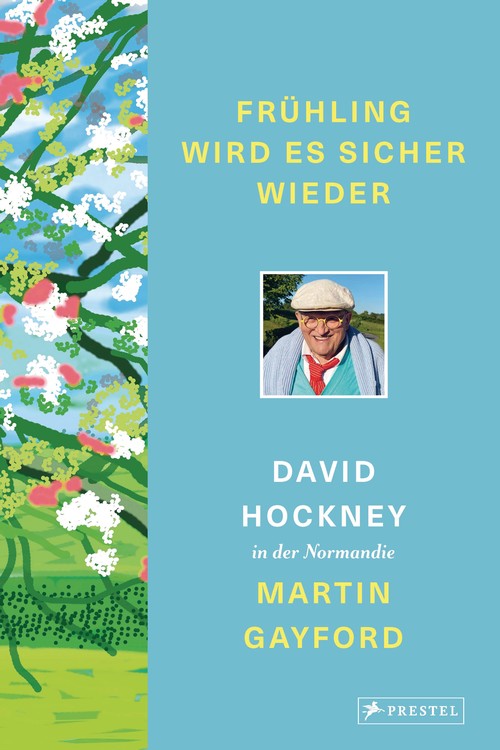Ein neuer Band versammelt 91 vergessene und unbekannte Interviews mit Bertolt Brecht. Ein editorisches Meisterwerk, wie DIETER KALTWASSER findet.
 Er ist ein Klassiker der Weltliteratur und der einflussreichste Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Kaum ein anderer Dichter beherrschte je die Kunst der Rede und Gegenrede, des Widerspruchs so wie Bertolt Brecht. Er forderte sie sogar stets heraus. Der am 10. Februar 1898 in Augsburg als Sohn eines Papierfabrikdirektors geborene Berthold Eugen Friedrich Brecht wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Als er achtzehn Jahre alt war, drohte man ihm, die Schule verlassen zu müssen, wegen feindlicher Äußerungen gegen den Krieg in einem Schulaufsatz. Brecht wurde ein überzeugter Kommunist, der die Welt verbessern wollte und auch das Theater revolutionierte. Er war ein erbitterter Feind des Nationalsozialismus, gegen den er als Künstler kämpfte. Doch auch mit dem realen Sozialismus in der DDR haderte er. Viele seiner Theaterstücke wie die »Dreigroschenoper« oder »Mutter Courage« gehören weltweit zum Repertoire der Theaterbühnen.
Er ist ein Klassiker der Weltliteratur und der einflussreichste Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Kaum ein anderer Dichter beherrschte je die Kunst der Rede und Gegenrede, des Widerspruchs so wie Bertolt Brecht. Er forderte sie sogar stets heraus. Der am 10. Februar 1898 in Augsburg als Sohn eines Papierfabrikdirektors geborene Berthold Eugen Friedrich Brecht wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Als er achtzehn Jahre alt war, drohte man ihm, die Schule verlassen zu müssen, wegen feindlicher Äußerungen gegen den Krieg in einem Schulaufsatz. Brecht wurde ein überzeugter Kommunist, der die Welt verbessern wollte und auch das Theater revolutionierte. Er war ein erbitterter Feind des Nationalsozialismus, gegen den er als Künstler kämpfte. Doch auch mit dem realen Sozialismus in der DDR haderte er. Viele seiner Theaterstücke wie die »Dreigroschenoper« oder »Mutter Courage« gehören weltweit zum Repertoire der Theaterbühnen.
Seine literarische Karriere begann Bertolt Brecht als Verfasser von Zeitungsartikeln. In Berlin erlebte er während der 1920er-Jahre eine prosperierende Presselandschaft, die Herausgeber setzten damals auf die neue Form des Interviews. Obwohl es sich schon einen Platz auf der Zeitungsseite erobert hatte, befand es sich noch in der Phase der Entwicklung. Doch Brecht ließ sich auf dieses Experiment ein; als begabter Selbstdarsteller stürzt er sich auf die neue Form und nutzt sie für seine Zwecke.
Der Schriftsteller und Theatermann Bertolt Brecht wurde im Laufe seiner Karriere zu einem begehrten Interviewpartner. Zu seinem 125. Geburtstag hat der Herausgeber Noah Willumsen für den Suhrkamp Verlag Interviews mit Brecht von 1926 bis 1956 unter dem Titel »Unsere Hoffnung heute ist die Krise – Interviews 1926-1956« versammelt: ein editorisches Meisterwerk.
Jedem dieser 91 Interviews stellt Willumsen eine detaillierte Einleitung voran, in ihnen werden die interviewenden Personen vorgestellt und der jeweilige zeitgenössische Kontext vermittelt. Obwohl weniger als die Hälfte aller Interviews zunächst auf Deutsch publiziert wurden, wurden fast alle auf Deutsch geführt. Wenige Ausnahme bilden Gespräche mit amerikanischen Interviewenden, die »halb auf Englisch, halb auf Deutsch« geführt wurden.
Der Leser erfährt, wie präzise Brecht sich auf die Interviews vorbereitete, um die seiner Meinung nach nötige PR für sein Theater zu machen. Brecht präsentiert sich den Lesern nicht nur als Schriftsteller und Theaterregisseur, sondern auch als Kulturmanager. Dies wird besonders deutlich in Brechts Ringen um die Rolle einer autonomen Position der Kunst und des Künstlers in der DDR nach seiner Rückkehr aus dem Exil. Die größtenteils bisher unbekannten Interviews des Schriftstellers, die sich über 15 Länder und seine ganze Karriere erstrecken, zeigen den großen Klassiker der Moderne als wortmächtigen Medienkünstler.
Brecht besaß die Gabe, wie ein Zeitgenosse einmal bemerkte, in einem »Gespräch mit präzisen, drastischen Formulierungen« zu brillieren. Verfolgt Brecht anfänglich noch das Ziel, sein episches Theater bekannt zu machen, geht es ihm nach der «Dreigroschenoper» um den Marxismus. Später um sein künstlerisches Überleben im Exil, und zuletzt um das eigene Theater in Ost-Berlin.
Mit Ausnahme seiner schriftstellerischen Anfänge in Augsburg und München gab Brecht in jeder Phase seiner Karriere Interviews. Der Herausgeber unterteilt die Texte in vier Phasen: Weimarer Republik (1926-1932), Exil (1933-1947), Wiederkehr (1947-1949) und DDR (1949-1956). In der Weimarer Republik kam es zu 15 Gesprächen, »für die ein streitlustiger publizistischer Enthusiasmus und das Experimentieren mit dem neuen Medium Rundfunk bezeichnend sind.« Ein Interview wurde in der UdSSR geführt, zwei für Zeitungen in Italien und Polen.
Die 1920er Jahre sind für Brecht durch den Umzug in die Großstadt Berlin und vermehrte Anstrengungen geprägt, sich durch schriftstellerische Arbeiten einen Namen zu machen und sein Leben zu finanzieren, was spätestens mit der erfolgreichen Aufführung der »Dreigroschenoper« am 31.8.1928 gelang. Bereits 1922 erhielt er den Kleistpreis für seine Stücke »Baal«, »Trommeln in der Nacht« und »Im Dickicht der Städte«.
Die Phase nach Brechts Flucht vor den Nazis umfasst 26 Pressegespräche, die alle Stationen von Brechts Exil nachzeichnen: »Die vielen Umzüge und Neuanfänge, und die wenigen Inszenierungen und Literaturabende, zu denen er anreist; in den USA wurde er allerdings nur sporadisch um Kommentare gebeten.« Die letzte Phase beginnt 1949 mit seiner Übersiedlung in die DDR: Die 38 Gespräche gehören, so der Herausgeber, »zu einer neuen Epoche in der Geschichte der Form des Interviews, die umfassender und offener wird.« Gemäß der kollektiven Arbeitsweise des 1949 neu gegründeten »Berliner Ensembles« (BE), fanden die Gespräche nun oft in Gruppen statt. Die Gastspiele in Paris sowie die künstlerischen und kulturpolitischen Besuche Brechts in Warschau und Mailand wurden »zu Medienereignissen, die international wahrgenommen wurden«, so Willumsen.
Im Jahre 1952 kommt es zu einer Begegnung zwischen Brecht und dem späteren »Literaturpapst« Marcel Reich-Ranicki. An diesem Gespräch war auch Helene Weigel beteiligt, die mit Brecht das Berliner Ensemble gegründet hatte. Brechts »Selbstinszenierung« setzte Reich-Ranicki in Erstaunen. »Ich hatte den Eindruck, dass er immer Theater spielte.« Nach einem Treffen mit Anna Seghers war Reich-Ranicki überzeugt, dass »die meisten Schriftsteller von der Literatur nicht mehr verstehen als die Vögel von der Ornithologie.«
Das letzte Interview mit Brecht fand Ende Juni 1956 zwei Wochen vor seinem Tod statt. Er war krank und kam nur noch wenige Stunden am Tag nach Berlin. Das Interview wurde vom britischen Kritiker Ronald Hayman für das »London Magazine«, einer literarischen Monatszeitschrift, geführt. Hayman vergleicht Brecht mit einem Mönch, der in karger Einrichtung lebt. »Ich ging enttäuscht weg«, heißt es bei Hayman nach dem Ende des Interviews. Brecht hatte nichts von sich preisgegeben.
Titelangaben
Bertolt Brecht: »Unsere Hoffnung heute ist die Krise«
Interviews 1926-1956 Herausgegeben von Noah Willumsen
Berlin: Suhrkamp Verlag 2023
752 Seiten, 35 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe